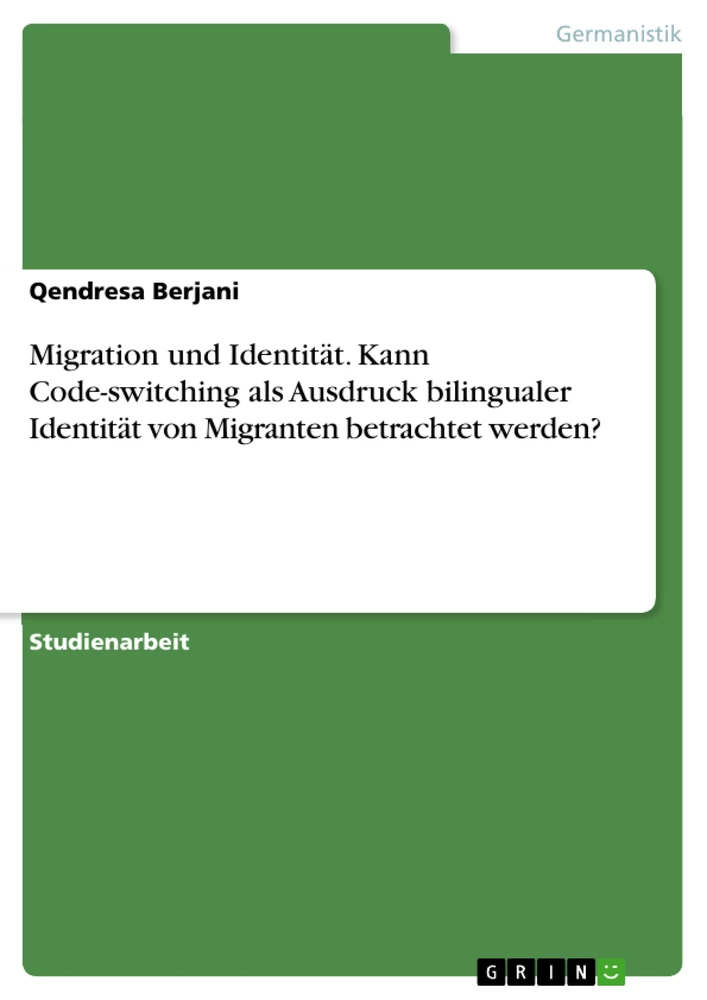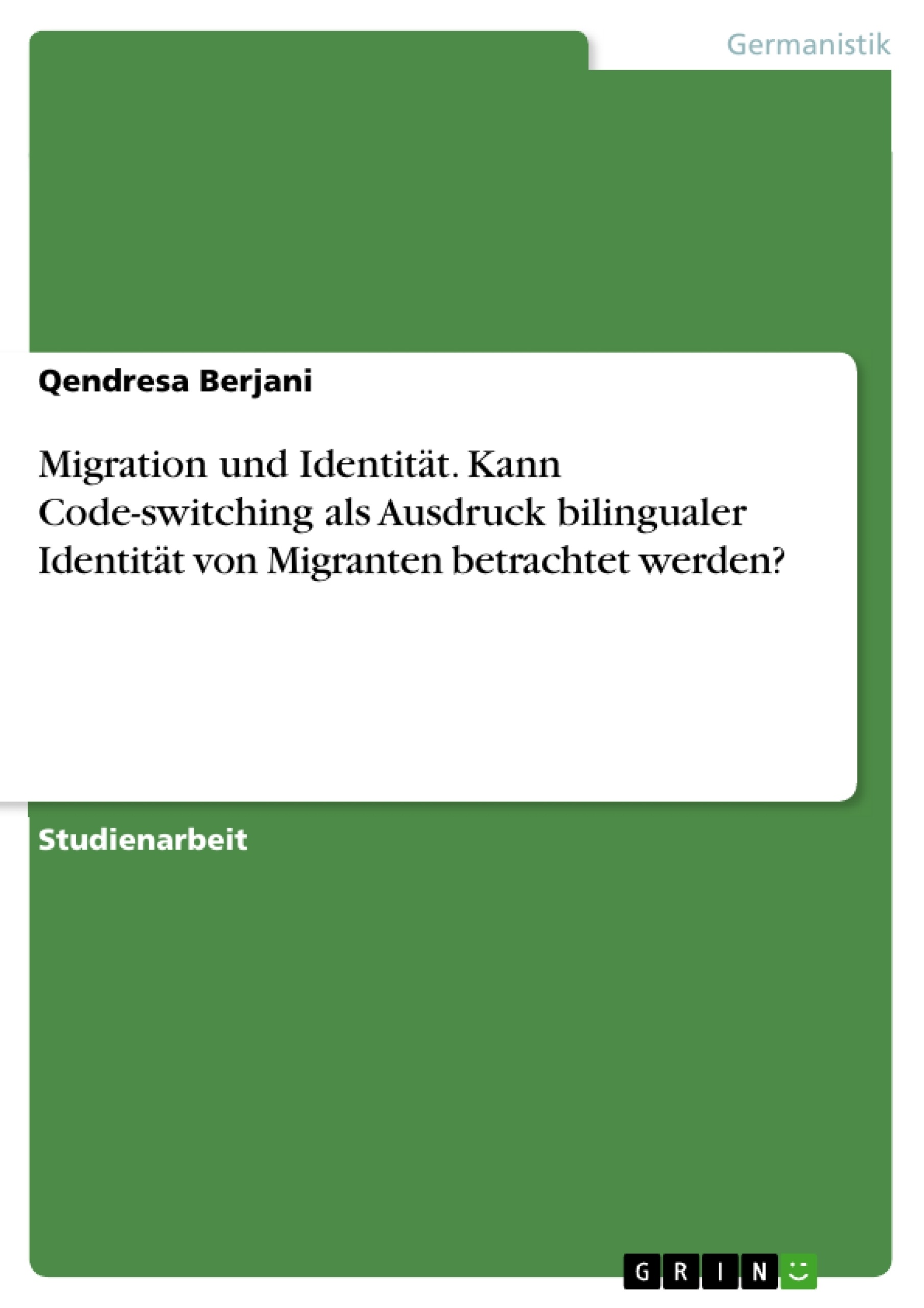Darauf basierend, dass Sprache einen der wichtigsten Identitätsfaktoren darstellt und Identität durch Sprache konstituiert wird, stellt sich die Frage, ob das Code-switching (zwischen zwei Sprachen) als Ausdruck bilingualer Identität von Migranten betrachtet werden kann?
Aufgrund dessen, dass im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Gruppe der Migranten fokussiert wird und sich durch Migration Mehrsprachigkeit ergibt, befasst sich das erste Kapitel der vorliegenden Arbeit sowohl mit den Typen von Mehrsprachigkeit als auch mit der individuellen Mehrsprachigkeit. Darüber hinaus wird in diesem Kapitel der Bilingualismus als Sonderfall von Mehrsprachigkeit beschrieben, da im Rahmen der vorliegenden Arbeit der Wechsel zwischen zwei Sprachen hervorgehoben wird. Hinsichtlich der Fragestellung wird im sich daran anschließenden Kapitel aufgrund der zahlreichen Definitionen von Identität der Begriff definiert. In Kapitel 3.1 wird auf die Rolle der Sprache für die Identität eingegangen, da Sprache eine große Relevanz für die Identität eines Individuums besitzt. Das Zwischenfazit: Bilinguale Identität stellt eine Zusammenführung der Kapitel 2 bis 3.1 dar und hält die Punkte fest, die für eine bilinguale Identität bei Mehrsprachigen von Bedeutung sind. Im vierten Kapitel wird das Code-switching beschrieben, um im Anschluss die Fragestellung beantworten zu können. Im letzten Kapitel der Arbeit findet sich schließlich ein Fazit, welches die wichtigsten Ergebnisse festhält.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Mehrsprachigkeit
- 2.1 Typen von Mehrsprachigkeit
- 2.2 Individuelle Mehrsprachigkeit
- 2.3 Bilingualismus
- 3 Identität
- 3.1 Rolle der Sprache für die Identität
- 3.2 Zwischenfazit: Bilinguale Identität
- 4 Code-switching
- 5 Code-switching als Ausdruck bilingualer Identität von Migranten?
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Frage, ob Code-switching als Ausdruck bilingualer Identität von Migranten betrachtet werden kann. Dabei wird der Fokus auf die Rolle der Sprache für die Konstitution von Identität gelegt.
- Definitionen und Typen von Mehrsprachigkeit
- Der Begriff der Identität und die Rolle der Sprache
- Code-switching als sprachliche Praxis
- Bilinguale Identität von Migranten
- Mehrsprachigkeit in der Migrationsgesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die verschiedenen Typen von Mehrsprachigkeit und beschreibt den Bilingualismus als Sonderfall. Im zweiten Kapitel wird der Begriff der Identität definiert und die Rolle der Sprache für die Identität hervorgehoben. Das dritte Kapitel stellt ein Zwischenfazit zur bilingualen Identität dar und führt die wichtigsten Punkte aus den Kapiteln 2 und 3.1 zusammen. Im vierten Kapitel wird das Code-switching beschrieben, um im Anschluss die Fragestellung der Arbeit zu beantworten.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Bilingualismus, Identität, Code-switching, Migrationshintergrund, Sprachverwirrung, Sprachkompetenz, Kommunikationsform, Bilinguale Identität.
Häufig gestellte Fragen zu Code-switching und Identität
Was genau ist Code-switching?
Code-switching bezeichnet den fließenden Wechsel zwischen zwei oder mehr Sprachen innerhalb einer Konversation oder sogar innerhalb eines Satzes.
Ist Code-switching ein Zeichen mangelnder Sprachkenntnisse?
Nein, moderne Forschung sieht darin eine hohe sprachliche Kompetenz, da der Sprecher beide Sprachsysteme so beherrscht, dass er sie strategisch und situativ einsetzen kann.
Wie drückt Code-switching eine bilinguale Identität aus?
Für Migranten ist der Wechsel zwischen den Sprachen oft ein Ausdruck ihrer Zugehörigkeit zu zwei Kulturen. Die Sprache konstituiert hierbei eine hybride, bilinguale Identität.
Welche Rolle spielt die Sprache für die Identität allgemein?
Sprache ist einer der wichtigsten Identitätsfaktoren. Durch sie drücken wir unsere Herkunft, unsere sozialen Bezüge und unser Selbstverständnis aus.
Was ist individuelle Mehrsprachigkeit?
Individuelle Mehrsprachigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Einzelnen, im Alltag zwischen verschiedenen Sprachen zu kommunizieren, was besonders in Migrationsgesellschaften häufig vorkommt.
- Citation du texte
- Qendresa Berjani (Auteur), 2016, Migration und Identität. Kann Code-switching als Ausdruck bilingualer Identität von Migranten betrachtet werden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1128782