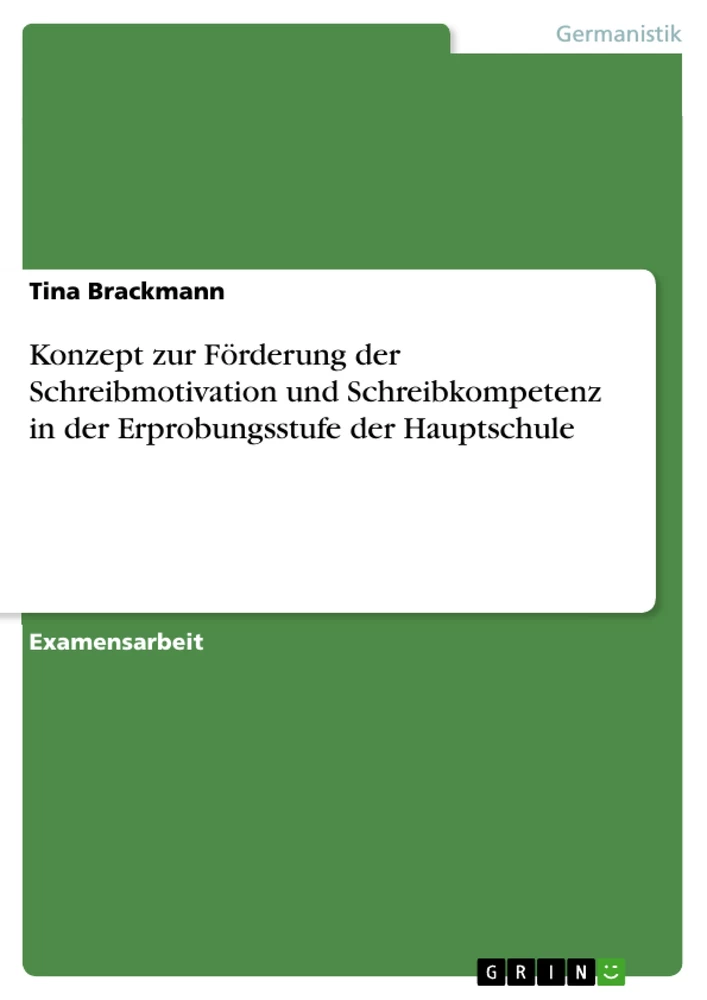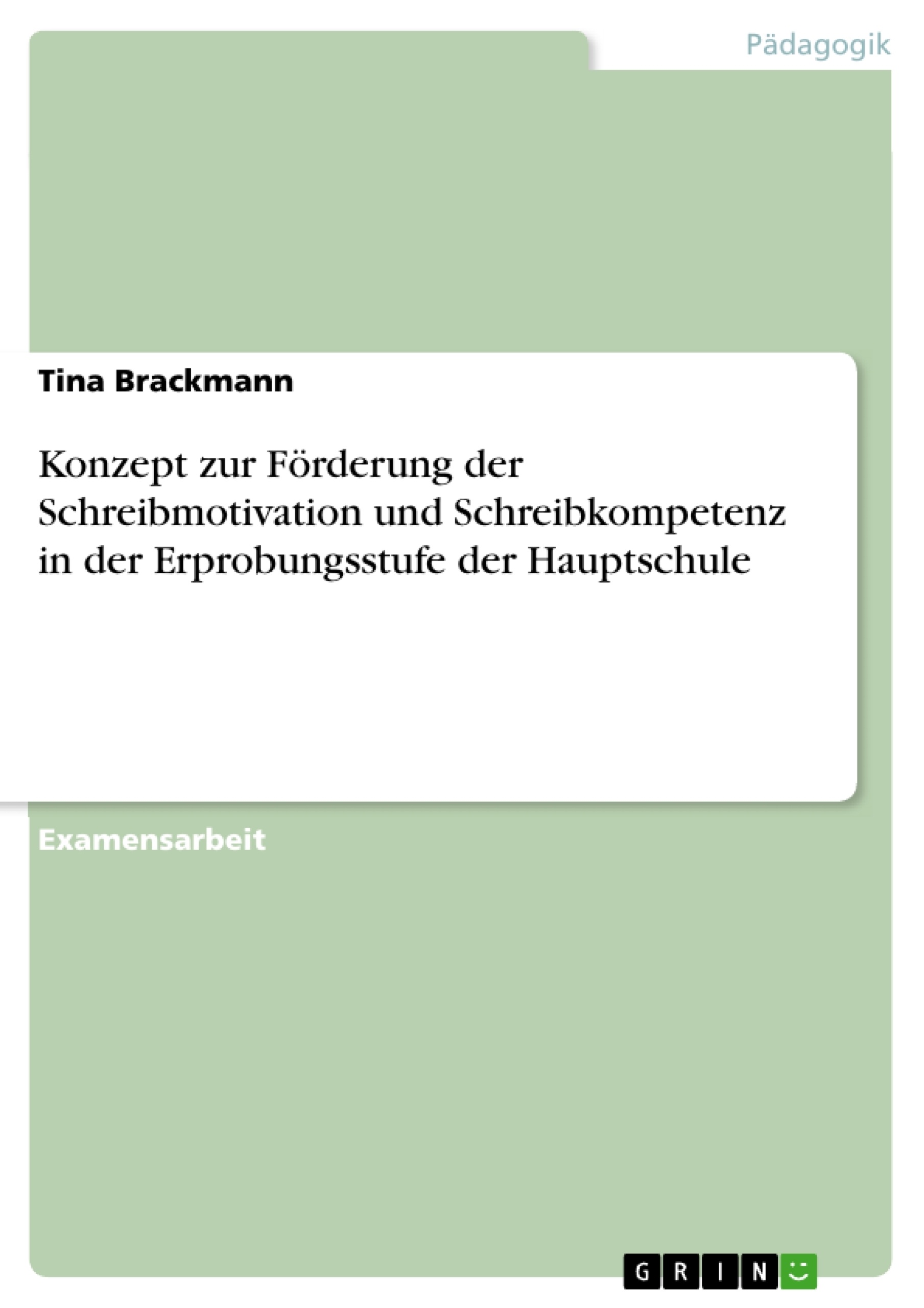Mein „Konzept zur Förderung der Schreibmotivation und Schreibkompetenz in der Erprobungsstufe“ setzt die Schwerpunkte auf die Lehrerfunktionen Unterrichten und Erziehen und berücksichtigt die Bereiche Evaluieren, Innovieren und Kooperieren.
Schreiben und Lesen sind die vorrangigen Schlüsselkompetenzen, die eine erfolgreiche Schullaufbahn und spätere Berufsausbildung ermöglichen. Schreiberziehung in der Schule bildet die Grundlage für beruflichen und persönlichen Erfolg.
Seit Februar 2004 unterrichte ich im Rahmen meines Referendariats die Fächer Deutsch und Kunst an der Gemeinschaftshauptschule. Die Hauptschule wird von 797 Schülern besucht. Sie ist sechszügig und aufgeteilt in 35 Klassen.
47 % der Schüler und Schülerinnen haben Migrationshintergrund. Bei diesen Schülern sind die Basiskompetenzen in den Bereichen Schreiben, Lesen und Sprechen, auch wenn sie die Grundschule durchlaufen haben, überwiegend schwach, da sie zu Hause in ihrer Muttersprache reden. Die Eltern sind häufig der deutschen Sprache nicht mächtig und können ihre Kinder bei schulischen Fragen nicht unterstützen. Die Mehrzahl der Schüler und Schülerinnen der Hauptschule kommen aus einem sozialen Umfeld, das nicht schreibförderlich ist. Deshalb ist es hier besonders wichtig, zunächst zum Schreiben zu motivieren um dann eine „Schreibkultur“ aufzubauen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Schreibmotivation
- 2.2 Schreibkompetenz
- 2.3 Ansätze der Schreibdidaktik
- 2.4 Die Bausteine des Konzepts zur Förderung der Schreibmotivation und Schreibkompetenz in der Erprobungsstufe
- 2.4.1 Das Lesetagebuch
- 2.4.2 Das kreative und das freie Schreiben
- 2.4.2.1 Das kreative Schreiben
- 2.4.2.2 Das freie Schreiben
- 2.4.3 Schreibwettbewerbe/-projekte
- 2.4.4 Förderung der Schreibkompetenz durch Textüberarbeitungen
- 3. Der Aufbau des Konzepts
- 3.1 Zeitlicher Ablauf (Übersicht)
- 3.2 Der Fragebogen
- 3.3 Die Bausteine des Konzepts im Unterricht
- 3.3.1 Das Lesetagebuch im Unterricht
- 3.3.2 Das kreative Schreiben im Unterricht
- 3.3.3 Das freie Schreiben im Unterricht
- 3.3.3.1 Schreibanlässe
- 3.3.3.2 Das Freie-Texte-Heft
- 3.3.3.3 Die Schreibstunde
- 3.3.3.4 Die Vorlesestunde
- 3.3.4 Schreibprojekte/-wettbewerbe im Unterricht
- 3.3.4.1 Schreibprojekte
- 3.3.4.1.1 Schreibprojekt: „Die Straße, in der ich wohne“
- 3.3.4.1.2 Schreibprojekt: „Büchererstellungen“
- 3.3.4.2 Schreibwettbewerbe
- 3.3.5 Textüberarbeitungen
- 3.3.5.1 Die Rechtschreibkorrektur
- 3.3.5.2 Das Schreibkarussell
- 3.3.5.3 Die Textlupe
- 3.3.5.4 Die Schreibkonferenz
- 3.4 Veröffentlichungen
- 3.4.1 Der Freie-Texte-Ordner
- 3.4.2 Textausstellungen
- 3.4.3 Autorenlesung
- 3.4.4 Homepage der Schule
- 4. Evaluation und Ausblick
- 4.1 Evaluation
- 4.2 Ausblick: Das schulische Schreib- und Lesezentrum (SLZ)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschreibt ein Konzept zur Förderung der Schreibmotivation und Schreibkompetenz in der Erprobungsstufe der Hauptschule. Ziel ist es, die Schreibfreude und die Schreibfähigkeiten der Schüler zu verbessern, indem verschiedene Methoden wie Lesetagebücher, kreatives und freies Schreiben, Schreibwettbewerbe und Textüberarbeitungen eingesetzt werden. Das Konzept zielt darauf ab, eine positive Schreibkultur zu etablieren und die Schüler auf ihrem Weg zu einer erfolgreichen Schullaufbahn zu unterstützen.
- Förderung der Schreibmotivation bei Hauptschülern
- Verbesserung der Schreibkompetenz durch verschiedene Methoden
- Etablierung einer positiven Schreibkultur im Unterricht
- Berücksichtigung unterschiedlicher Lerntempi und individueller Bedürfnisse
- Integration von Schreibaktivitäten in den regulären Deutschunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Ausgangssituation an einer Hauptschule mit vielen Schülern mit Migrationshintergrund und daraus resultierenden Schwierigkeiten im Bereich Schreiben. Die Autorin schildert Beobachtungen aus ihrem Unterricht, die die Notwendigkeit eines umfassenden Konzepts zur Steigerung der Schreibmotivation und -kompetenz verdeutlichen. Die mangelnde Schreibpraxis der Schüler in der Freizeit wird hervorgehoben, ebenso wie die Schwierigkeiten beim sprachlichen Ausdruck und die allgemeine Demotivation. Die Arbeit begründet die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes, der die individuellen Bedürfnisse der Schüler berücksichtigt und auf die Stärkung des Selbstvertrauens abzielt. Die Autorin kündigt ihr Konzept an, das auf verschiedenen Methoden basiert.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für das entwickelte Konzept dar. Es werden verschiedene Aspekte der Schreibmotivation und -kompetenz beleuchtet, und es werden didaktische Ansätze zur Förderung des Schreibens diskutiert. Die Autorin erläutert die einzelnen Bausteine ihres Konzepts, darunter das Lesetagebuch, kreatives und freies Schreiben, Schreibwettbewerbe und die gezielte Förderung der Schreibkompetenz durch Textüberarbeitungen. Jeder Baustein wird kurz vorgestellt und in seinen didaktischen Ansatz eingeordnet, um den theoretischen Rahmen für die praktische Umsetzung im Kapitel 3 zu schaffen. Die Auswahl der Bausteine wird durch den Kernlehrplan Deutsch für die Hauptschule begründet.
3. Der Aufbau des Konzepts: Dieses Kapitel beschreibt detailliert den Aufbau und die praktische Umsetzung des Konzepts. Es wird ein zeitlicher Ablaufplan vorgestellt, und die einzelnen Bausteine werden im Kontext des Unterrichts erläutert. Das Kapitel beschreibt die konkreten Schritte der Durchführung, wie z.B. die Integration des Lesetagebuchs, des kreativen und freien Schreibens und der Schreibprojekte in den Unterricht. Es werden konkrete Beispiele für Schreibanlässe, die Gestaltung des „Freie-Texte-Heftes“ und die Organisation von Schreibstunden und Vorlesestunden präsentiert. Die verschiedenen Methoden zur Textüberarbeitung (Rechtschreibkorrektur, Schreibkarussell, Textlupe, Schreibkonferenz) werden detailliert beschrieben und in ihre Bedeutung für das Gesamtkonzept eingeordnet. Auch die Möglichkeiten der Veröffentlichung der Schülertexte (Freie-Texte-Ordner, Textausstellungen, Autorenlesung, Schulhomepage) werden erläutert.
Schlüsselwörter
Schreibmotivation, Schreibkompetenz, Hauptschule, Erprobungsstufe, Lesetagebuch, kreatives Schreiben, freies Schreiben, Schreibwettbewerbe, Textüberarbeitung, Schreibdidaktik, Schülermotivation, Deutschunterricht, positive Schreibkultur.
Häufig gestellte Fragen zum Konzept zur Förderung der Schreibmotivation und Schreibkompetenz in der Erprobungsstufe
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument beschreibt ein umfassendes Konzept zur Verbesserung der Schreibmotivation und -kompetenz von Hauptschülern in der Erprobungsstufe. Es beinhaltet eine detaillierte Darstellung des Konzepts, einschließlich theoretischer Grundlagen, praktischer Umsetzung und Evaluation.
Welche Ziele verfolgt das Konzept?
Das Konzept zielt darauf ab, die Schreibfreude und die Schreibfähigkeiten der Schüler zu steigern, eine positive Schreibkultur zu etablieren und die Schüler auf ihrem Weg zu einer erfolgreichen Schullaufbahn zu unterstützen. Es möchte die Schreibmotivation fördern, die Schreibkompetenz verbessern und die individuellen Bedürfnisse der Schüler berücksichtigen.
Welche Methoden werden im Konzept eingesetzt?
Das Konzept nutzt eine Vielzahl von Methoden, darunter Lesetagebücher, kreatives und freies Schreiben, Schreibwettbewerbe und Textüberarbeitungen (Rechtschreibkorrektur, Schreibkarussell, Textlupe, Schreibkonferenz). Die Methoden sind darauf ausgerichtet, die Schüler aktiv am Schreibprozess zu beteiligen und ihr Selbstvertrauen zu stärken.
Wie ist das Konzept aufgebaut?
Das Konzept gliedert sich in verschiedene Bausteine: Einleitung, theoretische Grundlagen (Schreibmotivation, Schreibkompetenz, didaktische Ansätze), detaillierte Beschreibung des Konzepaufbaus (zeitlicher Ablauf, Fragebogen, praktische Umsetzung der einzelnen Bausteine im Unterricht, Veröffentlichungsmöglichkeiten der Schülertexte), Evaluation und Ausblick.
Wie wird das Konzept im Unterricht umgesetzt?
Die Umsetzung beinhaltet die Integration der verschiedenen Bausteine in den regulären Deutschunterricht. Es werden konkrete Beispiele für Schreibanlässe, die Gestaltung des „Freie-Texte-Heftes“, die Organisation von Schreibstunden und Vorlesestunden sowie die Durchführung von Schreibprojekten und -wettbewerben beschrieben.
Welche Möglichkeiten der Veröffentlichung von Schülertexten gibt es?
Das Konzept sieht verschiedene Möglichkeiten der Veröffentlichung vor, darunter einen „Freie-Texte-Ordner“, Textausstellungen, Autorenlesungen und die Präsentation auf der Schulhomepage. Dies soll die Schüler motivieren und ihre Leistungen sichtbar machen.
Wie wird das Konzept evaluiert?
Das Dokument beschreibt die Evaluation des Konzepts, allerdings ohne konkrete Ergebnisse. Es wird ein Ausblick auf die mögliche Einrichtung eines schulischen Schreib- und Lesezentrums (SLZ) gegeben.
Für wen ist dieses Konzept relevant?
Dieses Konzept ist relevant für Deutschlehrer an Hauptschulen, insbesondere in der Erprobungsstufe, die die Schreibmotivation und -kompetenz ihrer Schüler verbessern möchten. Es bietet einen praxisorientierten Ansatz mit konkreten Umsetzungshinweisen.
Welche theoretischen Grundlagen liegen dem Konzept zugrunde?
Das Konzept basiert auf aktuellen Theorien der Schreibdidaktik und berücksichtigt Aspekte der Schreibmotivation und -kompetenz. Es wird Bezug genommen auf den Kernlehrplan Deutsch für die Hauptschule.
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Konzept am besten?
Schlüsselwörter sind: Schreibmotivation, Schreibkompetenz, Hauptschule, Erprobungsstufe, Lesetagebuch, kreatives Schreiben, freies Schreiben, Schreibwettbewerbe, Textüberarbeitung, Schreibdidaktik, Schülermotivation, Deutschunterricht, positive Schreibkultur.
- Arbeit zitieren
- Tina Brackmann (Autor:in), 2005, Konzept zur Förderung der Schreibmotivation und Schreibkompetenz in der Erprobungsstufe der Hauptschule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112890