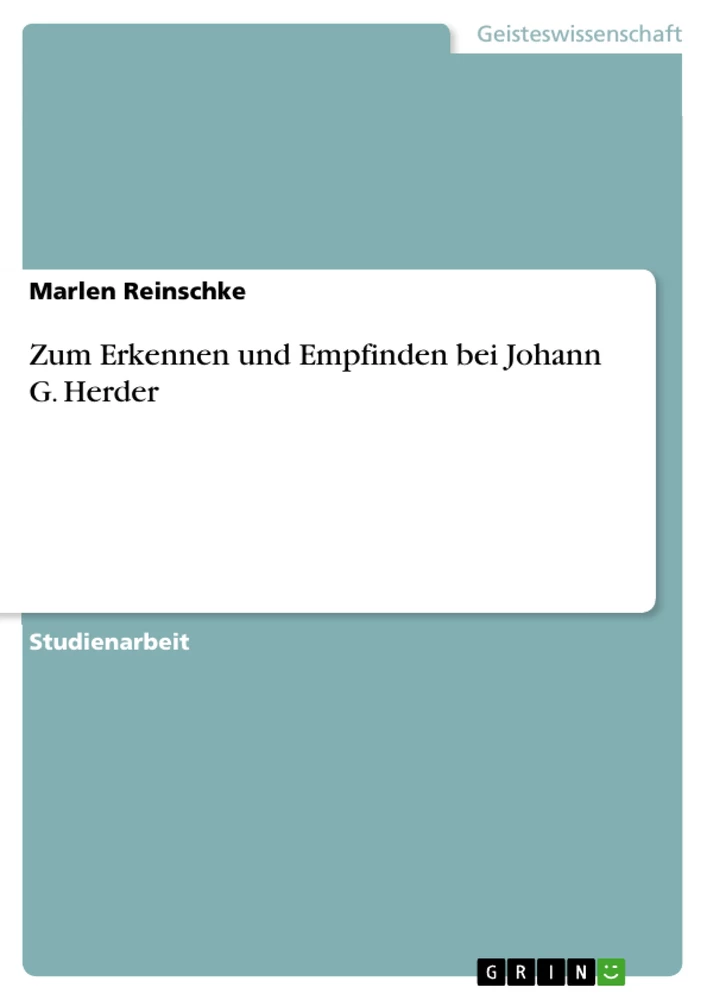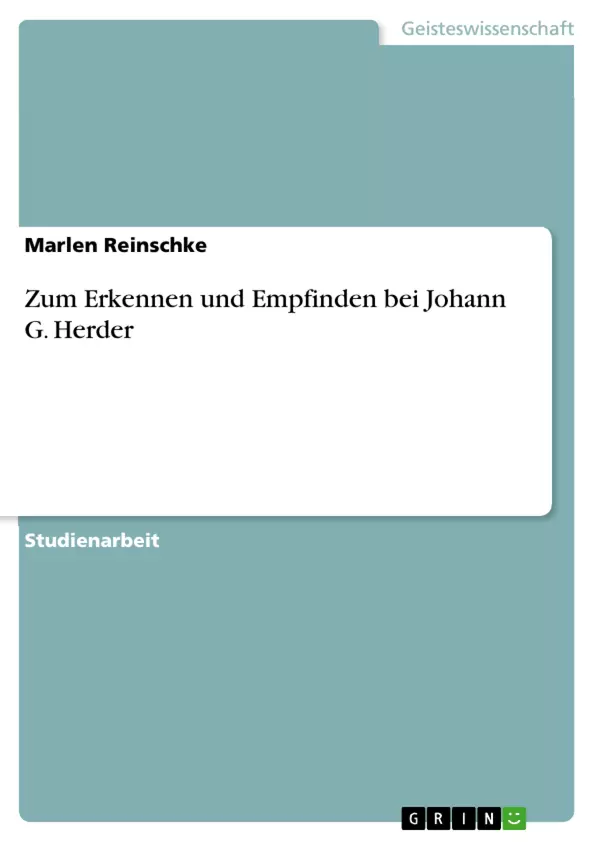Mitte des 18. Jahrhunderts verzeichneten Psychologie und Medizin enorme Fortschritte, die auch in der Philosophie zu einem gesteigerten Interesse an Untersuchungen zum menschlichen Seelenleben und seiner körperlichen Bedingtheit führen. Baumgarten gab den Anstoß zu kontroversen Debatten zum Verhältnis der Begriffe Empfinden und Erkennen untereinander und in Bezug auf Ästhetik. Auch Mendelssohn kontrastierte das Begriffspaar in seinen Briefen über die Empfindungen, in denen er die Gegensätzlichkeit beider Termini unterstrich. Die Berliner Akademie der Wissenschaften beteiligte sich
1773 und 1775 an diesem Diskurs mit einem Preisausschreiben, das Anlass für Herders Abhandlung Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele war. Inhaltlich orientierte sich die Preisfrage stark an den Hauptthesen J. G. Sulzers, Mitinitiator der Ausschreibung und Direktor der philosophischen Klasse der Akademie. Er forderte Untersuchungen zum Einfluss des Körpers auf die Seele; so bedarf es bei der Bestimmung von Erkennen und Empfinden auch der Bestimmung des Verhältnisses von Seele und Leib. Im Preisausschreiben der Berliner Akademie der Wissenschaften sollte eine ebensolche Verhältnisbestimmung der nach Sulzer voneinander getrennten Seelenkräfte des Erkennens und Empfindens vorgenommen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Mitte des 18. Jahrhunderts
- Zum Verständnis von Herders Schrift
- In seiner Beantwortung der Preisfrage
- Herder untersucht Empfinden und Erkennen
- Herder entwirft damit eine Theorie der reizinitiierten, gefühlsbasierten Welterschließung
- Dieses Dunkle differenziert Herder vom Hellen, der Erkenntnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Abhandlung "Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele" von Johann Gottfried Herder untersucht das Verhältnis von Empfinden und Erkennen im Kontext der Philosophie des 18. Jahrhunderts. Die Arbeit stellt sich der Herausforderung, die kontroverse Theorie von Johann Georg Sulzer über die Trennung von Empfinden und Erkennen zu hinterfragen und eine alternative, monistische Sichtweise zu entwickeln.
- Kritik an Sulzers Dualismus von Empfinden und Erkennen
- Herder's monistische Sichtweise auf die Einheit von Körper und Seele
- Die Rolle des Reizes und der Empfindung in der Erkenntnis
- Die Bedeutung von Analogieschlüssen und dem „geistigen Band“ in der Welterschließung
- Der Einfluss des Unbewussten auf die Erkenntnis
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel skizziert Sulzers Theorie der Trennung von Empfinden und Erkennen und beleuchtet die Hauptthesen seiner Abhandlung.
- Das zweite Kapitel beschreibt Herders Kritik an Sulzers Theorie und stellt seine eigene monistische Sichtweise auf die Einheit von Körper und Seele dar.
- Das dritte Kapitel beleuchtet Herders Theorie der reizinitiierten, gefühlsbasierten Welterschließung durch Analogieschlüsse und diskutiert die Bedeutung des Unbewussten in der Erkenntnis.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen Empfinden und Erkennen, insbesondere im Kontext der Philosophie des 18. Jahrhunderts. Sie untersucht die Theorien von Johann Georg Sulzer und Johann Gottfried Herder, wobei die Kritik am Dualismus von Körper und Seele, die Rolle des Reizes und der Empfindung in der Erkenntnis sowie die Bedeutung des Unbewussten im Erkenntnisprozess im Fokus stehen. Weitere wichtige Begriffe sind Analogieschlüsse, das „geistige Band“ und die Grenzen der menschlichen Erkenntnis.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Herders Abhandlung „Vom Erkennen und Empfinden“?
Herder untersucht das Verhältnis von Seele und Leib sowie die Verbindung von Empfindung und Erkenntnis. Die Schrift entstand als Antwort auf ein Preisausschreiben der Berliner Akademie der Wissenschaften.
Wie kritisiert Herder den Dualismus von Johann Georg Sulzer?
Herder lehnt die strikte Trennung von Empfinden und Erkennen ab. Er vertritt eine monistische Sichtweise, in der Körper und Seele eine Einheit bilden und Erkenntnis immer auf sinnlichen Reizen und Gefühlen basiert.
Was versteht Herder unter dem „geistigen Band“?
Das geistige Band ist die Kraft, die die verschiedenen sinnlichen Eindrücke und Reize verknüpft und so die Welterschließung durch Analogieschlüsse ermöglicht.
Welche Rolle spielt der „Reiz“ in seiner Theorie?
Der Reiz ist der Ausgangspunkt jeder Erkenntnis. Er initiiert Empfindungen, die wiederum die Grundlage für das Denken und das Verständnis der Welt bilden.
Welche Bedeutung hat das Unbewusste für Herder?
Herder differenziert zwischen „Dunklem“ (unbewussten Empfindungen) und „Hellem“ (bewusster Erkenntnis). Er betont, dass vieles in unserem Seelenleben im Verborgenen bleibt, aber dennoch unser Erkennen maßgeblich beeinflusst.
- Quote paper
- Marlen Reinschke (Author), 2020, Zum Erkennen und Empfinden bei Johann G. Herder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1128941