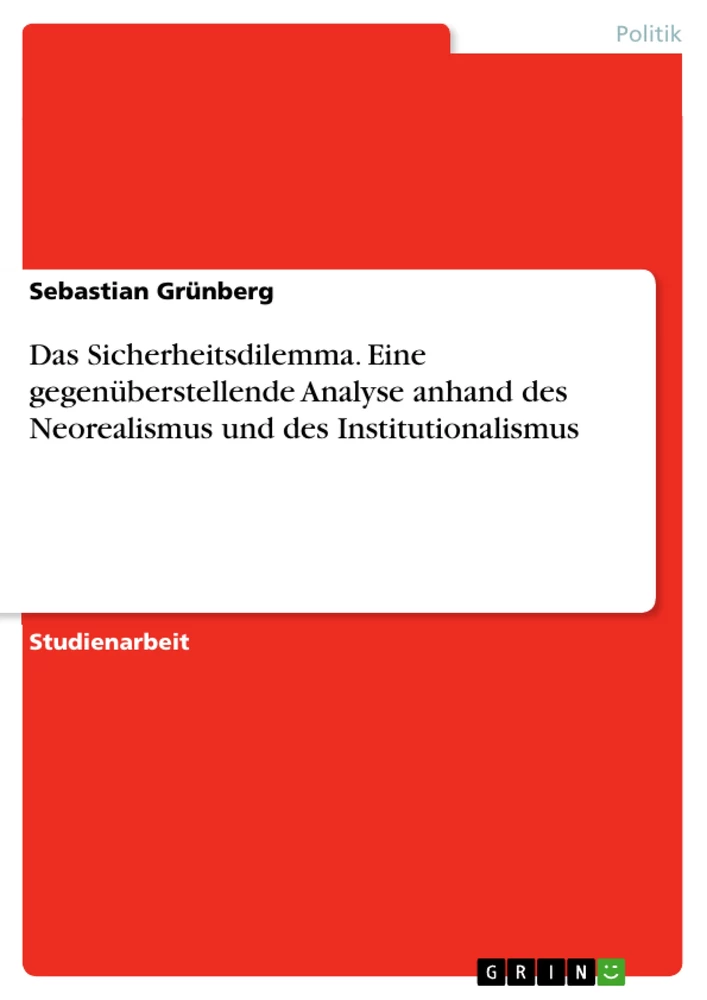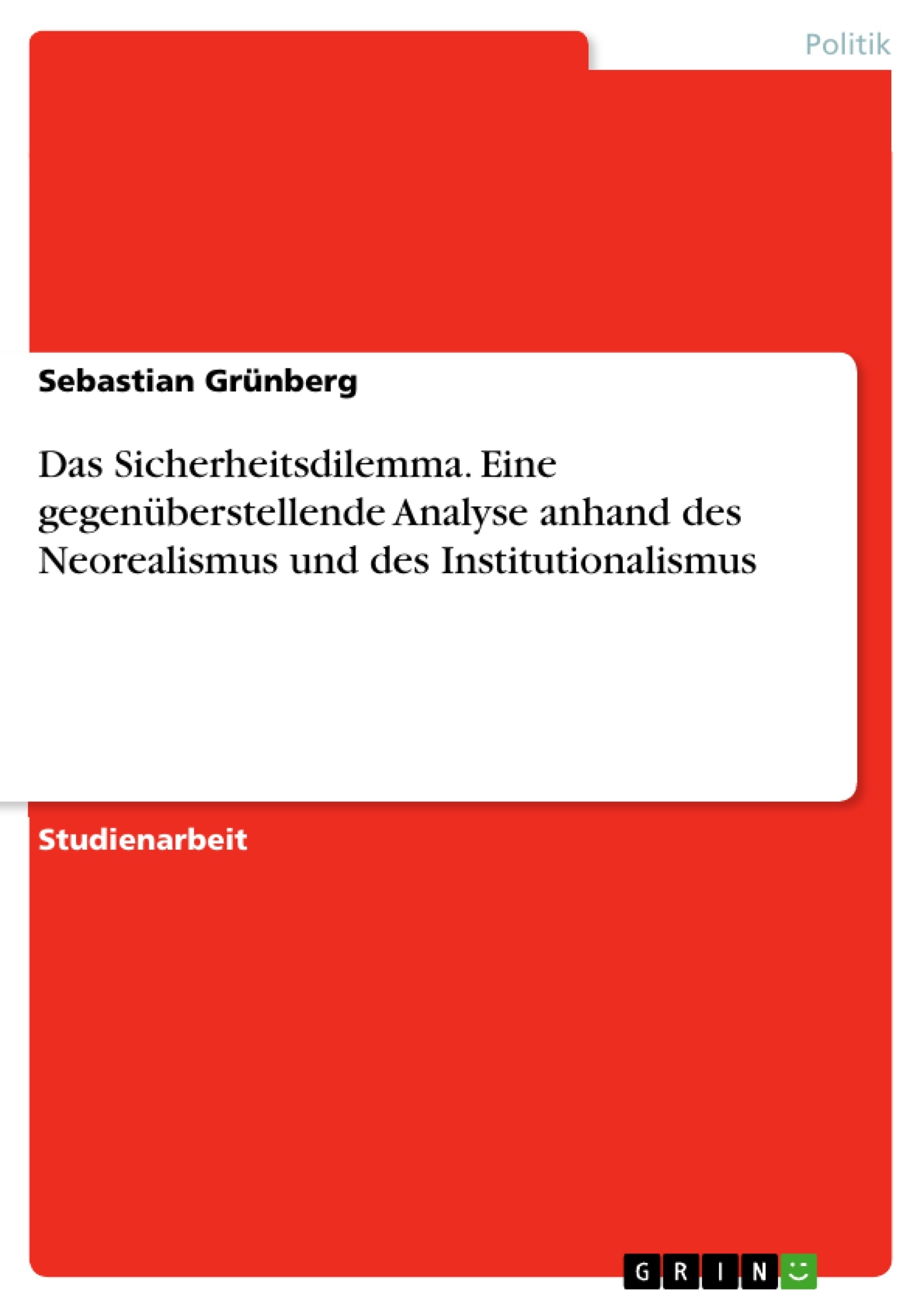Inwieweit kann aus Perspektive des Neorealismus und aus Perspektive des Institutionalismus unter den Bedingungen des Sicherheitsdilemmas ein Stabilitätszustand in den internationalen Beziehungen hergestellt werden?
Zur Beantwortung dieser Fragestellung wird zunächst das Sicherheitsdilemma nach John Herz definiert. Daraufhin werden die zwei Theorien der internationalen Beziehungen – zunächst der Neorealismus, gefolgt vom Institutionalismus – in ihren zentralen Annahmen und Aussagen dargestellt und jeweils in Beziehung zum Sicherheitsdilemma gesetzt. In einer abschließenden Zusammenfassung wird die Fragestellung mittels einer Gegenüberstellung der dargestellten Lösungsansätze einer Antwort aus der jeweiligen theoretischen Perspektive zugeführt.
In seinem Werk Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf., veröffentlicht in dem Jahr 1796, skizziert Immanuel Kant in Form von Präliminar- und Definitivartikeln die Grundlagen eines solchen ewigen Friedens, „der das Ende aller Hostilitäten bedeutet“ und nicht in sich selbst die Wurzeln für den nächsten Krieg trägt.
Im dritten Präliminarartikel appelliert Kant an die Staaten, stehende Heere gänzlich abzuschaffen:
„Denn sie bedrohen andere Staaten unaufhörlich mit Krieg, durch die Bereitschaft, immer dazu gerüstet zu erscheinen; reizen diese an, sich einander in Menge der Gerüsteten, die keine Grenzen kennt, zu übertreffen, und, indem durch die darauf verwandten Kosten der Friede endlich noch drückender wird als ein kurzer Krieg, so sind sie selbst Ursache von Angriffskriegen, um diese Last loszuwerden“.
Mit diesem Gedanken drückt Kant im Kern jenes Konzept aus, das durch John Herz 1950 unter dem Begriff des ‚Sicherheitsdilemmas‘ große Relevanz für Theorien internationaler Beziehungen zu gewinnen begann. Diese Frage nach dem ewigen Frieden – oder nach einer möglichen Lösung des Sicherheitsdilemmas, „with which human societies have had to grapple since the dawn of history“ – ist zentral für viele Theorien der internationalen Beziehungen, darunter der Neorealismus und der Institutionalismus. Ausgehend von ihren jeweiligen Standpunkten lassen sie jedoch sehr unterschiedliche Folgerungen und Einschätzungen bezüglich des Sicherheitsdilemmas zu.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Sicherheitsdilemma
- 3. Neorealismus
- 3.1 Wissenschaftstheoretische Annahmen
- 3.2 Die Kernannahmen des Neorealismus
- 3.3 Kooperation aus neorealistischer Perspektive
- 4. Institutionalismus
- 4.1 Wissenschaftstheoretische Annahmen
- 4.2 Die Kernannahmen des Neorealismus
- 4.3 Kooperation aus institutionalistischer Perspektive
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, inwieweit der Neorealismus und der Institutionalismus unter den Bedingungen des Sicherheitsdilemmas einen Stabilitätszustand in den internationalen Beziehungen herstellen können. Die Arbeit analysiert die jeweiligen theoretischen Ansätze und Lösungsvorschläge im Kontext des Sicherheitsdilemmas.
- Das Sicherheitsdilemma nach John Herz
- Wissenschaftstheoretische Annahmen des Neorealismus und Institutionalismus
- Kernannahmen des Neorealismus und ihre Relevanz für das Sicherheitsdilemma
- Kernannahmen des Institutionalismus und ihre Relevanz für das Sicherheitsdilemma
- Möglichkeiten der Kooperation aus neorealistischer und institutionalistischer Perspektive
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Sicherheitsdilemmas ein, ausgehend von Kants Werk „Zum ewigen Frieden“. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Möglichkeit eines Stabilitätszustands in den internationalen Beziehungen aus neorealistischer und institutionalistischer Perspektive. Die methodische Vorgehensweise, die Definition des Sicherheitsdilemmas und die anschließende Analyse der beiden Theorien werden umrissen.
2. Das Sicherheitsdilemma: Dieses Kapitel definiert das Sicherheitsdilemma nach John Herz. Es beschreibt den anarchischen Charakter des internationalen Systems und die daraus resultierende Unsicherheit der Staaten. Die rationale Machtakkumulation zur Sicherung der eigenen Sicherheit führt zu einem Teufelskreis, da diese Akkumulation von anderen Staaten als Bedrohung interpretiert wird, was zu weiterer Aufrüstung führt. Der Fokus liegt auf der selbstverstärkenden Dynamik des Sicherheitsdilemmas und der daraus resultierenden Machtkonkurrenz.
3. Neorealismus: Dieses Kapitel behandelt die wissenschaftstheoretischen Annahmen des Neorealismus nach Kenneth Waltz. Es beschreibt Waltz' drei Ebenen der Analyse (Individuum, Staat, Staatensystem) und argumentiert für eine systemische Analyse des internationalen Systems. Der Fokus liegt auf der Struktur des internationalen Systems als anarchisch und die daraus resultierenden Konsequenzen für das Verhalten der Staaten. Die Kernannahmen des Neorealismus werden im Kontext des Sicherheitsdilemmas diskutiert.
4. Institutionalismus: Dieses Kapitel präsentiert die wissenschaftstheoretischen Annahmen des Institutionalismus und setzt diese in Bezug zum Sicherheitsdilemma. Im Gegensatz zum Neorealismus werden hier die Möglichkeiten der Kooperation und die Rolle von Institutionen zur Bewältigung des Sicherheitsdilemmas untersucht. Die Kernannahmen des Institutionalismus werden beleuchtet und analysiert in Hinblick auf ihre Fähigkeit, das Sicherheitsdilemma zu mildern oder zu lösen.
Schlüsselwörter
Sicherheitsdilemma, Neorealismus, Institutionalismus, Internationale Beziehungen, Macht, Kooperation, Anarchie, Stabilität, Verteidigung, Aufrüstung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Sicherheitsdilemmas aus neorealistischer und institutionalistischer Perspektive
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, inwieweit der Neorealismus und der Institutionalismus unter den Bedingungen des Sicherheitsdilemmas einen Stabilitätszustand in den internationalen Beziehungen herstellen können. Sie analysiert die jeweiligen theoretischen Ansätze und Lösungsvorschläge im Kontext des Sicherheitsdilemmas nach John Herz.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Sicherheitsdilemma, die wissenschaftstheoretischen Annahmen des Neorealismus und Institutionalismus, die Kernannahmen beider Theorien und ihre Relevanz für das Sicherheitsdilemma, sowie die Möglichkeiten der Kooperation aus neorealistischer und institutionalistischer Perspektive. Die Analyse bezieht sich auf die Schriften von Kenneth Waltz (Neorealismus) und berücksichtigt die Rolle von Institutionen im Umgang mit dem Sicherheitsdilemma.
Welche Theorien werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht den Neorealismus und den Institutionalismus. Es werden die jeweiligen wissenschaftstheoretischen Annahmen und Kernannahmen beider Theorien im Detail dargestellt und hinsichtlich ihrer Erklärungskraft für das Sicherheitsdilemma bewertet. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Perspektiven bezüglich Kooperation und der Möglichkeit, das Sicherheitsdilemma zu überwinden oder abzumildern.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Das Sicherheitsdilemma, Neorealismus (inkl. wissenschaftstheoretische Annahmen, Kernannahmen und Kooperationsperspektive), Institutionalismus (inkl. wissenschaftstheoretische Annahmen, Kernannahmen und Kooperationsperspektive) und Fazit. Jedes Kapitel fasst die wesentlichen Aspekte des jeweiligen Themas zusammen.
Was ist das Sicherheitsdilemma nach John Herz?
Das Sicherheitsdilemma beschreibt den anarchischen Charakter des internationalen Systems und die daraus resultierende Unsicherheit der Staaten. Rationale Machtakkumulation zur Selbstsicherung führt zu einem Teufelskreis, da diese von anderen als Bedrohung wahrgenommen wird, was zu weiterer Aufrüstung führt. Es entsteht eine selbstverstärkende Dynamik der Machtkonkurrenz.
Welche Rolle spielen Institutionen im Kontext des Sicherheitsdilemmas?
Der Institutionalismus untersucht im Gegensatz zum Neorealismus die Möglichkeiten der Kooperation und die Rolle von Institutionen zur Bewältigung des Sicherheitsdilemmas. Institutionen werden als Mittel gesehen, um das Sicherheitsdilemma abzumildern oder zu lösen, indem sie Kooperation ermöglichen und Vertrauen zwischen Staaten aufbauen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sicherheitsdilemma, Neorealismus, Institutionalismus, Internationale Beziehungen, Macht, Kooperation, Anarchie, Stabilität, Verteidigung, Aufrüstung.
Wie wird die methodische Vorgehensweise beschrieben?
Die Einleitung beschreibt die methodische Vorgehensweise, die Definition des Sicherheitsdilemmas und die anschließende Analyse der beiden Theorien (Neorealismus und Institutionalismus). Es wird eine systematische Untersuchung der theoretischen Ansätze und ihrer Anwendung auf das Sicherheitsdilemma durchgeführt.
Welche Schlussfolgerung wird gezogen?
Das Fazit (Kapitel 5) fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und gibt eine abschließende Bewertung der Möglichkeiten, einen Stabilitätszustand in den internationalen Beziehungen unter Berücksichtigung des Sicherheitsdilemmas zu erreichen. Die jeweiligen Stärken und Schwächen des Neorealismus und des Institutionalismus werden im Kontext des Sicherheitsdilemmas gewürdigt.
- Quote paper
- Sebastian Grünberg (Author), 2020, Das Sicherheitsdilemma. Eine gegenüberstellende Analyse anhand des Neorealismus und des Institutionalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1128968