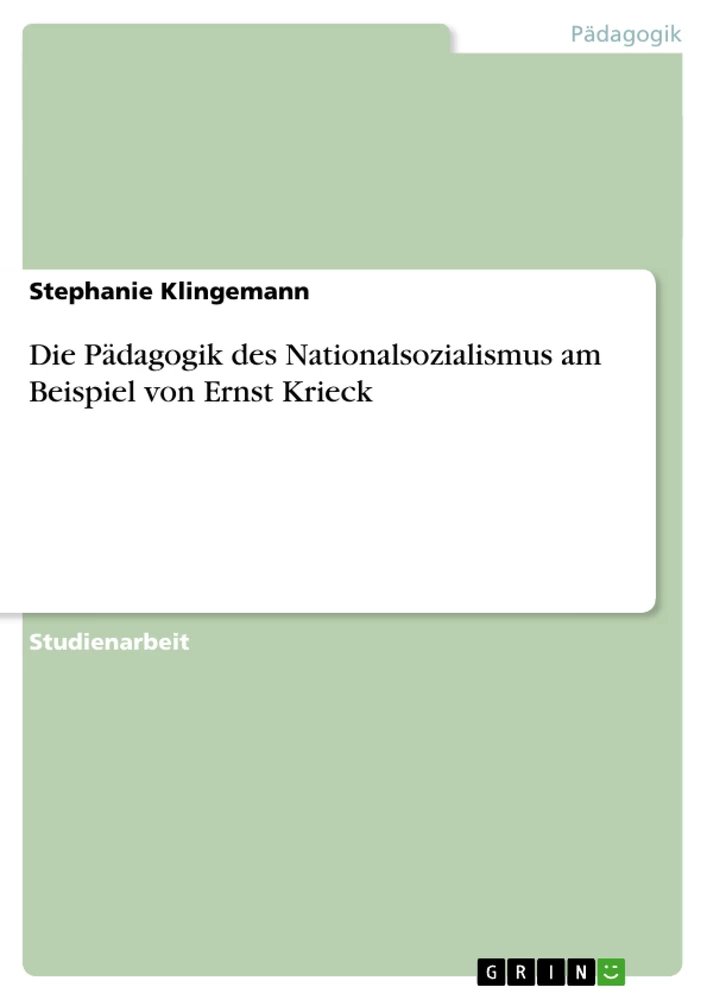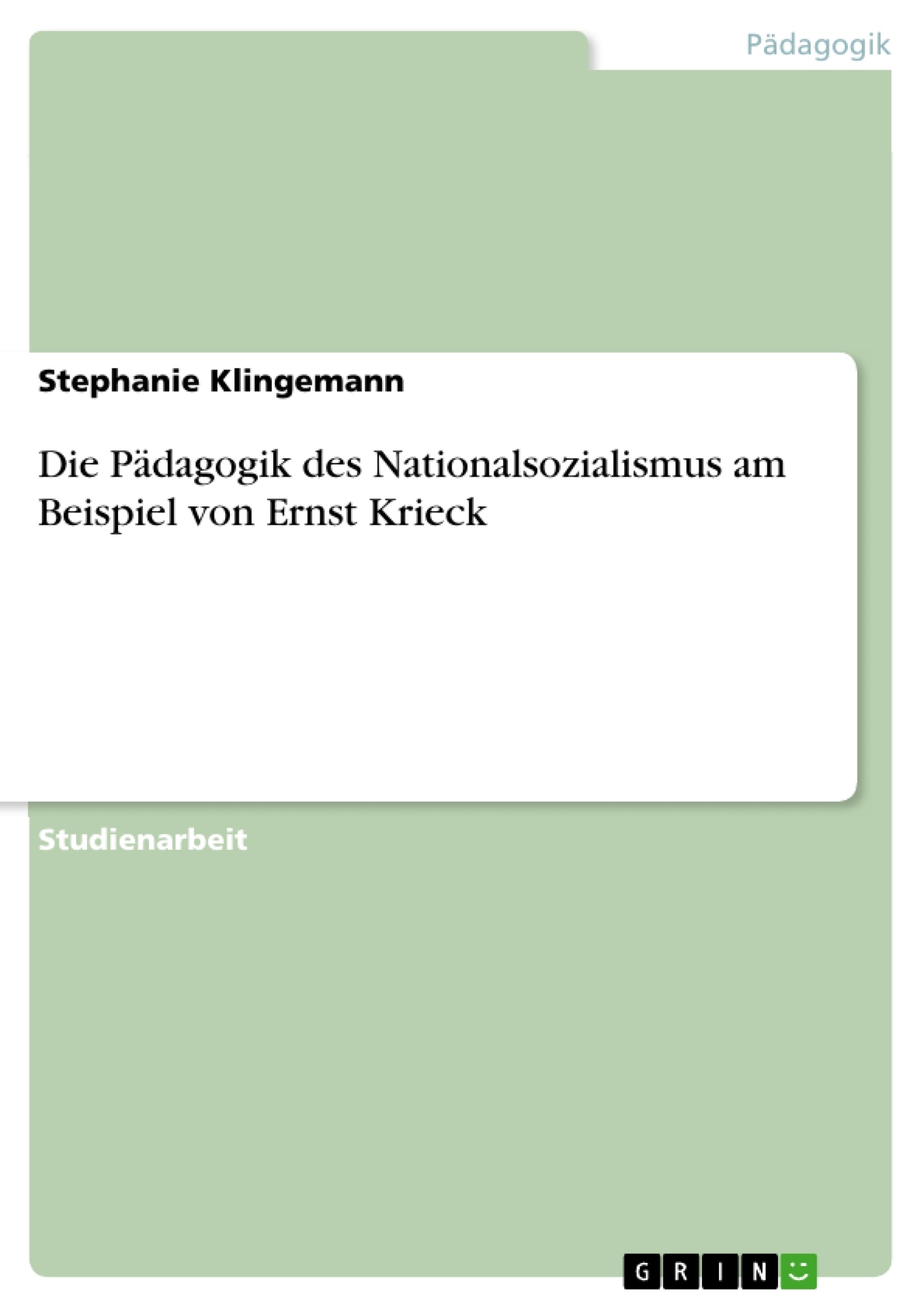In dieser Hausarbeit beschäftigen wir uns mit dem Erziehungsprogramm des Nationalsozialismus unter besonderer Berücksichtigung von Ernst Kriecks Erziehungsmodell.
Eine weitere Grundlage bieten uns Franzjörg Baumgarts Erläuterungen in seinem Buch „Erziehungs- und Bildungstheorien“.
Wir haben Ernst Krieck als Repräsentanten der nationalsozialistischen Erziehungswissenschaft ausgewählt, weil er einer der führenden Ideologen der Pädagogik im Dritten Reich war und wir aufgrund der Fülle der Materialien exemplarisch die Grundelemente der damaligen Pädagogik erläutern wollen.
Dabei geht es uns zunächst um die nationalsozialistische Weltanschauung und wie diese in dem Erziehungsmodell von Ernst Krieck zum Ausdruck kommt. Ferner möchten wir in kurzer Form darlegen, wie Krieck die funktionale und intentionale Erziehung verschieden gewichtet und wie sich dies im Alltagsleben der Kinder und Jugendlichen bemerkbar gemacht hat.
Hierbei konzentrieren wir uns auf die Hitlerjugend, den Minderheiten widmen wir nur ein kurzes Kapitel, da der Umfang dieser Hausarbeit es uns nicht ermöglicht, diese Verbrechen angemessen zu werten.
Mit der Frage, wie die Neugestaltung in der Erziehungswissenschaft nach 1945 vonstatten gegangen ist, beschäftigen wir uns in Kapitel V, bevor wir im letzten Kapitel die Diskussion in der heutigen Zeit bearbeiten, ob die Pädagogik des Nationalsozialismus in der erziehungswissenschaftlichen Tradition steht oder aber, ob sie einen Bruch mit ihr darstellt.
Wir möchten darauf hinweisen, dass wir uns bewusst sind, mit diesem Thema nicht angemessen genug umgehen zu können. Wir hoffen, dass es uns mit dieser Hausarbeit gelingt, Analyse und Kritik voneinander zu trennen, da es gerade vor dem Hintergrund des wahrscheinlich größten Menschheitsverbrechen schwer fällt, nicht schnell in eine Wertung zu verfallen.
2 Erziehung im Nationalsozialismus
"Meine Pädagogik ist hart", so formulierte Hitler seine Erziehungsideale, "Das Schwache muss weggehämmert werden. Es wird eine Jugend heranwachsen, vor der sich die Welt erschrecken wird. Eine gewalttätige, herrische, unerschrockene, grausame Jugend will ich ..."
Damit diese Pädagogik Erfolg haben sollte, wurden die Kindheit und die Jugend unter Hitler durchorganisiert und die Kinder von klein auf für den Kampf und für den Krieg erzogen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Erziehung im Nationalsozialismus
- Ernst Krieck und sein Erziehungsmodell
- Ernst Krieck und die nationalsozialistische Weltanschauung
- Die Rasse im Zentrum der Lehre Kriecks
- Das völkische Modell - Zucht und Auslese
- Ganzheit des Volkes
- Funktionalität der Erziehung
- Gewichtung von funktionaler und intentionaler Erziehung
- Das Drei-Schichten-Modell
- „... und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben!“ - Organisation der Kinder und Jugendlichen im Dritten Reich
- Die Hitlerjugend
- Gründung und Anfänge
- Aufgaben und Erziehung in der HJ
- Die Hitlerjugend im Zweiten Weltkrieg
- Auslese an den Schulen – Umgang mit Minderheiten
- Vergleich mit Ernst Kriecks Erziehungsmodell
- Nach 1945 Reeducation
- War die nationalsozialistische Erziehung eine Pädagogik – oder doch eine „Un-Pädagogik“?
- „Un-Pädagogik“
- Fortführung statt Bruch
- Kontinuität und Kritik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Erziehungsprogramm des Nationalsozialismus, fokussiert auf Ernst Kriecks Erziehungsmodell und Franzjörg Baumgarts Analyse in „Erziehungs- und Bildungstheorien“. Ziel ist die Darstellung der nationalsozialistischen Weltanschauung in Kriecks Modell, die Gewichtung funktionaler und intentionaler Erziehung, sowie deren Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Die Rolle der Hitlerjugend wird beleuchtet, während der Umgang mit Minderheiten nur kurz skizziert wird. Schließlich wird die Frage nach der Kontinuität oder dem Bruch der nationalsozialistischen Pädagogik mit der erziehungswissenschaftlichen Tradition diskutiert.
- Ernst Kriecks Erziehungsmodell im Kontext der nationalsozialistischen Ideologie
- Funktionalität und Intentionale Erziehung im Nationalsozialismus
- Die Rolle der Hitlerjugend und die Organisation der Jugend im Dritten Reich
- Der Umgang mit Minderheiten im nationalsozialistischen Erziehungssystem
- Kontinuität und Bruch der nationalsozialistischen Pädagogik nach 1945
Zusammenfassung der Kapitel
Erziehung im Nationalsozialismus: Dieses Kapitel beschreibt die durchorganisierte Erziehung im Nationalsozialismus, die darauf zielte, Hitlers Weltanschauung durchzusetzen. Es nutzte neben pädagogischen Institutionen auch Propaganda. Das Ziel war ein „neuer politischer Mensch“, weniger rational und intellektuell, dafür emotional und rassisch gesund. Nach 1933 gab es Unsicherheit in der Erziehungswissenschaft, wobei viele „Kathederpädagogen“ kaum Widerstand leisteten. Wortführer der neuen Bewegung waren u.a. Rosenberg, Sturm, Kade, Baeumler und Krieck. Ein Hauptziel war die Bekämpfung der „Überfremdung“, was zu rassistischer Selektion führte, beispielsweise durch die Aufhebung der Gleichstellung jüdischer und Sinti- und Roma-Kinder und die Entlassung jüdischer Professoren und Lehrer. Die nationalsozialistischen Erziehungstheorien, die es bereits vor 1933 gab (z.B. Kriecks „Menschenformung“), konnten sich so durchsetzen.
Ernst Krieck und sein Erziehungsmodell: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Ernst Kriecks Erziehungstheorien. Krieck, ab 1934 Professor in Heidelberg, betonte die Funktionalität der Erziehung, mit der völkischen Lebensgemeinschaft und erbbiologischer Orientierung als Hauptanliegen. Dieses Gedankengut war nicht neu; bereits vor den Nationalsozialisten, insbesondere nach 1918, fanden sich völkisch-rassistische Tendenzen bei einigen Reformpädagogen. Der gemeinsame Nenner war ein Ressentiment gegen die moderne liberale Gesellschaft. Allerdings unterschieden sich Reformpädagogik und nationalsozialistische Pädagogik deutlich. Elemente wie kindgemäße Erziehung und die Autonomie der Pädagogik gegenüber Politik wurden von den Nationalsozialisten bekämpft. Krieck und andere Pädagogen spitzten den völkischen Charakter der Erziehung zu.
„... und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben!“ - Organisation der Kinder und Jugendlichen im Dritten Reich: Dieses Kapitel befasst sich mit der Organisation der Kinder und Jugendlichen im Dritten Reich, vor allem mit der Hitlerjugend (HJ). Die HJ spielte eine zentrale Rolle bei der Indoktrination und Erziehung der Jugend nach nationalsozialistischen Prinzipien. Die Kapitel behandeln die Gründung und Anfänge der HJ, ihre Aufgaben und die Erziehung innerhalb der Organisation sowie ihre Rolle während des Zweiten Weltkriegs. Darüber hinaus wird der Umgang mit Minderheiten an Schulen und die Auslese im Bildungssystem betrachtet und im Kontext mit Kriecks Erziehungsmodell verglichen.
War die nationalsozialistische Erziehung eine Pädagogik – oder doch eine „Un-Pädagogik“?: Dieses Kapitel diskutiert, ob die nationalsozialistische Erziehung als Pädagogik oder „Un-Pädagogik“ zu bezeichnen ist. Es wird der Versuch unternommen die Kontroverse um die Einordnung der nationalsozialistischen Erziehung in die erziehungswissenschaftliche Tradition zu beleuchten. Es werden Argumente für und gegen die Bezeichnung als „Un-Pädagogik“ erörtert und der Versuch einer differenzierten Betrachtung unternommen. Aspekte der Kontinuität und der Kritik an diesem Erziehungssystem werden umfassend analysiert.
Schlüsselwörter
Nationalsozialismus, Erziehung, Ernst Krieck, Hitlerjugend, völkische Gemeinschaft, Rasse, Funktionalität, Intentionale Erziehung, Reformpädagogik, Reeducation, „Un-Pädagogik“, Kontinuität, Kritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Erziehung im Nationalsozialismus
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Erziehung im Nationalsozialismus. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf Ernst Kriecks Erziehungsmodell und seiner Rolle im nationalsozialistischen System, sowie der Organisation der Kinder und Jugendlichen im Dritten Reich, insbesondere der Hitlerjugend. Es wird auch die Frage diskutiert, ob die nationalsozialistische Erziehung als Pädagogik oder „Un-Pädagogik“ zu bezeichnen ist und welche Kontinuitäten und Brüche nach 1945 bestanden.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Hauptthemen: Ernst Kriecks Erziehungsmodell und seine nationalsozialistische Weltanschauung; die Funktionalität und intentionale Erziehung im Nationalsozialismus; die Rolle der Hitlerjugend und die Organisation der Jugend im Dritten Reich; der Umgang mit Minderheiten im nationalsozialistischen Erziehungssystem; Kontinuität und Bruch der nationalsozialistischen Pädagogik nach 1945; die Frage nach der Einordnung der nationalsozialistischen Erziehung als Pädagogik oder „Un-Pädagogik“.
Wer war Ernst Krieck und welche Rolle spielte er?
Ernst Krieck war ein wichtiger Vertreter der nationalsozialistischen Erziehungstheorie. Das Dokument analysiert sein Erziehungsmodell, das die völkische Lebensgemeinschaft und erbbiologische Orientierung in den Mittelpunkt stellte. Kriecks Denken wird im Kontext der nationalsozialistischen Ideologie und im Vergleich zu anderen Strömungen der damaligen Pädagogik betrachtet.
Welche Rolle spielte die Hitlerjugend?
Die Hitlerjugend (HJ) spielte eine zentrale Rolle bei der Indoktrination und Erziehung der Jugend im Dritten Reich. Das Dokument beschreibt die Gründung, Aufgaben und Erziehung innerhalb der HJ sowie ihre Rolle während des Zweiten Weltkriegs. Der Einfluss der HJ auf die Jugend im Kontext der nationalsozialistischen Erziehung wird ausführlich behandelt.
Wie wurde mit Minderheiten im nationalsozialistischen Erziehungssystem umgegangen?
Das Dokument skizziert den Umgang mit Minderheiten im nationalsozialistischen Erziehungssystem. Es thematisiert die rassistische Selektion, die Entlassung jüdischer Professoren und Lehrer und die Aufhebung der Gleichstellung jüdischer und Sinti- und Roma-Kinder. Dieser Aspekt wird zwar nur kurz behandelt, aber in Bezug auf die Gesamtkonzeption der nationalsozialistischen Erziehung betrachtet.
Ist die nationalsozialistische Erziehung als Pädagogik oder „Un-Pädagogik“ zu bezeichnen?
Das Dokument diskutiert intensiv die Frage, ob die nationalsozialistische Erziehung als Pädagogik oder „Un-Pädagogik“ einzustufen ist. Es werden Argumente für beide Seiten präsentiert und eine differenzierte Betrachtung der Kontroverse angestrebt. Die Analyse der Kontinuitäten und Brüche mit der erziehungswissenschaftlichen Tradition nach 1945 bildet einen wichtigen Bestandteil dieser Diskussion.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument umfasst Kapitel zu folgenden Themen: Vorwort; Erziehung im Nationalsozialismus; Ernst Krieck und sein Erziehungsmodell; „... und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben!“ - Organisation der Kinder und Jugendlichen im Dritten Reich; Nach 1945 Reeducation; War die nationalsozialistische Erziehung eine Pädagogik – oder doch eine „Un-Pädagogik“?; Fazit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter, die den Inhalt des Dokuments charakterisieren, sind: Nationalsozialismus, Erziehung, Ernst Krieck, Hitlerjugend, völkische Gemeinschaft, Rasse, Funktionalität, Intentionale Erziehung, Reformpädagogik, Reeducation, „Un-Pädagogik“, Kontinuität, Kritik.
- Quote paper
- Stephanie Klingemann (Author), 2006, Die Pädagogik des Nationalsozialismus am Beispiel von Ernst Krieck, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112901