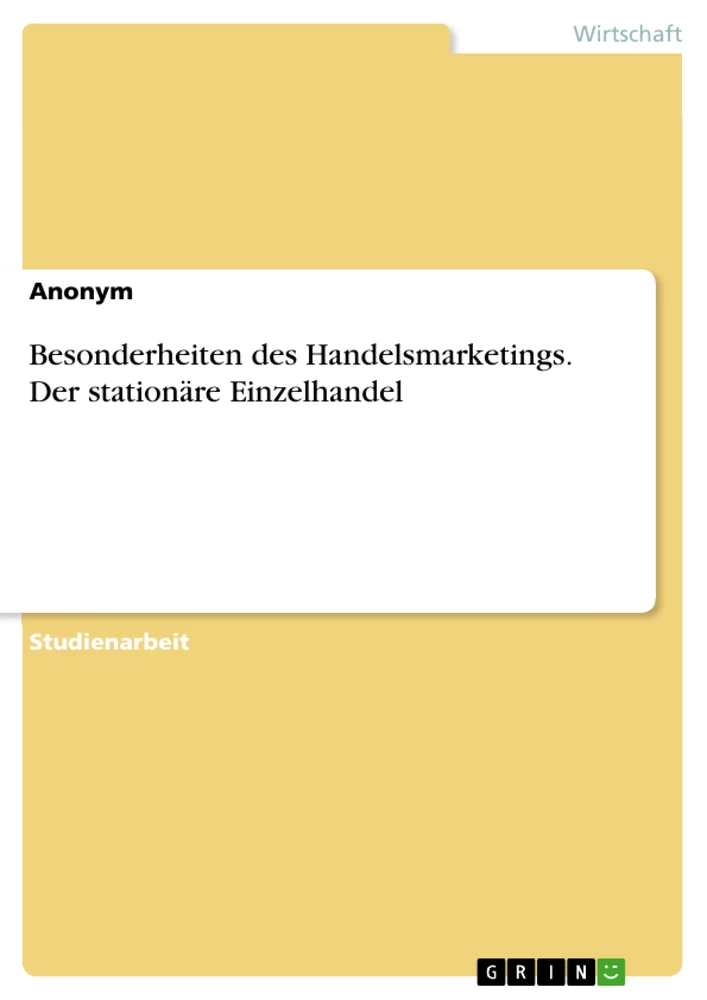Diese Hausarbeit zielt darauf ab, die Bedeutung der Verkaufsförderung im Rahmen des Marketing-Mix darzustellen und praxisnah zu veranschaulichen.
Zunächst werden in Kapitel zwei die allgemeinen Definitionen erläutert und in das Thema des Einzelhandels eingeführt. Außerdem wird folgende Forschungsfrage thematisiert: Warum ist der stationäre Einzelhandel trotz Boom des Onlinehandels immer noch so beliebt? In Kapitel drei wird näher auf die Besonderheiten des Handelsmarketings eingegangen und in Kapitel vier diese Thematik an regionalen Einzelhändlern genauer untersucht. Die Arbeit endet mit einem abschließenden Fazit.
Aufgrund der Fülle an Informationen und Bereichen des Handelsmarketings wird sich diese wissenschaftliche Arbeit auf die Thematik des stationären Einzelhandels beschränken und die vorher aufgeführten Fragen auf diese Materie abgrenzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen des Handelsmarketing
- Definition und Bedeutung
- Betriebsformen im Handel
- Vor- und Nachteile des stationären Einzelhandels
- Besonderheiten des Handelsmarketings
- Standortwahl
- Preiswettbewerb und Rabattaktionen
- Verkaufsraumgestaltung und Sortimentspolitik
- Dienstleistungsgestaltung
- Handelsmarken
- Absatzwerbung
- Online-Vertrieb
- Besonderheiten des Handelsmarketings an Praxisbeispielen
- Douglas in Jena (Goethe Galerie)
- Globus in Hermsdorf
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Bedeutung der Verkaufsförderung im Rahmen des Marketing-Mix und dessen Veranschaulichung anhand praktischer Beispiele. Die Arbeit analysiert, warum der stationäre Einzelhandel trotz des Online-Handels-Booms weiterhin beliebt ist. Darüber hinaus werden die Besonderheiten des Handelsmarketings beleuchtet, einschließlich Standortwahl, Preisstrategien, Verkaufsraumgestaltung, Dienstleistungen, Handelsmarken, Absatzwerbung und Online-Vertrieb.
- Die Bedeutung von Verkaufsförderung im Marketing-Mix
- Die Attraktivität des stationären Einzelhandels trotz des Online-Handels
- Besonderheiten des Handelsmarketings
- Praxisbeispiele aus dem stationären Einzelhandel
- Zusammenfassung der Erkenntnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 führt zunächst in die allgemeinen Definitionen des Handelsmarketing ein. Es wird erläutert, warum der stationäre Einzelhandel trotz des wachsenden Online-Handels seine Relevanz behält. Kapitel 3 untersucht die Besonderheiten des Handelsmarketings im Detail, einschließlich der Faktoren, die zur erfolgreichen Gestaltung des stationären Handels beitragen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen des Handelsmarketings, des stationären Einzelhandels, der Verkaufsförderung im Marketing-Mix, der Wettbewerbsvorteile des stationären Handels gegenüber dem Online-Handel und die besonderen Herausforderungen und Chancen des stationären Einzelhandels in der heutigen Zeit.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Besonderheiten des Handelsmarketings. Der stationäre Einzelhandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1129146