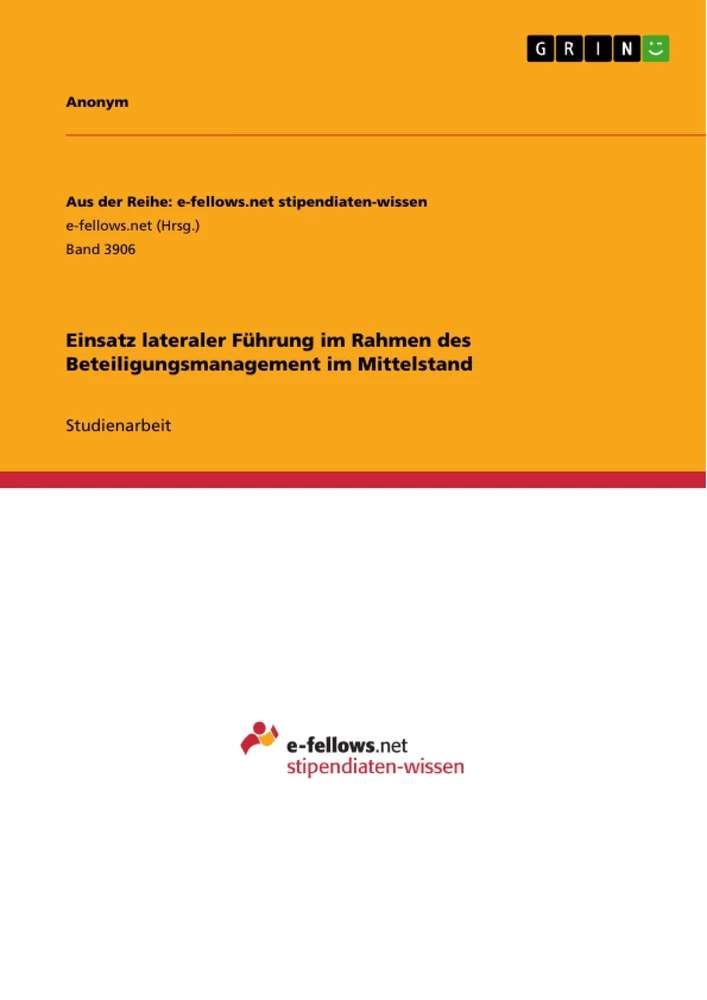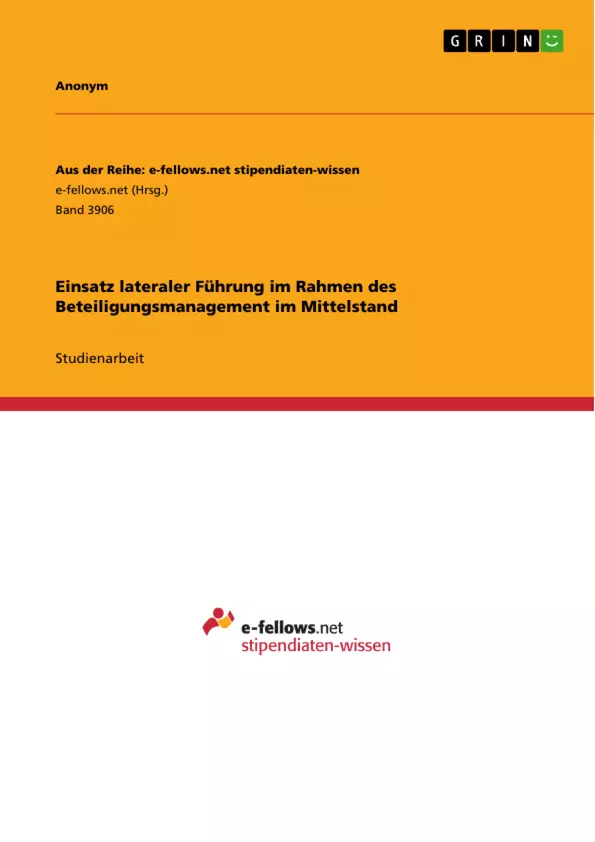Das Ziel der vorliegenden Seminararbeit ist es, die Möglichkeiten und Grenzen der lateralen Führung im Rahmen des Beteiligungsmanagements von mittelständischen Unternehmen aufzuzeigen.
Die Zusammenarbeit in Unternehmen in einer globalisierten Welt geht mit einer steigenden Komplexität und Intensivierung der Dynamik einher. Die Digitalisierung verschärft die Rollen von Mitarbeitern und Vorgesetzten weiter und der Anteil von Aufgaben jenseits von Hierarchien (bspw. Teamleitung, Projektmanagement, Change Management) innerhalb von Organisationen nimmt stetig zu. Aber auch in der Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen hinweg (bspw. Joint-Ventures, Kooperationen, Supply-Chain, Beteiligungsmanagement) sind neue Führungsansätze gefragt, die sich nicht (ausschließlich) auf eine Hierarchie stützen. So wurde Ende der 2000er Jahren von den Soziologen und Organisationsberatern Kühl und Schnelle das Konzept der lateralen Führung entwickelt, dessen Anwendung anhand des Beteiligungsmanagements von mittelständischen Unternehmen betrachtet werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung zum Thema und Zielsetzung der Arbeit
- Die Laterale Führung
- Definition und Abgrenzung lateraler zu klassischer Führung
- Säulen der lateralen Führung und deren Zusammenspiel
- Notwendigkeit der Rückbindung an Formalstruktur
- Beispiele für Laterale Führung in der Praxis
- Beteiligungsmanagement im Mittelstand
- Beteiligungsmanagement und Lebenszyklus Beteiligung
- Rollen im Rahmen des Beteiligungsmanagements
- Besonderheiten Beteiligungsmanagement im Mittelstand
- Laterale Führung im Beteiligungsmanagement
- Warum ist Beteiligungsmanagement Laterale Führung?
- Ausprägung der drei Säulen im Beteiligungsmanagement
- Schaffung Formaler Strukturen und Macht arrangieren
- Verständnis herstellen und Kommunikation verbessern
- Vertrauen erzeugen und erhalten
- Erkenntnisse der Seminararbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Anwendung lateraler Führung im Beteiligungsmanagement mittelständischer Unternehmen. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Grenzen dieses Führungsansatzes aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert die spezifischen Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Kombination von lateralen Führungsmethoden und den Besonderheiten des Beteiligungsmanagements im Mittelstand ergeben.
- Laterale Führung: Definition, Abgrenzung zur klassischen Führung und die drei Säulen (Verständigung, Macht, Vertrauen).
- Beteiligungsmanagement im Mittelstand: Lebenszyklus von Beteiligungen und spezifische Herausforderungen.
- Integration lateraler Führung in das Beteiligungsmanagement: Analyse der Anwendung der drei Säulen im Kontext von Beteiligungen.
- Möglichkeiten und Grenzen lateraler Führung im Beteiligungsmanagement.
- Praktische Beispiele für die Anwendung lateraler Führung im Beteiligungsmanagement.
Zusammenfassung der Kapitel
Hinführung zum Thema und Zielsetzung der Arbeit: Die Arbeit untersucht die Anwendung des Konzepts der lateralen Führung im Beteiligungsmanagement mittelständischer Unternehmen vor dem Hintergrund steigender Komplexität und Dynamik in der Zusammenarbeit. Das Ziel ist, die Möglichkeiten und Grenzen dieses Ansatzes aufzuzeigen.
Die Laterale Führung: Dieses Kapitel definiert laterale Führung als Führung auf Augenhöhe ohne formale Weisungsbefugnis und beschreibt die drei zentralen Säulen: Verständigung, Macht und Vertrauen. Es grenzt laterale Führung von klassischer hierarchischer Führung ab und betont die Notwendigkeit der Rückbindung an die Formalstruktur des Unternehmens. Praktische Beispiele für den Einsatz lateraler Führung in verschiedenen Kontexten werden angeführt.
Beteiligungsmanagement im Mittelstand: Der Abschnitt beschreibt Beteiligungsmanagement als die Zusammenfassung aller strategischen, operativen und administrativen Aufgaben im Umgang mit Unternehmensbeteiligungen. Er behandelt den Lebenszyklus von Beteiligungen und die spezifischen Rollen im Beteiligungsmanagement, wobei die Besonderheiten im Mittelstand hervorgehoben werden.
Laterale Führung im Beteiligungsmanagement: Dieses Kapitel analysiert, warum laterale Führung im Beteiligungsmanagement besonders relevant ist und wie die drei Säulen – Verständigung, Macht und Vertrauen – konkret in diesem Kontext angewendet werden können. Es untersucht die Ausprägung dieser Säulen und ihre Interaktion im Rahmen des Beteiligungsmanagements.
Schlüsselwörter
Laterale Führung, Beteiligungsmanagement, Mittelstand, Führung auf Augenhöhe, Verständigung, Macht, Vertrauen, Hierarchie, Kooperationen, Lebenszyklus, Unternehmenszusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Laterale Führung im Beteiligungsmanagement des Mittelstands
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Anwendung lateraler Führung im Beteiligungsmanagement mittelständischer Unternehmen. Sie analysiert die Möglichkeiten und Grenzen dieses Führungsansatzes und beleuchtet die spezifischen Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Kombination von lateralen Führungsmethoden und den Besonderheiten des Beteiligungsmanagements im Mittelstand ergeben.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung lateraler Führung zur klassischen Führung, die drei Säulen der lateralen Führung (Verständigung, Macht, Vertrauen), Beteiligungsmanagement im Mittelstand inklusive Lebenszyklus und spezifischer Herausforderungen, die Integration lateraler Führung in das Beteiligungsmanagement, die Ausprägung der drei Säulen im Kontext von Beteiligungen, sowie Möglichkeiten und Grenzen der lateralen Führung im Beteiligungsmanagement und praktische Beispiele für deren Anwendung.
Was versteht die Arbeit unter lateraler Führung?
Die Arbeit definiert laterale Führung als Führung auf Augenhöhe ohne formale Weisungsbefugnis. Sie beschreibt die drei zentralen Säulen: Verständigung, Macht und Vertrauen und grenzt sie von klassischer hierarchischer Führung ab. Die Notwendigkeit der Rückbindung an die Formalstruktur des Unternehmens wird betont.
Wie wird Beteiligungsmanagement im Mittelstand beschrieben?
Beteiligungsmanagement wird als die Zusammenfassung aller strategischen, operativen und administrativen Aufgaben im Umgang mit Unternehmensbeteiligungen beschrieben. Der Lebenszyklus von Beteiligungen und die spezifischen Rollen im Beteiligungsmanagement werden behandelt, wobei die Besonderheiten im Mittelstand hervorgehoben werden.
Warum ist laterale Führung im Beteiligungsmanagement relevant?
Die Arbeit analysiert die Relevanz lateraler Führung im Beteiligungsmanagement und zeigt, wie die drei Säulen – Verständigung, Macht und Vertrauen – konkret in diesem Kontext angewendet werden können. Die Ausprägung dieser Säulen und ihre Interaktion im Rahmen des Beteiligungsmanagements werden untersucht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Laterale Führung, Beteiligungsmanagement, Mittelstand, Führung auf Augenhöhe, Verständigung, Macht, Vertrauen, Hierarchie, Kooperationen, Lebenszyklus, Unternehmenszusammenarbeit.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit beinhaltet Kapitel zur Hinführung zum Thema und Zielsetzung, zur lateralen Führung, zum Beteiligungsmanagement im Mittelstand, zur lateralen Führung im Beteiligungsmanagement und abschließend zu den Erkenntnissen der Seminararbeit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit den jeweiligen Aspekten.
Was ist die Zielsetzung der Seminararbeit?
Die Zielsetzung der Seminararbeit ist es, die Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung lateraler Führung im Beteiligungsmanagement mittelständischer Unternehmen aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert die spezifischen Herausforderungen und Chancen, die sich aus dieser Kombination ergeben.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Einsatz lateraler Führung im Rahmen des Beteiligungsmanagement im Mittelstand, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1129336