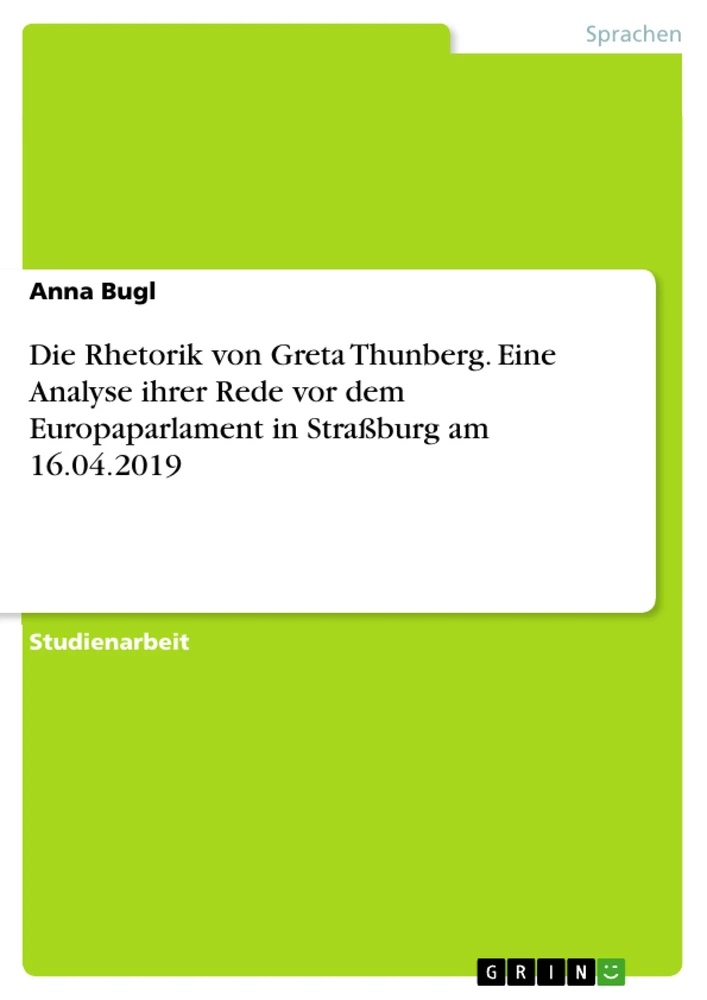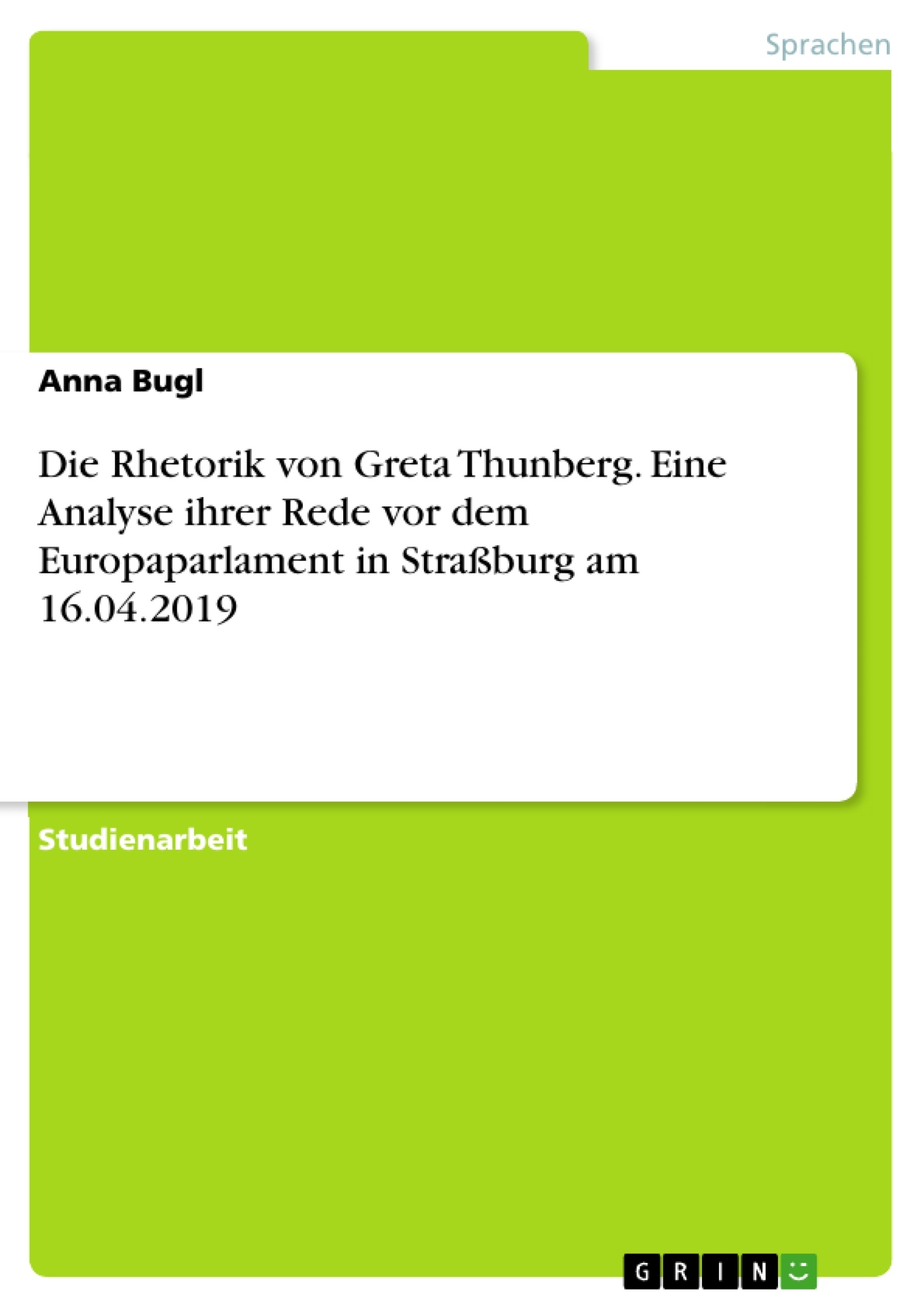In dieser Analyse der Rede von Greta Thunberg vor dem europäischen Parlament in Stockholm, die am 16. April 2019 präsentiert wurde, soll die Wirkung jenes Vortrages auf das Publikum sowie die Faktoren, welche die Rede zu einer gelungen machen, genauer beleuchtet werden.
Die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg wurde im Jahr 2003 in Stockholm geboren und gehört mit ihren 18 Jahren somit zu einer der jüngsten Rednerinnen des 21. Jahrhunderts. Jene Tatsache wird oftmals als Kritikpunkt gegen Thunberg verwendet. Auch die bei Thunberg diagnostizierte Krankheit Asperger-Syndrom wird des Öfteren gegen die Rednerin eingesetzt.
Die Kernposition Thunbergs ist, dass der aktive Klimaschutz sowohl von der Politik sowie von der Gesellschaft weitläufig ignoriert wird, was in der Folge zu massiven und unaufhaltbaren Auswirkungen des Klimawandels führen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Allgemeines
- 1.1 Greta Thunberg
- 1.2 Kontext
- 1.3 Fakten zur Rede
- 2 Redeanalyse
- 2.1 Inventio
- 2.1.1 Topoi
- 2.1.1.1 Topos der Folgen
- 2.1.1.2 Topos des Beispiels
- 2.1.1.3 Topos der Autorität
- 2.1.1.4 Topos des Vergleiches
- 2.1.2 Plausibilität
- 2.1.1 Topoi
- 2.2 Dispositio
- 2.2.1 Einleitung
- 2.2.2 Problemdarstellung
- 2.2.3 Argumentation
- 2.2.4 Schluss
- 2.3 Elocutio
- 2.3.1 Ornatus
- 2.3.1.1 Wiederholungsfiguren
- 2.3.1.2 Auslassungsfiguren
- 2.3.1.3 Umstellungsfiguren
- 2.3.1.4 Ersetzungsfiguren
- 2.3.1.5 Textfiguren
- 2.3.2 Stil
- 2.3.1 Ornatus
- 2.4 Actio
- 2.1 Inventio
- 3 Fazit und kritische Perspektive
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Rede von Greta Thunberg vor dem Europäischen Parlament, um deren Wirkung und die Faktoren ihres Erfolgs zu untersuchen. Die Arbeit beleuchtet die rhetorischen Strategien, die Thunberg einsetzt, und bewertet deren Effektivität. Der Fokus liegt auf der Analyse der Argumentationsstruktur, der verwendeten Stilmittel und der Wirkung der Präsentation.
- Analyse der rhetorischen Mittel in Greta Thunbergs Rede
- Bewertung der Wirksamkeit der Argumentation
- Untersuchung des Einflusses von Thunbergs Persönlichkeit und Stil
- Kontextualisierung der Rede im Rahmen der Klimadebatte
- Kritische Betrachtung der Rede und ihrer Wirkung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Gegenstand der Arbeit: die Analyse der Wirkung von Greta Thunbergs Rede vor dem Europäischen Parlament und der Faktoren, die zu ihrem Erfolg beitragen. Sie umreißt den Aufbau der Arbeit, der sich in einen allgemeinen Teil (Einführung in Greta Thunberg und den Kontext), eine Redeanalyse (Inventio, Dispositio, Elocutio, Actio) und ein Fazit mit kritischer Perspektive gliedert. Es wird deutlich gemacht, dass die Arbeit die rhetorischen Strategien der Rede beleuchtet und deren Wirksamkeit bewertet.
1 Allgemeines: Dieses Kapitel führt in die Persönlichkeit Greta Thunbergs und den Kontext ihrer Rede ein. Es präsentiert Thunbergs Kernpositionen im Klimaschutz, ihre Aktivitäten (Fridays for Future), ihre mediale Darstellung und die Kritik, die sie erfährt. Der Kontext wird durch die Beschreibung des dringenden Problems des Klimawandels und dessen potenziell katastrophalen Folgen hergestellt. Die Darstellung von Thunbergs Asperger-Syndrom wird im Kontext der Kritik an ihr erwähnt. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der Motivation und des Hintergrunds von Thunbergs Rede.
Schlüsselwörter
Greta Thunberg, Redeanalyse, Rhetorik, Klimaschutz, Klimawandel, Argumentation, Stilmittel, Wirkung, Europäisches Parlament, Fridays for Future, Plausibilität, Dispositio, Elocutio, Actio.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Rhetorische Analyse der Rede von Greta Thunberg
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert die Rede von Greta Thunberg vor dem Europäischen Parlament. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Wirkung der Rede und der Faktoren, die zu ihrem Erfolg beigetragen haben. Die Arbeit beleuchtet die rhetorischen Strategien, die Thunberg einsetzt, und bewertet deren Effektivität.
Welche Aspekte der Rede werden analysiert?
Die Analyse umfasst die Argumentationsstruktur, die verwendeten Stilmittel (Elocutio), die Anordnung der Argumente (Dispositio), die Erfindung der Argumente (Inventio) und die Wirkung der Präsentation (Actio). Zusätzlich wird der Kontext der Rede, die Persönlichkeit Greta Thunbergs und die Klimadebatte berücksichtigt.
Welche rhetorischen Mittel werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene rhetorische Figuren, darunter Wiederholungsfiguren, Auslassungsfiguren, Umstellungsfiguren, Ersetzungsfiguren und Textfiguren. Es wird auch der allgemeine Stil der Rede analysiert und die Plausibilität der Argumentation bewertet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: Einleitung (mit Beschreibung des Gegenstands und des Aufbaus), einen allgemeinen Teil (Einführung in Greta Thunberg, den Kontext und Fakten zur Rede), eine detaillierte Redeanalyse (Inventio, Dispositio, Elocutio, Actio) und abschließend ein Fazit mit kritischer Perspektive und einem Literaturverzeichnis.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Analyse der rhetorischen Mittel in Greta Thunbergs Rede, Bewertung der Wirksamkeit der Argumentation, Untersuchung des Einflusses von Thunbergs Persönlichkeit und Stil, Kontextualisierung der Rede im Rahmen der Klimadebatte und eine kritische Betrachtung der Rede und ihrer Wirkung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Greta Thunberg, Redeanalyse, Rhetorik, Klimaschutz, Klimawandel, Argumentation, Stilmittel, Wirkung, Europäisches Parlament, Fridays for Future, Plausibilität, Dispositio, Elocutio, Actio.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel mit allgemeinen Informationen zu Greta Thunberg und dem Kontext ihrer Rede, ein Kapitel zur detaillierten Redeanalyse (unterteilt in Inventio, Dispositio, Elocutio und Actio), sowie ein abschließendes Kapitel mit Fazit und kritischer Perspektive und ein Literaturverzeichnis.
- Citar trabajo
- Anna Bugl (Autor), 2021, Die Rhetorik von Greta Thunberg. Eine Analyse ihrer Rede vor dem Europaparlament in Straßburg am 16.04.2019, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1129349