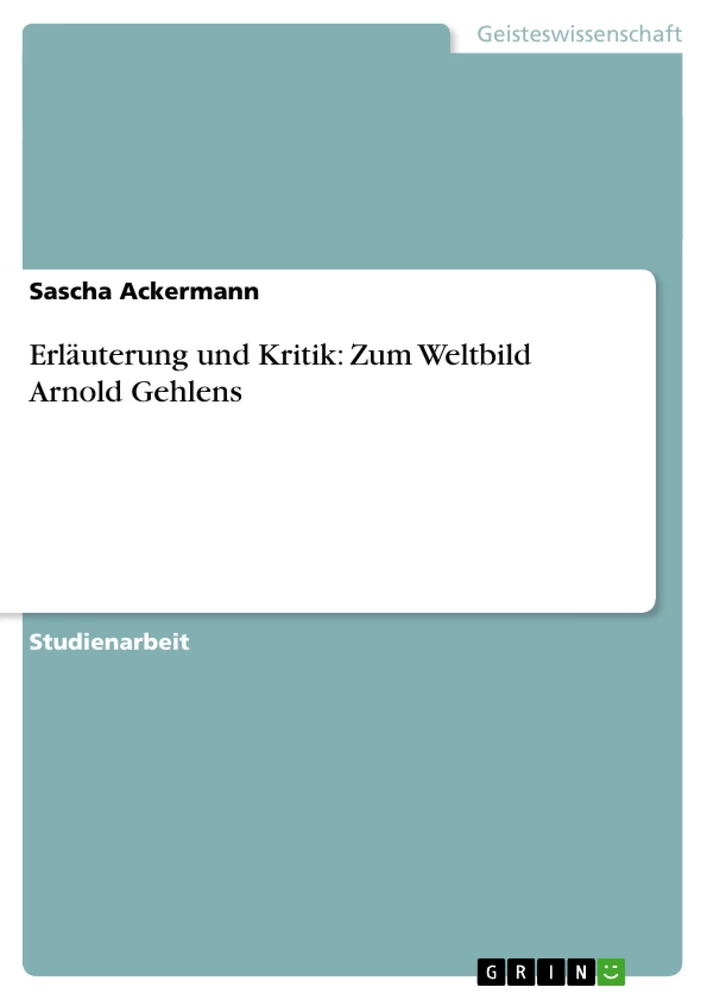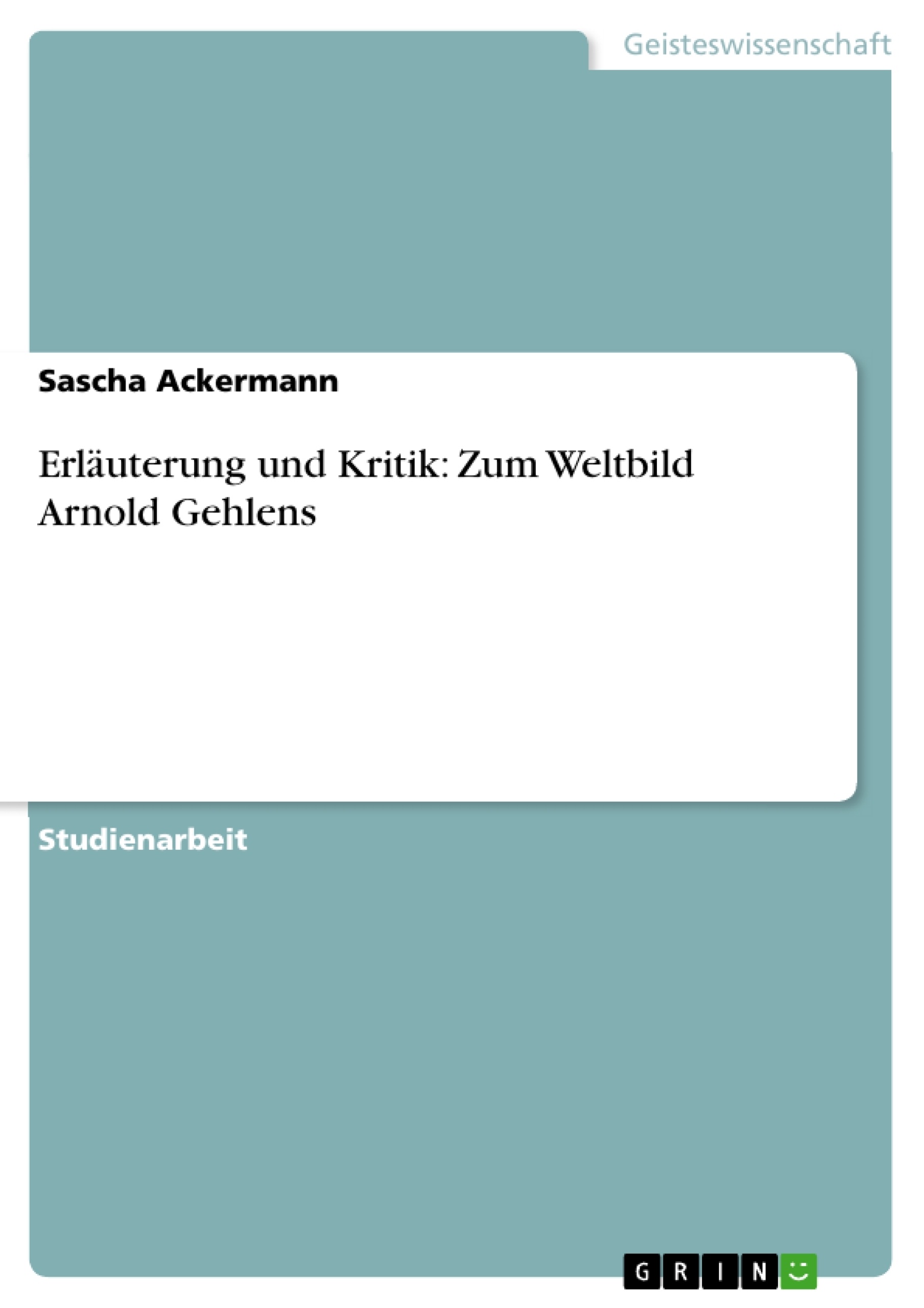Arnold Gehlen ist einer der bedeutendsten deutschen Anthropologen, Philosophen und Soziologen des 20. Jahrhunderts. Zugleich ist er aber auch einer der umstrittensten, da sein Werk die Apologie eines in vielerlei Hinsicht konservativen und autoritären Gesellschaftssystems impliziert und er selbst sich dem NS-Regime andiente.
Sein unbestrittenes Verdienst ist es aber, eine stringente ‘Anthropologie aus einem Guss’ vorgelegt zu haben, welche den Menschen - ausgehend von seiner biologischen Determiniertheit - als ‘Gegenentwurf der Natur’ zu ihren übrigen Schöpfungen beschreibt und daraus eine Theorie über die Mechanismen des Zusammenlebens in menschlichen Gesellschaften ableitet.
Allerdings ergibt sich jene ‘Anthropologie aus einem Guss’ erst aus einer Gesamtschau seiner Hauptwerke („Der Mensch“, „Urmensch und Spätkultur“, „Die Seele im technischen Zeitalter“ und „Moral und Hypermoral“) , und dieses ist das Anliegen der vorliegenden Arbeit:
Der Autor gibt einen orientierenden und erläuternden Überblick über die conditio humana in den Begriffen Arnold Gehlens (“Mängelwesen”, “Weltoffenheit”, “Entlastung”, “Gewohnheiten und Institutionen”), wobei auch die Anleihen beleuchtet werden, welche Niklas Luhmanns Systemtheorie bei Gehlens Sozialphilosophie macht.
Es folgt ein kritischer Teil, der sich vor allem mit Implikationen des Gehlenschen Institutionenbegriffes auseinandersetzt und zuletzt die Möglichkeiten einer Gegenüberstellung der philosophischen Anthropologie Arnold Gehlens mit derjenigen Hannah Arendts auslotet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Formaler Hinweis
- Kontextualisierung
- Agenda
- Arnold Gehlens Weltbild
- Mängelwesen Mensch
- Weltoffenheit
- Entlastung
- Gewohnheiten und Institutionen
- Individuum und Gesellschaft – Konsequenzen von und Kritik an Gehlens Sozialphilosophie
- Bisherige Rezeption und Kritik
- Ausblick: Arnold Gehlen und Hannah Arendt im Vergleich
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert das Weltbild von Arnold Gehlen, wie es in seinen Hauptwerken „Der Mensch“, „Urmensch und Spätkultur“, „Die Seele im technischen Zeitalter“ und „Moral und Hypermoral“ dargestellt wird. Ziel ist es, Gehlens anthropologische Grundannahmen zu erläutern und kritisch zu beleuchten, insbesondere im Hinblick auf seine Sozialphilosophie.
- Der Mensch als Mängelwesen und seine Weltoffenheit als Kompensationsstrategie
- Die Rolle von Entlastung und Gewohnheiten in der menschlichen Existenz
- Die Bedeutung von Institutionen für die soziale Ordnung
- Kritik an Gehlens Sozialphilosophie und Vergleich mit Hannah Arendts Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert den Kontext der Arbeit. Sie stellt Gehlens anthropologische Grundannahmen vor und skizziert die Agenda der Arbeit.
Kapitel 2 beleuchtet Gehlens Weltbild. Es analysiert die anthropologischen Ausgangsbeobachtungen, die Gehlen macht, insbesondere die These vom Menschen als Mängelwesen und seine Weltoffenheit als Kompensationsstrategie. Weiterhin werden die Konzepte der Entlastung und der Bedeutung von Gewohnheiten und Institutionen für die menschliche Existenz erläutert.
Kapitel 3 befasst sich mit den Konsequenzen von und der Kritik an Gehlens Sozialphilosophie. Es werden zentrale Kritikpunkte an Gehlens Theorie benannt und in einem Ausblick die Fruchtbarkeit einer Gegenüberstellung von Arnold Gehlens Theorie mit derjenigen Hannah Arendts diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Anthropologie Arnold Gehlens, das Mängelwesen Mensch, die Weltoffenheit, Entlastung, Gewohnheiten, Institutionen, Sozialphilosophie, Kritik an Gehlen, Hannah Arendt, Vergleich.
- Arbeit zitieren
- Sascha Ackermann (Autor:in), 2007, Erläuterung und Kritik: Zum Weltbild Arnold Gehlens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112967