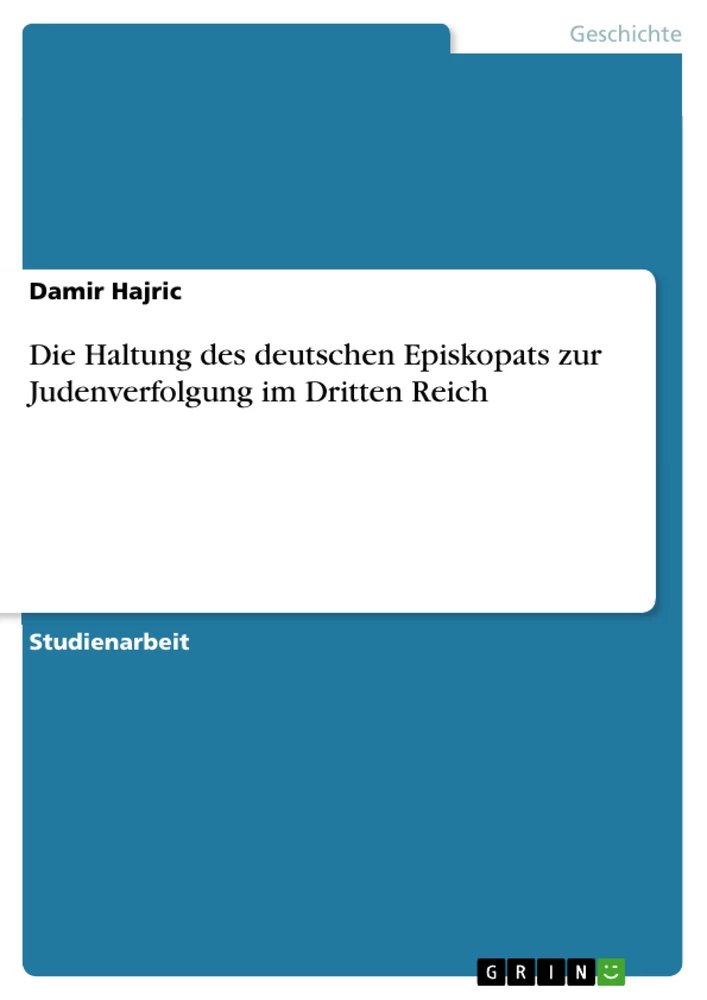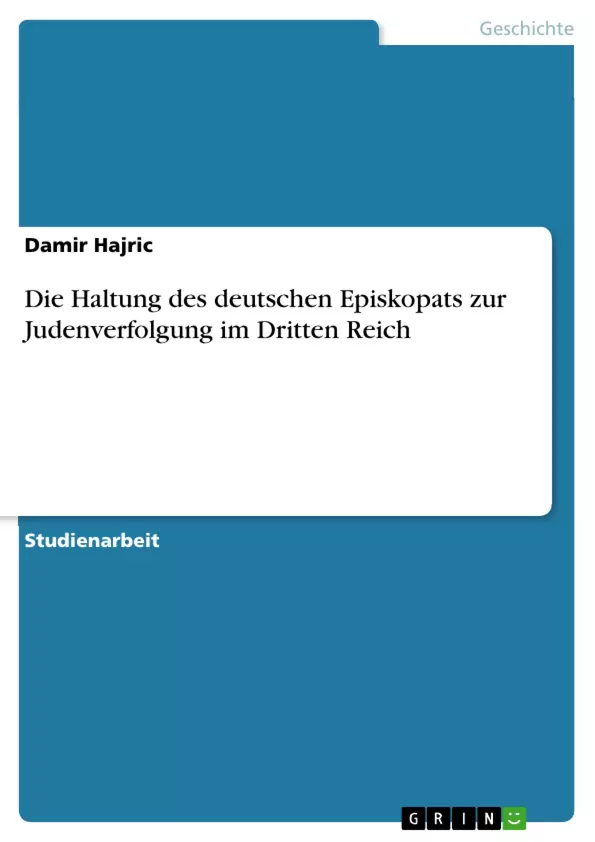Die vorliegende Hausarbeit soll mit Hilfe auserwählter Literatur und Quellen
das Verhalten des deutschen Episkopats während dieser ersten Phase kritisch
untersuchen. Anhand der Reaktion auserwählter Repräsentanten des deutschen
Episkopats auf die zentralen Maßnahmen der Nationalsozialisten gegen den
jüdischen Teil der Bevölkerung bis zum Jahr 1936 soll gezeigt werden, dass
die gerne verwendete Apologetik der Kirchenleute und die damit zusammenhängende
Propagierung der Unschuld, nicht auf das tatsächliche Handeln basieren
kann. Primär soll dafür das Handeln des Münchener Kardinals Faulhaber
durch die Analyse auserwählter Quellen in Betracht gezogen werden. Er gilt als
eine der markantesten Persönlichkeiten im deutschen Episkopat in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts und gerade aus diesem Grunde soll sein Unwille,
den Nationalsozialisten die Stirn zu bieten und sein Ignorieren der innerkirchlichen
Stimmen gegen das Regime gezeigt werden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. DIE NATIONALSOZIALISTISCHE JUDENPOLITIK – PHASEN DER VERFOLGUNG UND VERNICHTUNG
- 3. FALLENGELASSEN – Die Jahre 1933 und 1934
- 4. DIE,,NÜRNBERGER GESETZE“ UND DIE AUSSPRACHE KIRCHLICHER LOYALITÄT IM JAHR 1936
- 5. FAZIT
- 6. QUELLEN UND LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert kritisch das Verhalten des deutschen Episkopats während der frühen Phase der nationalsozialistischen Judenverfolgung (1933-1936). Sie untersucht die Reaktionen ausgewählter Repräsentanten des Episkopats auf die zentralen Maßnahmen der Nationalsozialisten gegen die jüdische Bevölkerung und hinterfragt die gängige Apologetik der Kirchenleute, die ihre Unschuld während dieser Zeit propagiert.
- Die nationalsozialistische Judenpolitik und ihre Phasen der Verfolgung und Vernichtung
- Die Reaktion des deutschen Episkopats auf die frühen Maßnahmen der Nationalsozialisten gegen die Juden
- Die Rolle des Münchener Kardinals Faulhaber als prominenter Vertreter des Episkopats
- Die Frage der Verantwortung und Schuld des deutschen Episkopats
- Die Bedeutung der innerkirchlichen Stimmen gegen das NS-Regime
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die These auf, dass das deutsche Episkopat, als Vertreter des Katholizismus und damit Propagierter des Gebots der Nächstenliebe, in der Lage gewesen wäre, die Bevölkerung zum breiten Protest gegen die Judenhetze zu mobilisieren. Sie kritisiert die nach dem Krieg verbreitete Selbstrechtfertigung des Episkopats und stellt die Frage nach seiner tatsächlichen Rolle während der Naziherrschaft.
Das zweite Kapitel beschreibt die nationalsozialistische Judenpolitik in ihren vier Phasen: von der ersten Phase der gezielten Ausgrenzung und Entrechtung (1933-1935) über die Verabschiedung der Nürnberger Gesetze (1935-1938) bis hin zum Judenpogrom 1938 und der „Endlösung der Judenfrage“ (1941-1945).
Das dritte Kapitel beleuchtet die frühen Jahre der nationalsozialistischen Judenverfolgung (1933-1934) und zeigt, wie die gezielte Diskriminierung und Entrechtung der Juden durch die Nationalsozialisten begann. Es wird auch auf die Reaktion einzelner Kirchenmänner auf diese Entwicklungen eingegangen.
- Quote paper
- Bachelor Damir Hajric (Author), 2006, Die Haltung des deutschen Episkopats zur Judenverfolgung im Dritten Reich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113016