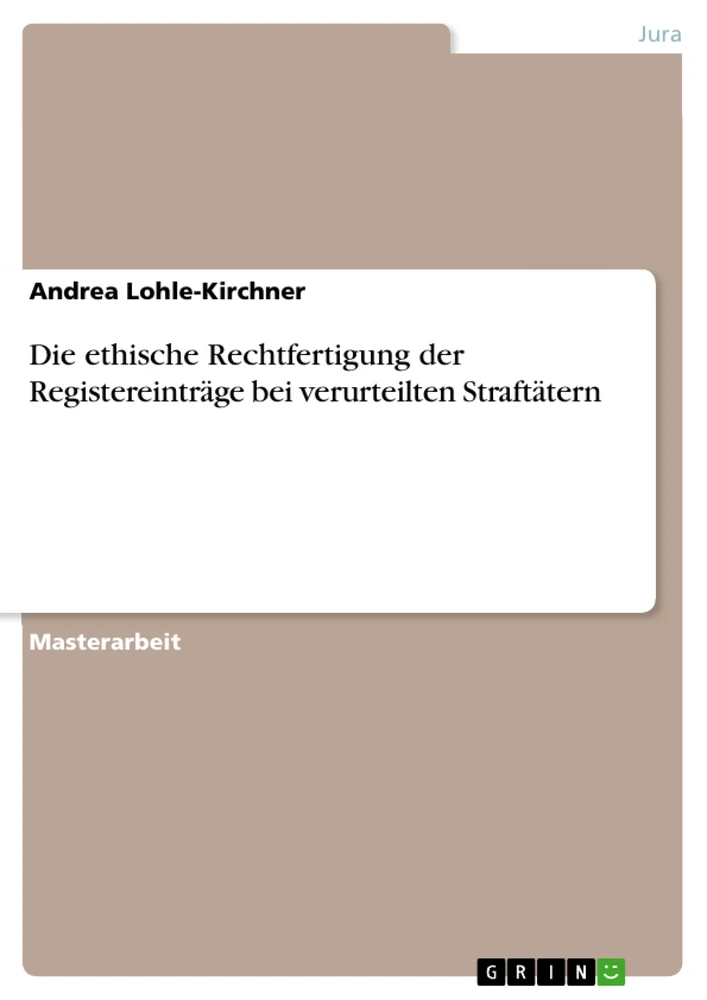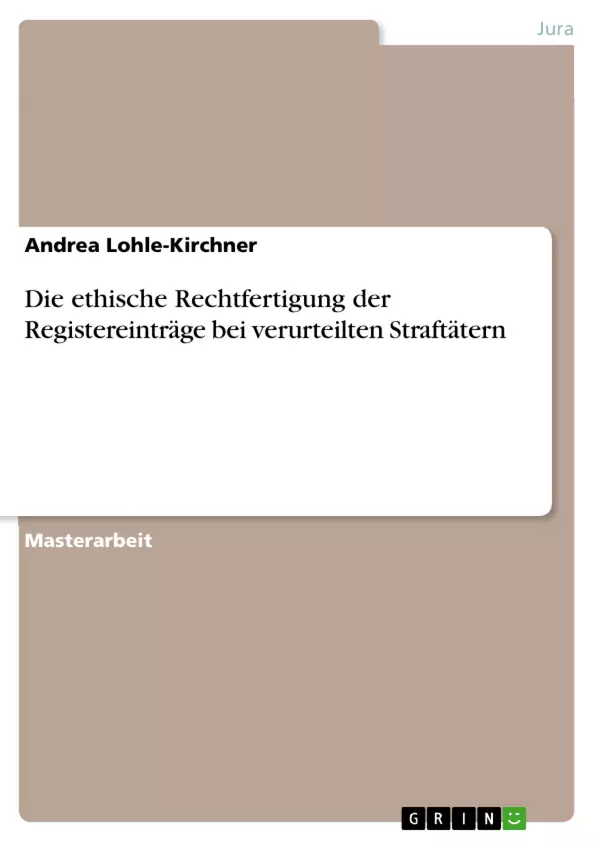Wer in Deutschland durch ein Strafgericht verurteilt wird, erhält einen Eintrag im sogenannten Bundeszentralregister. Faktisch stellen diese Einträge für verurteilte Straftäter ein Resozialisierungshindernis dar: Sie verletzen moralische Rechte auf informationelle Selbstbestimmung, auf Privatheit und freie Berufswahl. Daher stellt sich die Frage: Wie lassen sich Strafregistereinträge - als über die Strafe hinaus wirkende Sanktion - ethisch rechtfertigen?
Klienten in der Straffälligenhilfe erkundigen sich oftmals, wie lange ihre Verurteilung noch im Führungszeugnis oder im Bundeszentralregister aufgeführt sein wird. Die Tatsache, laut Register „vorbestraft“ zu sein, stellt für die Betroffenen einen Makel dar, den sie möglichst schnell wieder loswerden möchten: Das Wissen, dass Daten über das eigene Fehlverhalten in Form strafrechtlicher Einträge für einen längeren Zeitraum gespeichert bleiben, ist belastend. Es besteht das Bedürfnis, dass die zurückliegenden strafrechtlichen Verfehlungen auch auf dem Papier gelöscht und vergessen sein sollen.
Faktisch stellen die Einträge für verurteilte Straftäter ein Resozialisierungshindernis dar. Von konkreter Relevanz ist ein Eintrag beispielsweise bei der Bewerbung in bestimmten Arbeitsbereichen. Registereinträge spielen aber zum Beispiel auch bezüglich der asylrechtlichen Situation, der Erteilung einer Fahrerlaubnis, eines ehrenamtlichen Engagements im Kinder- und Jugendbereich oder des Erwerbs eines Jagdscheins eine Rolle. In behördlichen Zusammenhängen stellen die Einträge oftmals Verweigerungsgründe für Anträge oder Genehmigungen dar. Verurteilten können somit noch weit nach Abschluss ihres Strafverfahrens nachteilige Folgen entstehen. Zweifellos tragen die Betroffenen die Verantwortung für diese Einträge und ihre Folgen. Sie haben Straftaten begangen, also durch rechtswidriges und schuldhaftes Handeln den Tatbestand strafrechtlicher Normen verwirklicht. Die Rechtfertigung für die Registereinträge erscheint demnach ganz offensichtlich: Der Verurteilte darf und muss für sein Fehlverhalten sanktioniert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Darstellung der Praxis
- Vergeltung, Prävention, Expression
- (Wie) Lassen sich Strafregistereinträge ethisch rechtfertigen?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die ethische Rechtfertigung von Strafregistereinträgen bei verurteilten Straftätern in Deutschland. Sie analysiert, ob die Einträge im Bundeszentralregister über den Zweck der eigentlichen Strafe hinaus gerechtfertigt sind, und zwar unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die betroffenen Personen.
- Ethische Rechtfertigung von Strafe
- Auswirkungen von Strafregistereinträgen auf Resozialisierung
- Abwägung zwischen individuellen Rechten und öffentlichem Interesse
- Analyse klassischer Strafsanktionstheorien (Vergeltung, Prävention, Expression)
- Konkrete Fallbeispiele und deren ethische Implikationen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik von Strafregistereinträgen und deren Auswirkungen auf verurteilte Straftäter dar. Sie führt ein Fallbeispiel ein (Jana V.), das die ethischen Konflikte verdeutlicht: die Notwendigkeit der Sanktionierung des Fehlverhaltens steht im Widerspruch zu den eingeschränkten Rechten und der Beeinträchtigung der Resozialisierung durch die dauerhaften Einträge. Die Arbeit fragt nach einer ethischen Rechtfertigung dieser verlängernden Sanktion über die eigentliche Strafe hinaus.
Darstellung der Praxis: Dieses Kapitel beschreibt die Funktionsweise des Bundeszentralregisters (BZR) und des Führungszeugnisses. Es erklärt die rechtlichen Grundlagen, die Eintragungspraxis und die verschiedenen Arten von Eintragungen. Die Auswirkungen auf die betroffenen Personen werden beleuchtet, insbesondere die Beeinträchtigung von moralischen Rechten wie dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Privatheit, Resozialisierung und freie Berufswahl. Die Darstellung veranschaulicht, wie weitreichend die Folgen von Registereinträgen für verurteilte Straftäter sind.
Vergeltung, Prävention, Expression: Dieses Kapitel untersucht drei klassische Theorien der moralischen Rechtfertigung von Strafe – Vergeltung, Prävention und Expression – und wendet diese auf die Praxis der Strafregistereinträge an. Es wird analysiert, inwieweit die Einträge Gerechtigkeit herstellen, die Sicherheit der Allgemeinheit erhöhen oder die Geltung von Normen bestärken. Zudem werden Einwände gegen jede Theorie diskutiert, die die ethische Rechtfertigung der Einträge in Frage stellen könnten. Das Kapitel analysiert, ob die Einträge einen zusätzlichen ethischen Wert über die Strafe selbst hinaus haben.
Schlüsselwörter
Angewandte Ethik, Strafregistereinträge, Bundeszentralregister, Resozialisierung, Vergeltung, Prävention, Expression, moralische Rechte, informationelle Selbstbestimmung, Rechtsethik, Strafrecht.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Ethische Rechtfertigung von Strafregistereinträgen
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die ethische Rechtfertigung von Strafregistereinträgen in Deutschland. Sie analysiert, ob die Einträge im Bundeszentralregister über den eigentlichen Zweck der Strafe hinaus gerechtfertigt sind und welche Auswirkungen dies auf die betroffenen Personen hat.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der ethischen Rechtfertigung von Strafe, den Auswirkungen von Strafregistereinträgen auf die Resozialisierung, der Abwägung zwischen individuellen Rechten und öffentlichem Interesse, der Analyse klassischer Strafsanktionstheorien (Vergeltung, Prävention, Expression) und konkreten Fallbeispielen mit ihren ethischen Implikationen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Darstellung der Praxis des Bundeszentralregisters, ein Kapitel zur Analyse der Strafsanktionstheorien (Vergeltung, Prävention, Expression) und ein Fazit. Die Einleitung führt ein Fallbeispiel ein, um die ethischen Konflikte zu verdeutlichen. Das Kapitel zur Praxis beschreibt die Funktionsweise des BZR und die Auswirkungen der Einträge auf Betroffene. Das Kapitel zu den Strafsanktionstheorien untersucht, ob die Einträge einen zusätzlichen ethischen Wert über die Strafe hinaus haben.
Welche konkreten Fragen werden gestellt?
Die zentrale Frage der Arbeit lautet: Lassen sich Strafregistereinträge ethisch rechtfertigen, insbesondere über den eigentlichen Zweck der Strafe hinaus? Dabei werden die Auswirkungen auf die Resozialisierung und die Einschränkung individueller Rechte berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Angewandte Ethik, Strafregistereinträge, Bundeszentralregister, Resozialisierung, Vergeltung, Prävention, Expression, moralische Rechte, informationelle Selbstbestimmung, Rechtsethik, Strafrecht.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit analysiert klassische Strafsanktionstheorien und wendet diese auf die Praxis der Strafregistereinträge an. Sie beleuchtet die Auswirkungen auf Betroffene und diskutiert Einwände gegen die ethische Rechtfertigung der Einträge.
Was ist das Fazit der Arbeit (ohne den Inhalt vorwegzunehmen)?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen und gibt eine abschließende Bewertung der ethischen Rechtfertigung von Strafregistereinträgen.
Welches Fallbeispiel wird verwendet?
Ein Fallbeispiel (Jana V.) verdeutlicht die ethischen Konflikte zwischen der Notwendigkeit der Sanktionierung und den eingeschränkten Rechten und der Beeinträchtigung der Resozialisierung durch dauerhafte Einträge.
Welche Auswirkungen von Strafregistereinträgen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen auf moralische Rechte wie das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Privatheit, Resozialisierung und freie Berufswahl.
- Arbeit zitieren
- Andrea Lohle-Kirchner (Autor:in), 2020, Die ethische Rechtfertigung der Registereinträge bei verurteilten Straftätern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1130385