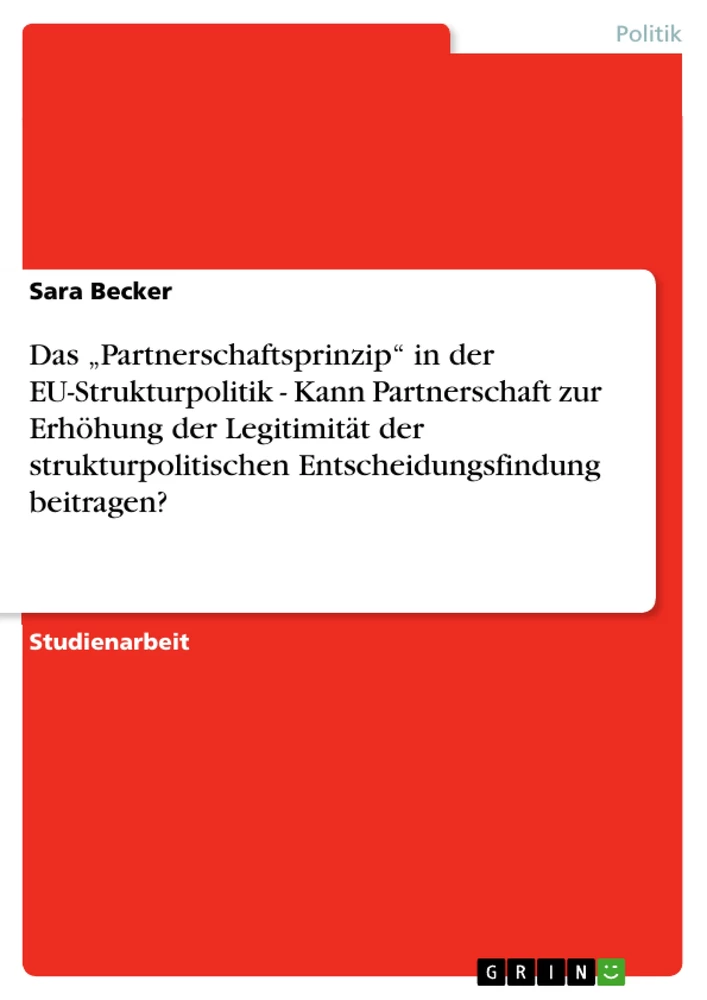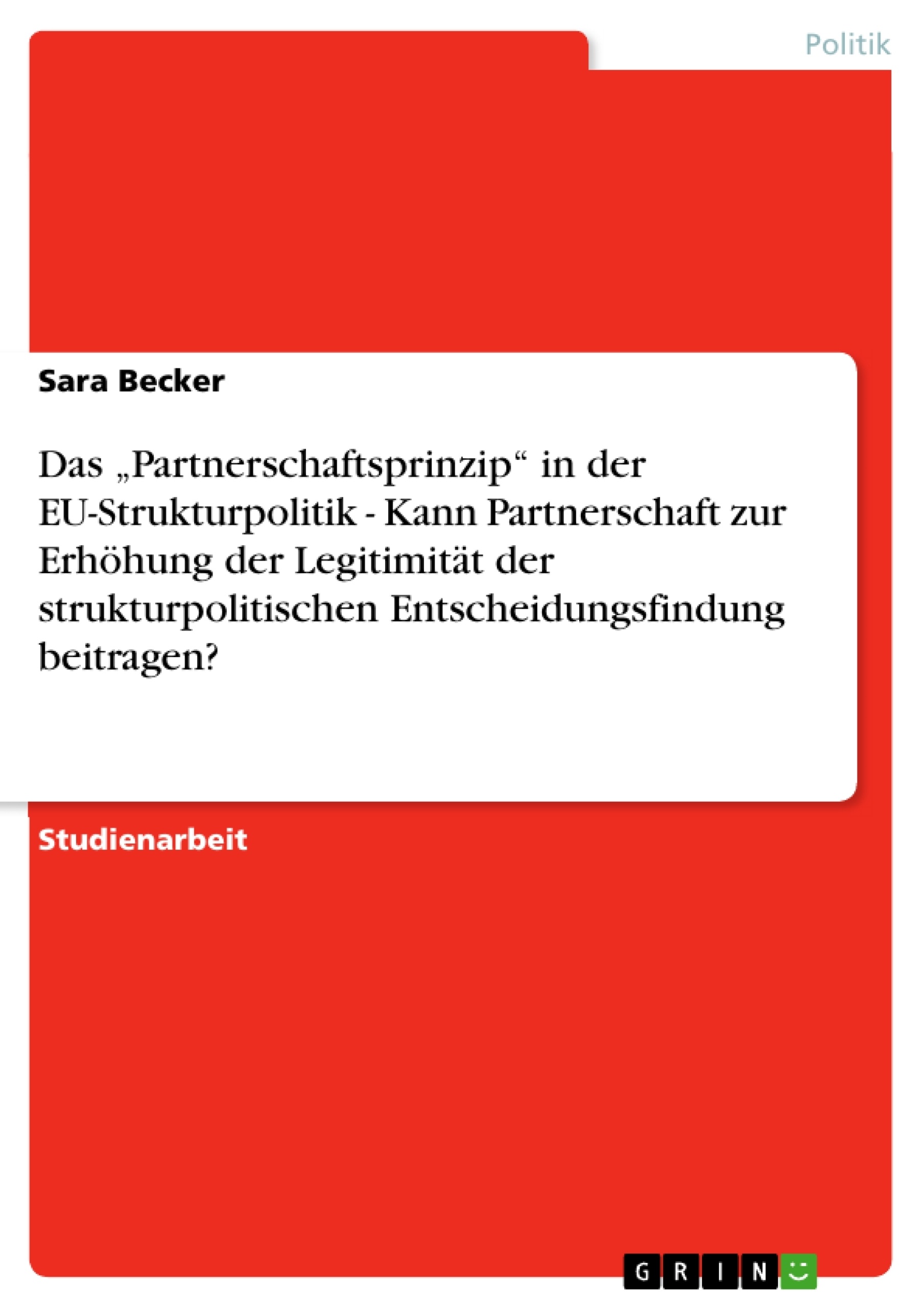Mit Inkrafttreten der Einheitlichen Europäischen Akte im Jahre 1987 erhielt die Europäische Gemeinschaft die Rechtsgrundlage, eine gemeinschaftliche Strukturpolitik zu entwickeln. Zwar gab es schon vor 1987 europäische Strukturfonds , doch deren Mittel wurden hauptsächlich zur Unterstützung von Förderprogrammen der Mitgliedsstaaten eingesetzt. Zudem erfolgten die Förderprogramme nach nationalen Kriterien, wobei gesamteuropäische Entwicklungen häufig vernachlässigt wurden. Die Konzeption einer wirklich europäischen Strukturpolitik erfolgte erst im Rahmen des Entschlusses zur Vollendung des europäischen Binnenmarktes Mitte der 1980er Jahre. Die Strukturpolitik sollte nämlich die von den wirtschaftlich rückständigen Mitgliedsstaaten befürchteten nachteiligen Auswirkungen der Vollendung des Gemeinsamen Marktes durch ausgleichende Förderprogramme auffangen. Eine umfassende Reform 1988 erweiterte den Handlungsspielraum der Kommission in der Strukturpolitik maßgeblich, verdoppelte die Mittel der Strukturfonds, integrierte die Strukturfonds, legte die Grundziele der EU-Strukturpolitik fest und verankerte das sogenannte „Partnerschaftsprinzip“ als künftige Verfahrensweise (vgl. Tömmel 1994; Poth-Mögele 1993).
Diese Arbeit hat das 1988 eingeführte „Partnerschaftsprinzip“ zum Thema und beschäftigt sich mit der Frage, ob es zur Steigerung der Legitimität der Entscheidungsfindung in der europäischen Strukturpolitik beitragen konnte. Vor dem Hintergrund der andauernden akademischen Debatte um das Demokratiedefizit der Europäischen Union (vgl. z.B. Heinelt 2005; Abromeit 2002) ist eine Annäherung an das Thema der Partnerschaft aus demokratietheoretischer Perspektive von besonderer Aktualität.
Der erste Teil der Arbeit gibt zunächst einen Überblick über die Bedeutung und die Entwicklung des Partnerschaftsprinzips, beschreibt welche Ziele durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit erreicht werden sollten, erläutert die institutionellen Erscheinungsformen der Partnerschaft und die Rolle der Partner auf den verschiedenen Stufen des strukturpolitischen Politikzyklus. Zudem wird überblicksartig auf die verschiedenen Reaktionsmuster der Mitgliedsstaaten auf das Partnerschaftsprinzip eingegangen, bevor im zweiten Teil der Arbeit die Frage der Legitimitätssteigerung diskutiert wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Partnerschaftsprinzip
- Die Entwicklung des Partnerschaftsprinzips
- Die Ziele des Partnerschaftsprinzips
- Strukturen und Mitglieder der Partnerschaft
- Die Basis für alle weiteren Überlegungen: Reaktionen der Mitgliedsstaaten auf das Partnerschaftsprinzip
- Erhöhte Legitimität durch Partnerschaft?
- Erhöhte Legitimität im Sinne eines deliberativen Demokratiemodells?
- Erhöhte Legitimität im Sinne eines parlamentarischen Demokratiemodells?
- Erhöhte Legitimität im Sinne eines outputorientierten Demokratiemodells?
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem im Jahr 1988 eingeführten „Partnerschaftsprinzip“ in der EU-Strukturpolitik und analysiert dessen Beitrag zur Steigerung der Legitimität der Entscheidungsfindung in diesem Bereich. Die Arbeit setzt sich mit der andauernden Debatte um das Demokratiedefizit der Europäischen Union auseinander und betrachtet das Partnerschaftsprinzip aus dem Blickwinkel der Demokratietheorie.
- Entwicklung und Bedeutung des Partnerschaftsprinzips
- Ziele und Auswirkungen des Partnerschaftsprinzips auf die Strukturpolitik
- Institutionelle Strukturen und Akteure in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit
- Reaktionen der Mitgliedsstaaten auf das Partnerschaftsprinzip
- Bewertung der Legitimitätssteigerung durch das Partnerschaftsprinzip aus der Perspektive verschiedener Demokratiemodelle
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Entstehung der EU-Strukturpolitik und die Einführung des „Partnerschaftsprinzips“ als zentrales Element der Reform von 1988. Es wird auf die Bedeutung des Prinzips für die Entscheidungsfindung und die Legitimität der EU-Strukturpolitik hingewiesen.
- Das Partnerschaftsprinzip: Dieses Kapitel erläutert die Entwicklung des Partnerschaftsprinzips von seiner Einführung bis zur aktuellen Fassung. Es werden die Ziele der partnerschaftlichen Zusammenarbeit sowie die institutionellen Strukturen und die Rolle der verschiedenen Akteure beschrieben.
- Die Basis für alle weiteren Überlegungen: Reaktionen der Mitgliedsstaaten auf das Partnerschaftsprinzip: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Reaktionsmuster der Mitgliedsstaaten auf die Einführung des Partnerschaftsprinzips und deren Auswirkungen auf die Umsetzung der Strukturpolitik.
- Erhöhte Legitimität durch Partnerschaft?: Dieses Kapitel setzt sich mit der Frage auseinander, ob das Partnerschaftsprinzip tatsächlich zu einer Erhöhung der Legitimität der Entscheidungsfindung in der EU-Strukturpolitik beigetragen hat. Es werden verschiedene Demokratiemodelle herangezogen, um die Legitimitätsfrage aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenschwerpunkte der Arbeit sind: Partnerschaftsprinzip, EU-Strukturpolitik, Legitimität, Entscheidungsfindung, Demokratiedefizit, deliberative Demokratie, parlamentarische Demokratie, outputorientierte Demokratie, Mitgliedsstaaten, regionale Akteure, institutionelle Strukturen.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt das Partnerschaftsprinzip in der EU-Strukturpolitik?
Es verpflichtet die EU-Kommission, die Mitgliedstaaten und regionale Akteure zu einer engen Zusammenarbeit bei der Planung und Umsetzung von Förderprogrammen.
Wann wurde das Partnerschaftsprinzip eingeführt?
Das Prinzip wurde im Rahmen einer umfassenden Reform der Strukturfonds im Jahr 1988 fest verankert.
Kann das Prinzip das Demokratiedefizit der EU verringern?
Die Arbeit diskutiert dies aus verschiedenen Perspektiven (deliberativ, parlamentarisch, outputorientiert) und prüft, ob die Einbindung regionaler Partner die Legitimität erhöht.
Wer sind die typischen Mitglieder einer solchen Partnerschaft?
Dazu gehören neben Regierungsvertretern auch regionale und lokale Behörden, Wirtschafts- und Sozialpartner sowie Organisationen der Zivilgesellschaft.
Wie reagierten die Mitgliedsstaaten auf diese Vorgabe der EU?
Die Reaktionen waren unterschiedlich; sie reichten von aktiver Förderung regionaler Autonomie bis hin zu Versuchen, die zentrale staatliche Kontrolle beizubehalten.
- Quote paper
- Sara Becker (Author), 2007, Das „Partnerschaftsprinzip“ in der EU-Strukturpolitik - Kann Partnerschaft zur Erhöhung der Legitimität der strukturpolitischen Entscheidungsfindung beitragen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113077