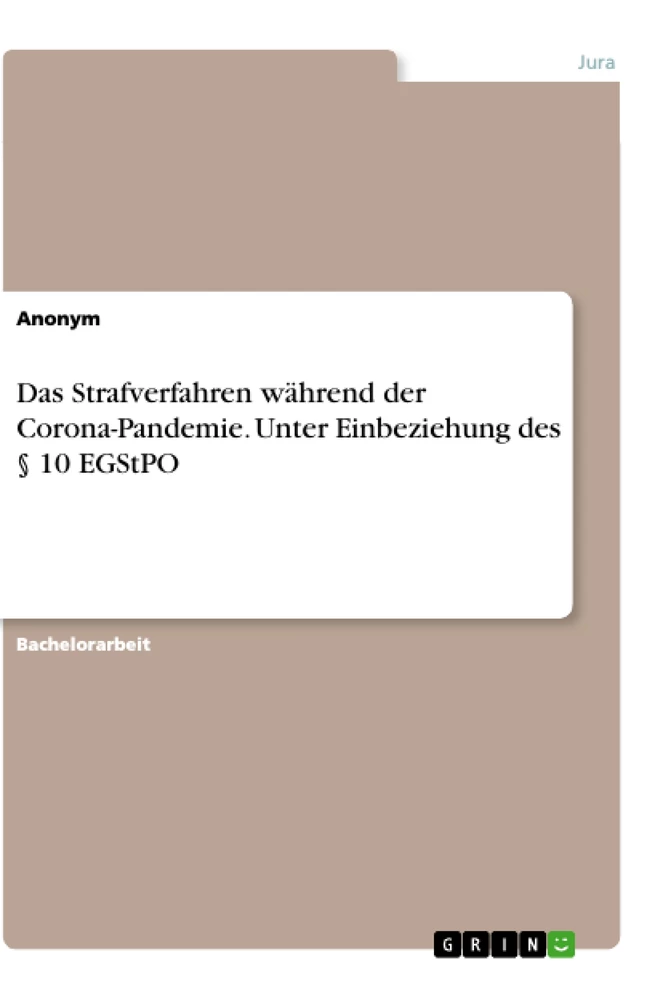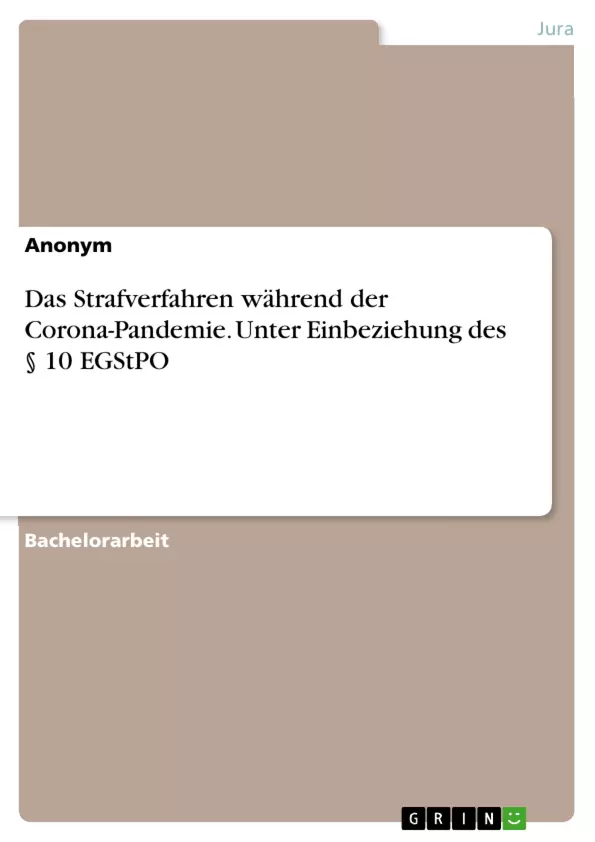Ziel dieser Arbeit ist es, aufzuzeigen, wie sich die COVID-19-Pandemie sowie die dadurch bedingte „Corona-Gesetzgebung“ auf das Strafverfahren auswirken. Der Hauptfokus liegt in dieser Hinsicht auf den Regelungen des neu eingeführten § 10 des Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung (EGStPO).
Für diesen Zweck erfolgt zunächst in der gebotenen Kürze die Betrachtung allgemeiner Auswirkungen auf das Strafverfahren. Darauf folgt die schwerpunktmäßige Durchleuchtung der Auswirkungen des § 10 EGStPO auf die Hauptverhandlung, auf Haftsachen sowie auf Verjährungsfristen. Eine zentrale Rolle wird hierfür die Frage spielen, ob der Beschleunigungs- sowie Öffentlichkeitsgrundsatz als verletzt angesehen werden können. Zum besseren Verständnis werden jedoch zuvor die Ausgangssituation sowie die genauen Regelungen der Norm dargestellt. Bei der Untersuchung der Auswirkungen wird zumeist erst der wesentliche Aspekt im Allgemeinen beschrieben und sodann die Besonderheiten während der Pandemie durchleuchtet.
Daraufhin folgen die Untersuchungen des Umgangs mit Inhaftierten sowie dem Vollzug von Strafbefehlen. Diese werden zwar nicht durch die Regelungen des § 10 EGStPO unmittelbar betroffen, sind jedoch ebenfalls von maßgeblicher Bedeutung für das Strafverfahren während der Corona-Krise.
Das Fazit, welches zugleich eine kritische Würdigung aus Sicht des Verfassers darstellt, fasst die herauskristallisierten Haupterkenntnisse aus den vorherigen Abschnitten in kompakter Form zusammen. Der Ausblick, welcher noch offene und noch zu untersuchende weitere Probleme aufzeigt, rundet die Arbeit schließlich ab.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung...
- I. Problemaufriss
- II. Ziel und Aufbau der Arbeit
- B. Das Strafverfahren während der Pandemie...
- I. Allgemeine Auswirkungen auf das Strafverfahren...
- 1. Sitzungspolizeiliche Maßnahmen
- 2. Gefahrenpotential nach Fallgruppen...
- 3. Gesichtsverhüllung im Straßenverkehr
- 4. Aussetzung der Insolvenzantragspflicht
- II. Die Auswirkungen des § 10 EGStPO...
- 1. Die Ausgangssituation...
- a) Die Unterbrechungsfrist nach § 229 StPO
- b) Die Hemmung der Unterbrechungsfrist
- c) Verfahrensaussetzung
- d) Die Urteilsverkündungsfrist nach § 268 Absatz 3 StPO
- 2. Betrachtung des § 10 EGStPO...
- a) Die Einführung des § 10 EGStPO
- b) Der Inhalt des § 10 EGStPO
- aa) Die Regelung des Absatz 1
- bb) Die Regelung des Absatz 2
- 3. Auswirkungen auf die Hauptverhandlung...
- a) Der Beschleunigungsgrundsatz...
- aa) Der Beschleunigungsgrundsatz im Allgemeinen
- bb) Die Besonderheiten während der Pandemie
- b) Der Öffentlichkeitsgrundsatz
- aa) Der Öffentlichkeitsgrundsatz im Allgemeinen
- bb) Die Besonderheiten während der Pandemie
- a) Der Beschleunigungsgrundsatz...
- 4. Auswirkungen auf Haftsachen...
- a) Die Untersuchungshaft im Allgemeinen
- b) Die Besonderheiten während der Pandemie
- 5. Auswirkungen auf Verjährungsfristen...
- a) Die Verjährungsfristen im Allgemeinen
- b) Die Besonderheiten während der Pandemie
- 1. Die Ausgangssituation...
- III. Der Umgang mit Strafgefangenen
- 1. Die Situation in Deutschland
- 2. Die Situation im Ausland
- IV. Vollzug von Strafbefehlen
- 1. Das Strafbefehlsverfahren im Allgemeinen
- 2. Die Besonderheiten während der Pandemie
- a) Ausweichen auf Strafbefehle nach § 407 StPO
- aa) Gesundheit als Tatbestandsmerkmal
- bb) Rechtliche Einordnung der ministerialen Äußerung
- b) Ausweichen auf Strafbefehle nach § 408a StPO
- a) Ausweichen auf Strafbefehle nach § 407 StPO
- I. Allgemeine Auswirkungen auf das Strafverfahren...
- C. Fazit und Ausblick...
- I. Fazit zugleich kritische Würdigung
- II. Ausblick...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Strafverfahren in Deutschland. Dabei werden sowohl allgemeine Auswirkungen wie Sitzungspolizeiliche Maßnahmen, Gefahrenpotential nach Fallgruppen, Gesichtsverhüllung im Straßenverkehr und die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht beleuchtet, als auch die speziellen Auswirkungen des § 10 EGStPO auf das Strafverfahren untersucht. Der Fokus liegt auf der Betrachtung der Auswirkungen auf die Hauptverhandlung, Haftsachen, Verjährungsfristen sowie den Umgang mit Strafgefangenen und den Vollzug von Strafbefehlen.
- Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Strafverfahren
- Die Bedeutung des § 10 EGStPO im Kontext der Pandemie
- Die Auswirkungen auf die Hauptverhandlung und den Beschleunigungsgrundsatz
- Die Auswirkungen auf Haftsachen und den Vollzug von Strafbefehlen
- Die Auswirkungen auf Verjährungsfristen und den Umgang mit Strafgefangenen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit befasst sich mit der Einleitung und stellt die Problematik des Strafverfahrens während der COVID-19-Pandemie dar. Es werden die Ziele und der Aufbau der Arbeit vorgestellt.
Das zweite Kapitel untersucht die allgemeinen Auswirkungen der Pandemie auf das Strafverfahren. Dazu gehören Sitzungspolizeiliche Maßnahmen, Gefahrenpotential nach Fallgruppen, Gesichtsverhüllung im Straßenverkehr und die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Es wird gezeigt, wie die Pandemie das Strafverfahren beeinflusst und welche Herausforderungen sich für die Justiz stellen.
Im dritten Kapitel geht es um die Auswirkungen des § 10 EGStPO auf das Strafverfahren. Hier wird die Ausgangssituation, die Einführung und der Inhalt des § 10 EGStPO betrachtet. Es werden die Auswirkungen auf die Hauptverhandlung, den Beschleunigungsgrundsatz und den Öffentlichkeitsgrundsatz erläutert.
Das vierte Kapitel analysiert die Auswirkungen der Pandemie auf Haftsachen. Es werden die Untersuchungshaft im Allgemeinen und die Besonderheiten während der Pandemie beleuchtet. Außerdem werden die Auswirkungen auf Verjährungsfristen im Allgemeinen und während der Pandemie betrachtet.
Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit dem Umgang mit Strafgefangenen. Es wird die Situation in Deutschland und im Ausland dargestellt.
Das sechste Kapitel untersucht den Vollzug von Strafbefehlen. Es werden das Strafbefehlsverfahren im Allgemeinen und die Besonderheiten während der Pandemie betrachtet.
Schlüsselwörter
COVID-19-Pandemie, Strafverfahren, § 10 EGStPO, Sitzungspolizeiliche Maßnahmen, Gefahrenpotential, Gesichtsverhüllung, Insolvenzantragspflicht, Hauptverhandlung, Beschleunigungsgrundsatz, Öffentlichkeitsgrundsatz, Untersuchungshaft, Verjährungsfristen, Strafgefangene, Strafbefehlsverfahren.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2021, Das Strafverfahren während der Corona-Pandemie. Unter Einbeziehung des § 10 EGStPO, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1130873