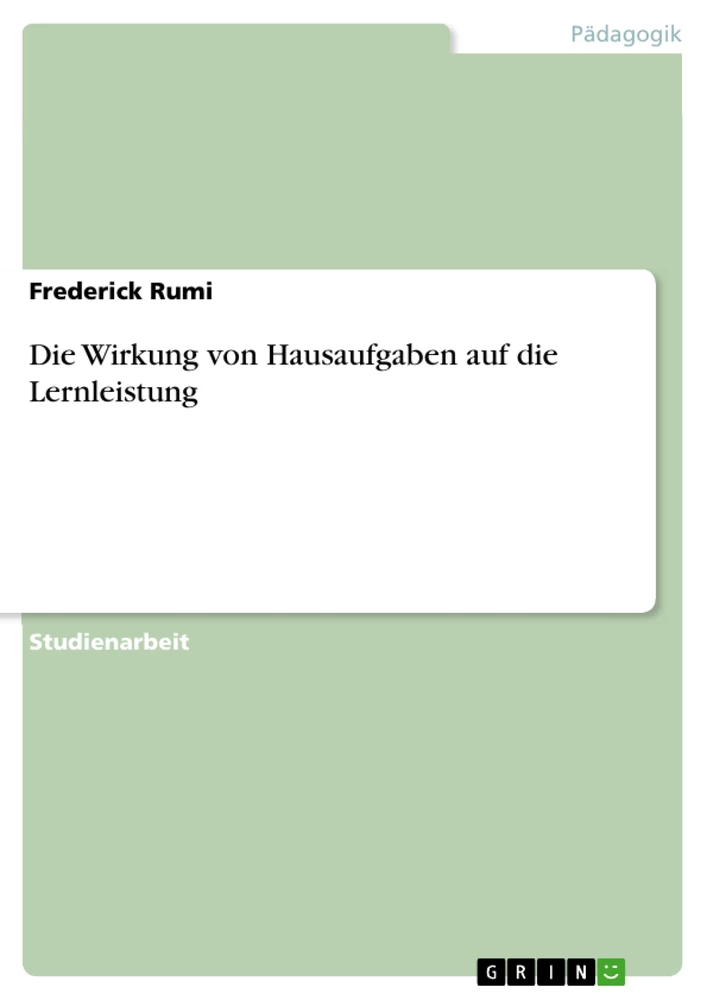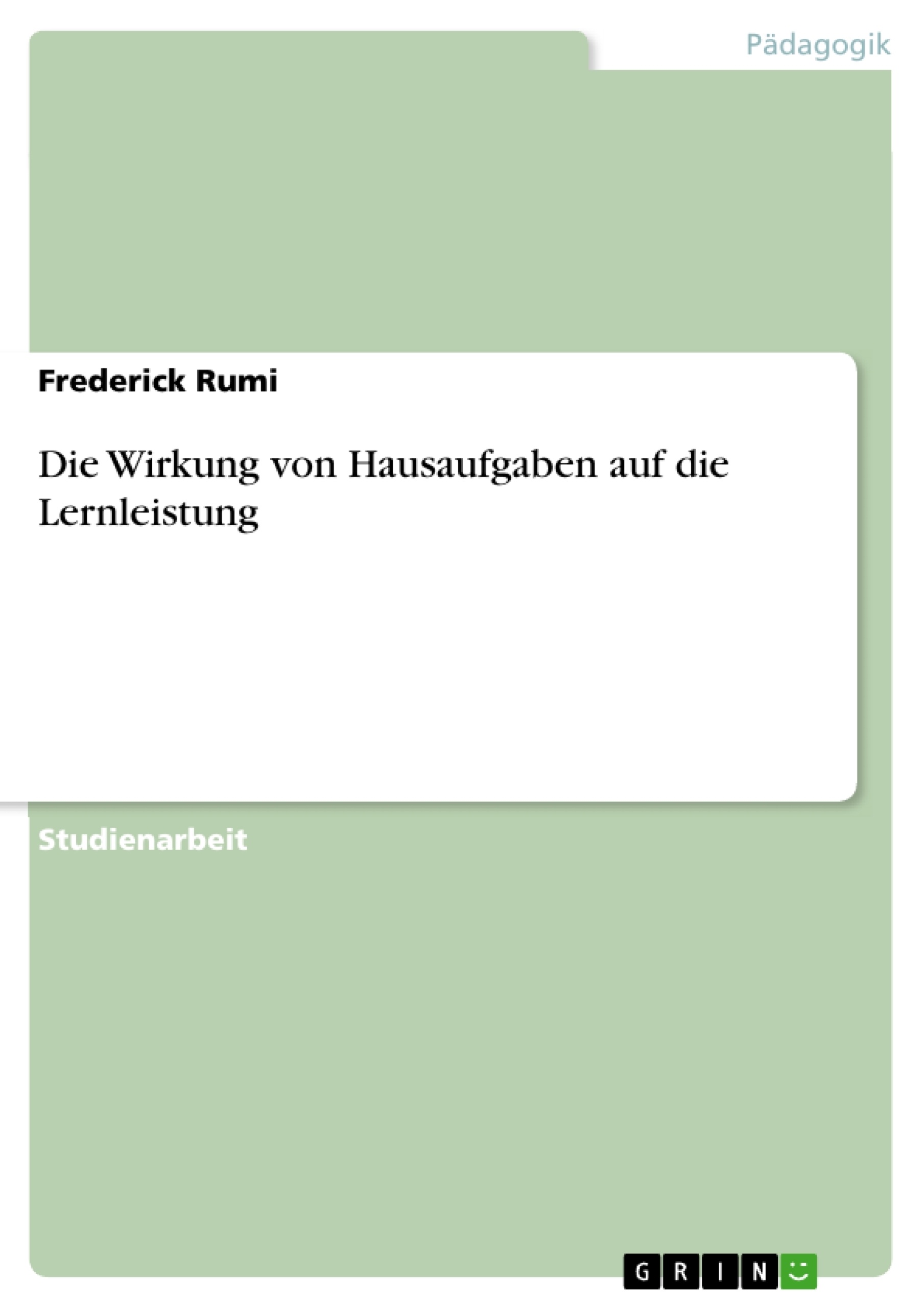Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Wirkung von Hausarbeiten auf die Lernleistung von Schülern. Einige Argumente, die von Hausaufgabengegnern vorgebracht werden, sind zum Beispiel, dass sich Hausaufgaben negativ auf die motorische Entwicklung auswirken, da die Kinder so auch am Nachmittag einige Stunden zusätzlich sitzen müssen. Auch eine negative Auswirkung auf die Beziehung zwischen den Kindern und den Eltern wird Hausaufgaben nachgesagt.
Zudem stellt sich auch die Frage, ob Kinder aus schwächeren sozialen Milieus (aufgrund der Rahmenbedingungen, zum Beispiel Aufpassen auf die jüngeren Geschwister oder Mithelfen im Haushalt) benachteiligt werden. Befürworter von Hausaufgaben sehen darin dagegen oft eine Voraussetzung für das Lernen des Schulstoffes oder zur Verbesserung des Zeitmanagements der Kinder. Von entscheidender Bedeutung bei diesem Thema ist die Frage, ob sich Hausaufgaben positiv auf die Lernleistung von Schülern auswirken.
Um sich diesem Thema anzunähern, wird zunächst betrachtet, was man überhaupt unter Lernen versteht. Anschließend wird der Begriff „Hausaufgaben“ definiert und kurz auf die verschiedenen Funktionen davon eingegangen. Als nächstes wirft diese Arbeit einen kurzen Blick darauf, was bei der Hausaufgabenvergabe beachtet werden sollte. Da diese Aufgaben (wie der Name schon sagt) zu Hause bearbeitet werden und die Kinder hier oft Unterstützung von den Eltern erhalten, wird auch diese Thematik beleuchtet. Im Anschluss rückt die Frage, ob sich Hausaufgaben auf die Lernleistung von Schülern auswirken, in den Fokus.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lernen
- Hausaufgaben
- Funktionen von Hausaufgaben
- Hausaufgabenvergabe
- Unterstützung durch die Eltern
- Wirkung auf die Lernleistung
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Wirkung von Hausaufgaben auf die Lernleistung von Schülern. Sie befasst sich mit den verschiedenen Funktionen von Hausaufgaben, der Hausaufgabenvergabe und der Unterstützung durch Eltern. Zudem wird die Frage geklärt, ob Hausaufgaben einen positiven Einfluss auf die Lernleistung haben.
- Definition des Begriffs "Lernen" und verschiedene Arten von Wissen
- Funktionen und Formen von Hausaufgaben
- Die Rolle von Eltern bei der Hausaufgabenbetreuung
- Der Einfluss von Hausaufgaben auf die Lernleistung
- Kritische Diskussion der Vor- und Nachteile von Hausaufgaben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik Hausaufgaben und beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven von Schülern, Eltern und Lehrern. Anschließend wird der Begriff "Lernen" definiert und verschiedene Arten von Wissen erläutert, die in der Schule erworben werden können. Im dritten Kapitel werden Hausaufgaben näher betrachtet: Ihre Funktionen, die Vergabepraxis und die Rolle der Eltern bei der Unterstützung der Kinder. Das vierte Kapitel untersucht den Einfluss von Hausaufgaben auf die Lernleistung. Die Arbeit schließt mit einer kritischen Diskussion und einem Fazit.
Schlüsselwörter
Hausaufgaben, Lernleistung, Funktionen, Hausaufgabenvergabe, Elternsupport, selbstreguliertes Lernen, deklaratives Wissen, prozedurales Wissen, metakognitives Wissen.
- Quote paper
- Frederick Rumi (Author), 2021, Die Wirkung von Hausaufgaben auf die Lernleistung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1130988