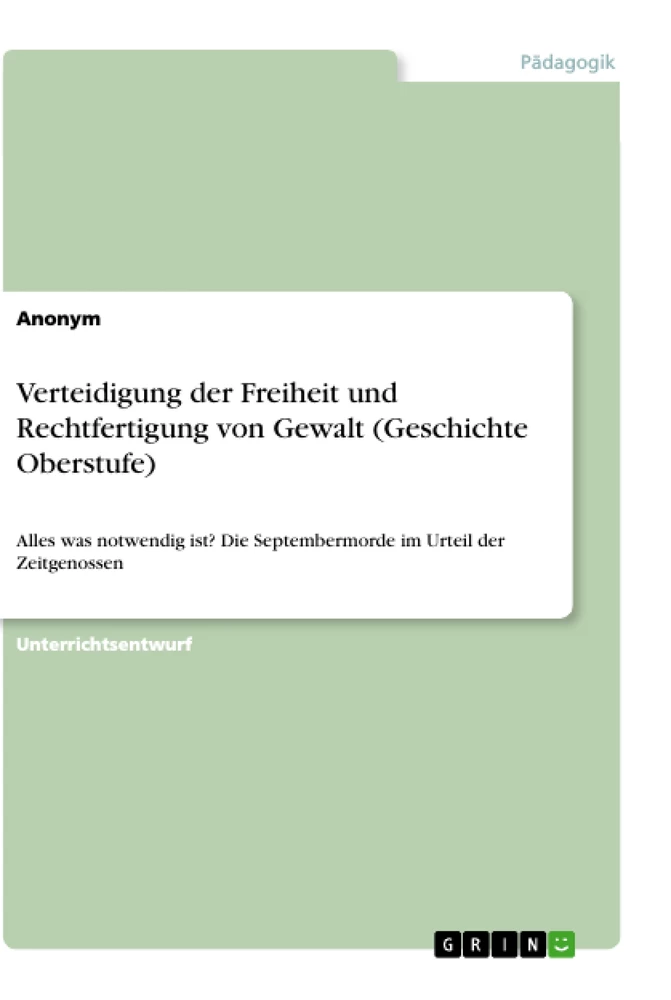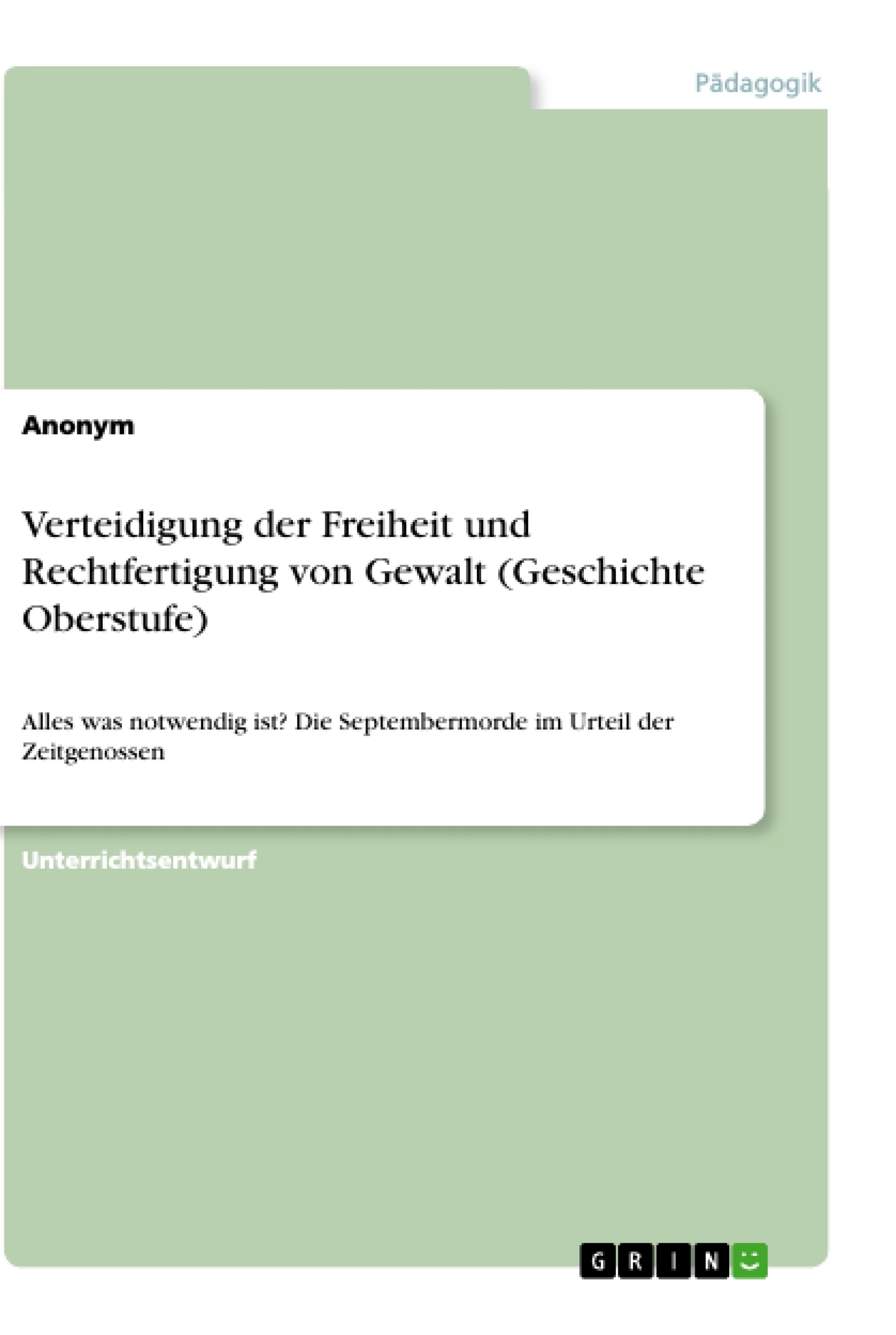Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um einen Unterrichtsentwurf für die gymnasiale Oberstufe im Fach Geschichte. Thematisch beschäftigt sich die Arbeit dabei mit der Französischen Revolution und den Septembermorden des Jahres 1792.
Die SuS untersuchen die zeittypischen unterschiedlichen Bewertungen der Septembermorde des Jahres 1792 anhand der Briefe zweier Zeitgenossen und beurteilen die darin vorgenommene Verurteilung der Gewalt sowie die Rechtfertigung ihrer Notwendigkeit vor dem Hintergrund der Menschen- und Bürgerrechte. Im Anschluss daran beziehen sie in Bezug auf gegenwärtige Protestbewegungen Stellung zur Rechtfertigung von Gewalt zur Durchsetzung vorgeblich
fortschrittlicher Politik.
Inhaltsverzeichnis
- Didaktisches Zentrum
- Analyse der Lerngruppe und der Lernausgangslage
- Didaktische Analyse der Reihe
- Didaktische Analyse der Stunde mit Materialanalyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert eine Unterrichtsreihe zur Französischen Revolution, insbesondere die Septembermorde von 1792. Ziel ist die Förderung der Urteils- und Orientierungskompetenz der Schüler durch die Auseinandersetzung mit dem Spannungsfeld zwischen der Verteidigung von Freiheit und der Rechtfertigung von Gewalt.
- Die Septembermorde von 1792 als Beispiel für revolutionäre Gewalt
- Das Spannungsverhältnis zwischen Freiheitsrechten und deren Einschränkung zur Verteidigung der Freiheit
- Die Bewertung revolutionärer Gewalt aus unterschiedlichen Perspektiven
- Die Relevanz der Thematik für gegenwärtige gesellschaftliche Diskurse
- Förderung von Urteils- und Orientierungskompetenz bei Schülern
Zusammenfassung der Kapitel
Didaktisches Zentrum: Dieses Kapitel beschreibt den zentralen Fokus der Unterrichtsstunde: die widersprüchliche Bewertung der Septembermorde 1792 anhand von Briefen der Augenzeugen Rosalie Julien und Konrad Oelsner. Die Schüler sollen analysieren, wie unterschiedliche Perspektiven auf die Septembermorde mit dem Verhältnis zu Menschen- und Bürgerrechten zusammenhängen und die Legitimität revolutionärer Gewalt diskutieren. Der Schwerpunkt liegt auf der Förderung der Urteils- und Orientierungskompetenz.
Analyse der Lerngruppe und der Lernausgangslage: Dieses Kapitel beschreibt die Lerngruppe, ihre Motivation, ihr Vorwissen und ihren Kompetenzstand in Bezug auf historische Analyse und Werturteilsbildung. Die Schüler zeigen ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden und Interesse an Herrschaft und Unterdrückung. Die Analyse deckt jedoch auch einen Förderbedarf in der Reflexion eigener Werte und der differenzierten Auseinandersetzung mit alternativen Wertungen auf. Die Schüler neigen zu vereinfachenden Erklärungen historischen Handelns und haben Schwierigkeiten, das Spannungsverhältnis zwischen Freiheitseinschränkungen und -bewahrung zu reflektieren. Die Kapitel beschreibt auch die überfachlichen Kompetenzen der Lerngruppe und deren Herausforderungen im Hinblick auf Zeitmanagement und Selbstorganisation.
Didaktische Analyse der Reihe: Dieses Kapitel erläutert den didaktischen Ansatz der gesamten Unterrichtsreihe zur Französischen Revolution. Die Reihe konzentriert sich auf die bleibende Bedeutung der Menschen- und Bürgerrechte im Kontext der gewaltsamen Ereignisse von 1792-1794. Das Spannungsfeld zwischen der Verwirklichung von Freiheitswerten und deren Beschränkung zur Verteidigung der Freiheit wird als zentrales Problem moderner Demokratien herausgestellt. Die Gegenwartsrelevanz der Thematik wird durch Bezugnahme auf aktuelle gesellschaftliche Diskurse über die Einschränkung von Demonstrationsrechten und politische Repression hervorgehoben. Die Reihe zielt darauf ab, die Orientierungskompetenz der Schüler zu fördern, indem sie diese zu einer vertieften Reflexion ihres eigenen Verhältnisses zu den Menschen- und Bürgerrechten anregt.
Didaktische Analyse der Stunde mit Materialanalyse: Dieses Kapitel beschreibt die didaktische Struktur der Unterrichtsstunde zu den Septembermorden. Der Einstieg erfolgt über ein Foto einer gewaltsamen Demonstration, um den Schülern den emotionalen Kontext der Gewalt näher zu bringen. Die Analyse von Briefauszügen der Zeitzeugen Rosalie Jullien und Konrad Oelsner ermöglicht eine differenzierte Betrachtung der widersprüchlichen Bewertungen der Septembermorde. Das Kapitel betont die Bedeutung dieser Stunde als Ausgangspunkt des Orientierungsprozesses innerhalb der gesamten Reihe und hebt die didaktische Struktur hervor, die dem Lernprozessmodell von Gautschi folgt.
Schlüsselwörter
Französische Revolution, Septembermorde 1792, Revolutionäre Gewalt, Menschenrechte, Bürgerrechte, Werturteilsbildung, Orientierungskompetenz, Freiheit, Legitimität, Gegenwartsbezug, Didaktik, Geschichtsunterricht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Unterrichtsreihe: Die Septembermorde von 1792
Was ist der Gegenstand dieser Unterrichtsreihe?
Die Unterrichtsreihe analysiert die Septembermorde von 1792 im Kontext der Französischen Revolution. Der Fokus liegt auf dem Spannungsfeld zwischen der Verteidigung von Freiheit und der Rechtfertigung von Gewalt.
Welche Ziele verfolgt die Reihe?
Die Reihe zielt darauf ab, die Urteils- und Orientierungskompetenz der Schüler zu fördern. Die Schüler sollen lernen, revolutionäre Gewalt aus verschiedenen Perspektiven zu bewerten und die Relevanz der Thematik für gegenwärtige gesellschaftliche Diskurse zu erkennen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Reihe behandelt die Septembermorde als Beispiel für revolutionäre Gewalt, das Spannungsverhältnis zwischen Freiheitsrechten und deren Einschränkung, die Bewertung revolutionärer Gewalt aus unterschiedlichen Perspektiven und die Relevanz der Thematik für aktuelle gesellschaftliche Debatten.
Wie ist die Reihe strukturiert?
Die Reihe umfasst mehrere Kapitel: Didaktisches Zentrum (Fokus auf widersprüchliche Bewertungen der Septembermorde anhand von Briefen), Analyse der Lerngruppe und der Lernausgangslage (Beschreibung der Schüler, ihres Vorwissens und ihrer Kompetenzen), Didaktische Analyse der Reihe (Gesamtansatz der Reihe), und Didaktische Analyse der Stunde mit Materialanalyse (Struktur der Unterrichtsstunde zu den Septembermorden, Materialanalyse von Briefen von Zeitzeugen).
Welche Materialien werden verwendet?
Ein zentrales Material sind Briefe von Zeitzeugen wie Rosalie Julien und Konrad Oelsner, die unterschiedliche Perspektiven auf die Septembermorde beleuchten. Zusätzlich wird ein Foto einer gewaltsamen Demonstration im Unterricht eingesetzt.
Welche didaktischen Ansätze werden verwendet?
Die Reihe nutzt einen didaktischen Ansatz, der die bleibende Bedeutung der Menschen- und Bürgerrechte im Kontext der gewaltsamen Ereignisse von 1792-1794 betont. Das Lernprozessmodell von Gautschi wird als Grundlage für die Unterrichtsgestaltung herangezogen. Der Gegenwartsbezug wird durch die Verknüpfung mit aktuellen gesellschaftlichen Diskursen hergestellt.
Welche Kompetenzen sollen die Schüler erwerben?
Die Schüler sollen ihre Urteils- und Orientierungskompetenz verbessern, indem sie lernen, historische Ereignisse differenziert zu analysieren, verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen und ihre eigenen Werte und Überzeugungen zu reflektieren. Die Auseinandersetzung mit der Thematik soll zu einer vertieften Reflexion des eigenen Verhältnisses zu den Menschen- und Bürgerrechten anregen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Französische Revolution, Septembermorde 1792, Revolutionäre Gewalt, Menschenrechte, Bürgerrechte, Werturteilsbildung, Orientierungskompetenz, Freiheit, Legitimität, Gegenwartsbezug, Didaktik, Geschichtsunterricht.
Welche Lerngruppe wird adressiert?
Die Analyse beschreibt die spezifische Lerngruppe, ihr Vorwissen, ihre Motivation und ihre Herausforderungen in Bezug auf historische Analyse, Werturteilsbildung, Zeitmanagement und Selbstorganisation. Es wird ein Förderbedarf in der Reflexion eigener Werte und der differenzierten Auseinandersetzung mit alternativen Wertungen aufgezeigt.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Verteidigung der Freiheit und Rechtfertigung von Gewalt (Geschichte Oberstufe), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1131036