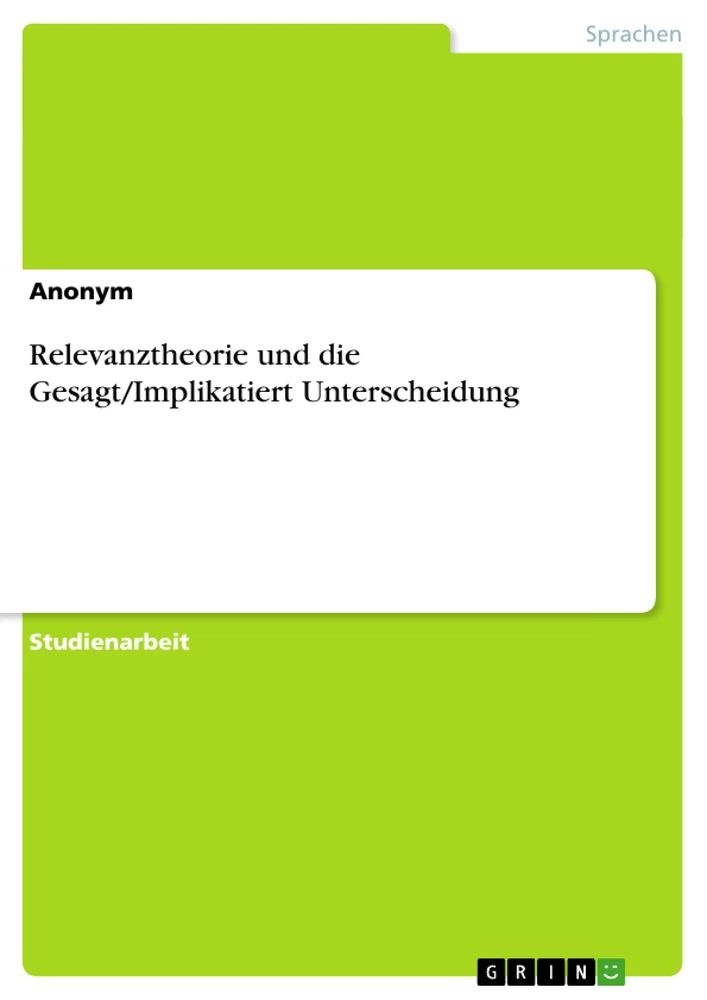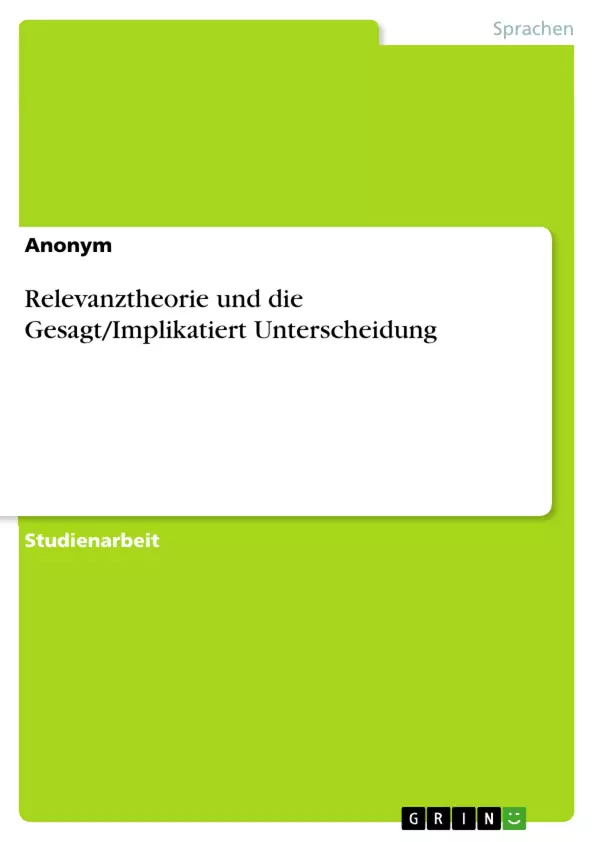Die Relevanztheorie (RT) leitet sich aus dem Kooperationsprinzip und den
Konversationsmaximen von Grice ab.
(1) Kooperationsprinzip (Grice, 1975): Die Beteiligten gestalten ihre Äußerung so, wie
es zum Erreichen des Zwecks des Kommunikationsaktes erforderlich ist.
Demnach muss ein Sprecher darauf vertrauen können, dass sein Zuhörer die richtigen
Schlussfolgerungen aus seiner Äußerung zieht. Durch die Maxime der Quantität (Sei so
informativ wie nötig und möglich!), Qualität (Sage nichts Falsches!), Relevanz (Sei relevant!)
und Modalität (Sei klar!) wird dies möglich. Sperber und Wilson haben Grice’ Theorie
weiterentwickelt. Sie nehmen an, dass von den vier Konversationsmaximen nur die Maxime
der Relevanz nötig sei, damit Sprecher und Hörer ihr gemeinsames Ziel in der
Kommunikation erreichen. Ihr Relevanzprinzip besagt, dass sich jeder Akt der ostensiven
Kommunikation mit der Annahme der eigenen optimalen Relevanz vollzieht. Anders als bei
Grice werden Äußerungen nicht als Kode, sondern als ostensiver Stimulus gesehen, der beim
Hörer einen pragmatischen Folgerungsprozess auslöst, der durch die Erwartung an die
optimale Relevanz gesteuert wird. Die unterschiedlichen Annahmen von Grice und Sperber
und Wilson führen auch zu unterschiedlichen Ansichten in Bezug auf den kommunikativen
Gehalt von Äußerungen und auf das, was gesagt oder gemeint ist. In den folgenden
Abschnitten werde ich in Anlehnung an den Text Relevance Theory and the
Saying/Implicating Distinction von Robyn Carston auf diese Unterschiede näher eingehen. Für die RT sind zwei Unterscheidungen wichtig. Zum einen der Unterschied zwischen der
linguistisch entschlüsselten und der pragmatisch gefolgerten Bedeutung, der als
Semantik/Pragmatik-Unterscheidung betrachtet werden kann. Die semantische Repräsentation
dient als Input für den pragmatischen Prozessor, der durch ostensive Stimuli ausgelöst wird.
Der linguistische Prozessor nutzt einen Kode in Form einer natürlichen Sprache, der
pragmatische tut dies nicht. Die zweite Unterscheidung ist die zwischen Explikatur und
Implikatur, welche nach Sperber und Wilson (1986) folgendermaßen definiert sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entschlüsselung/Folgerung & Explikatur/Implikatur
- 3. Pragmatische Aspekte von Explikaturen
- 4. Konversationelle Implikaturen
- 5. Explikatur oder generalisierte konversationelle Implikatur?
- 6. Skalare Folgerungen
- 7. Semantik, was gesagt ist und Explikatur
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Relevanztheorie (RT) von Sperber und Wilson im Vergleich zu Grice' Konversationsmaximen. Sie analysiert die Unterscheidung zwischen "gesagt" und "gemeint" im Kontext der RT und beleuchtet die Rolle pragmatischer Prozesse bei der Bedeutungskonstitution.
- Relevanztheorie vs. Grice'sche Maximen
- Unterscheidung zwischen Explikatur und Implikatur
- Pragmatische Aspekte der Explikaturbildung (Disambiguierung, Sättigung, freie Anreicherung)
- Der Zusammenhang zwischen Explikatur und konversationellen Implikaturen
- Die Rolle des Kontextes bei der Bedeutungskonstitution
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Relevanztheorie (RT) und Grice' Konversationsmaximen ein. Sie hebt die zentrale Rolle der Relevanzmaxime in der RT hervor und zeigt den Unterschied in der Betrachtung von Äußerungen als Kode (Grice) versus ostensiven Stimuli (Sperber & Wilson) auf. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen "gesagt" und "gemeint" und der angekündigten Auseinandersetzung mit Carstons Arbeit zur Saying/Implicating Distinction.
2. Entschlüsselung/Folgerung & Explikatur/Implikatur: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe Explikatur und Implikatur nach Sperber und Wilson. Es wird der Unterschied zwischen linguistisch entschlüsselter und pragmatisch gefolgerter Bedeutung erläutert, wobei die semantische Repräsentation als Input für den pragmatischen Prozessor fungiert. Anhand eines Beispiels (Mary und ihre Universität) wird die Unterscheidung zwischen Explikatur (expliziter, logisch-semantischer Inhalt) und Implikatur (impliziter, kontextuell abhängiger Schlussfolgerung) verdeutlicht. Der Unterschied zwischen der verschlüsselten Bedeutung und dem, was "gesagt" ist, wird hervorgehoben, was einen wichtigen Unterschied zur Grice'schen Theorie darstellt.
3. Pragmatische Aspekte von Explikaturen: Dieses Kapitel beschreibt vier pragmatische Aspekte von Explikaturen: Disambiguierung, Sättigung, freie Anreicherung und ad-hoc-Konzeptkonstruktion. Disambiguierung und Sättigung sind essentiell für die Bestimmung des expliziten Inhalts, wie am Beispiel von Redewendungen gezeigt wird. Die freie Anreicherung wird als optionaler Prozess des Hinzufügens von konzeptuellem Material zur logischen Form erläutert. Anhand von Beispielsätzen (Paracetamol, Gehirn, Dusche) wird die Notwendigkeit pragmatischer Prozesse zur Bestimmung des expliziten Inhalts und die Rolle der Konversationsmaximen diskutiert. Die Uneinigkeit bezüglich der Rolle der Konversationsmaximen bei der Derivation des Gesagten wird angesprochen.
Schlüsselwörter
Relevanztheorie, Grice'sche Konversationsmaximen, Explikatur, Implikatur, Pragmatik, Semantik, gesagt/gemeint, Disambiguierung, Sättigung, freie Anreicherung, Kontext, Bedeutungskonstitution.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Relevanztheorie und Bedeutungskonstitution
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit vergleicht die Relevanztheorie (RT) von Sperber und Wilson mit Grice' Konversationsmaximen. Sie analysiert die Unterscheidung zwischen "gesagt" und "gemeint" im Kontext der RT und untersucht die Rolle pragmatischer Prozesse bei der Bedeutungskonstitution. Ein zentraler Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen Explikatur und Implikatur.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den Vergleich von Relevanztheorie und Grice'schen Maximen, die Unterscheidung zwischen Explikatur und Implikatur, pragmatische Aspekte der Explikaturbildung (Disambiguierung, Sättigung, freie Anreicherung), den Zusammenhang zwischen Explikatur und konversationellen Implikaturen, und die Rolle des Kontextes bei der Bedeutungskonstitution. Die Arbeit diskutiert auch die Saying/Implicating Distinction nach Carston.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus acht Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die RT und Grice'sche Maximen ein und hebt den Unterschied in der Betrachtung von Äußerungen hervor. Kapitel 2 (Entschlüsselung/Folgerung & Explikatur/Implikatur) definiert Explikatur und Implikatur und erläutert den Unterschied zwischen linguistisch entschlüsselter und pragmatisch gefolgerter Bedeutung. Kapitel 3 (Pragmatische Aspekte von Explikaturen) beschreibt Disambiguierung, Sättigung, freie Anreicherung und ad-hoc-Konzeptkonstruktion. Die weiteren Kapitel vertiefen diese Themen und beleuchten den Zusammenhang zwischen Semantik, dem Gesagten und der Explikatur. Kapitel 8 bildet das Fazit.
Was sind Explikatur und Implikatur nach Sperber und Wilson?
Explikatur beschreibt den expliziten, logisch-semantischen Inhalt einer Äußerung, während Implikatur den impliziten, kontextuell abhängigen Schlussfolgerung darstellt. Der Unterschied wird anhand von Beispielen verdeutlicht und im Vergleich zur Grice'schen Theorie eingeordnet.
Welche Rolle spielt der Kontext bei der Bedeutungskonstitution?
Der Kontext spielt eine entscheidende Rolle bei der Bedeutungskonstitution, insbesondere bei der Bildung von Implikaturen und der pragmatischen Anreicherung von Explikaturen. Die Arbeit untersucht, wie Kontext die Interpretation von Äußerungen beeinflusst und welche Rolle er bei der Bestimmung des "Gemeinten" spielt.
Welche pragmatischen Aspekte von Explikaturen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die pragmatischen Aspekte der Disambiguierung (Beseitigung von Mehrdeutigkeiten), Sättigung (Ergänzung von fehlenden Informationen), freie Anreicherung (Hinzufügung von konzeptuellem Material) und ad-hoc-Konzeptkonstruktion. Diese Prozesse sind essenziell für die Bestimmung des expliziten Inhalts einer Äußerung.
Wie werden die Relevanztheorie und Grice'sche Maximen verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Relevanztheorie mit Grice'schen Konversationsmaximen, wobei der Unterschied in der Betrachtung von Äußerungen als Kode (Grice) versus ostensiven Stimuli (Sperber & Wilson) im Vordergrund steht. Der Fokus liegt auf den Unterschieden in der Bestimmung von "gesagt" und "gemeint".
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die Schlüsselwörter umfassen: Relevanztheorie, Grice'sche Konversationsmaximen, Explikatur, Implikatur, Pragmatik, Semantik, gesagt/gemeint, Disambiguierung, Sättigung, freie Anreicherung, Kontext, Bedeutungskonstitution.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2006, Relevanztheorie und die Gesagt/Implikatiert Unterscheidung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113121