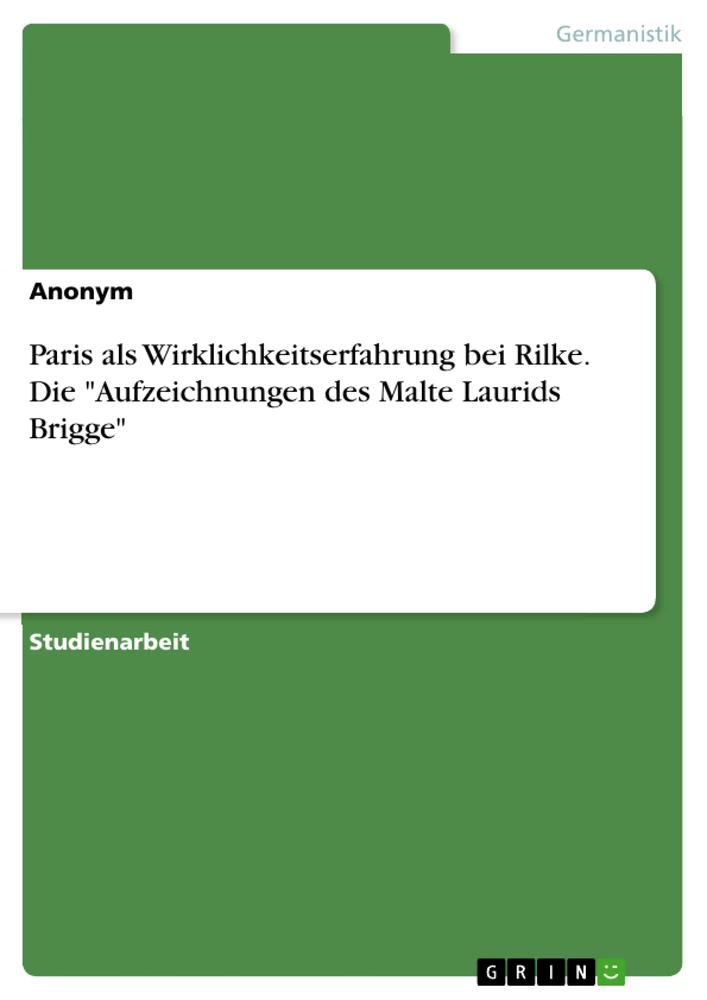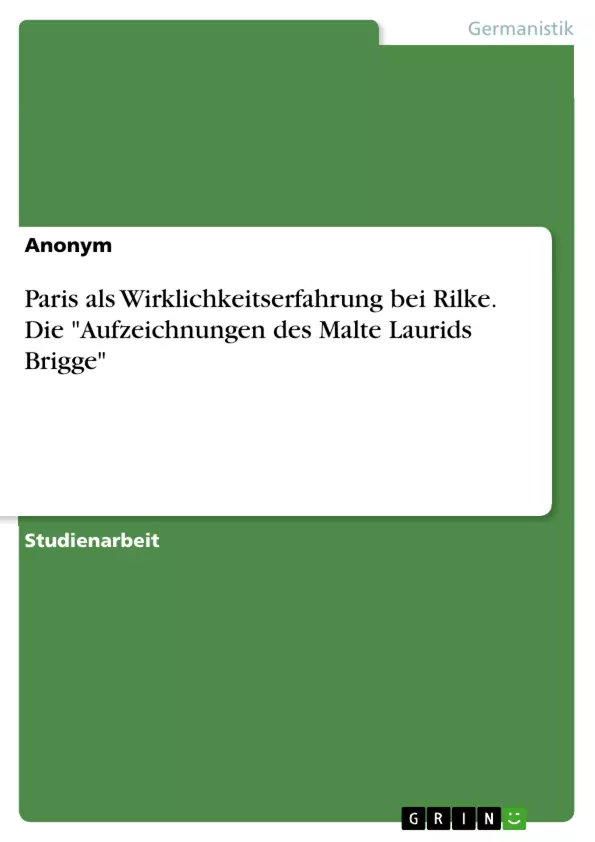Bei der Untersuchung stützt sich die vorliegende Hausarbeit auf zwei Ausgangsthesen: Zum einen ist Paris, sowohl für Rainer Maria Rilke als auch für Malte Laurids Brigge, das auslösende Moment für das Schreiben überhaupt. Zum anderen nimmt der Charakter der Großstadt Paris, die Erfahrung der städtischen Wirklichkeit, unmittelbaren Einfluss auf die Form des Werkes. Zuvor soll jedoch die Problematik einer Einordnung des Romans in die Erzähltheorie beleuchtet und in den soziokulturellen sowie biografischen Kontext der Entstehung der Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge eingeführt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einordnung der Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge in die Narrativik
- Revolutionen der Moderne und ihre Auswirkungen
- Urbanisierung und Technisierung
- Rilkes Erfahrung mit der „Moderne“: Der Parisaufenthalt 1902/03
- Maltes Pariser Wirklichkeitserfahrung
- Das konstituierende Moment seiner Aufzeichnungen: Malte lernt „sehen“
- Schlüsselerfahrungen und Erlebnismotive
- Der Einfluss der Pariser Wirklichkeit auf die Form der Aufzeichnungen
- Der Verlust der Erzählfähigkeit und die Polarität Stadt - Land
- Die urbane Wahrnehmungsweise als formgebendes Prinzip in den städtischen Aufzeichnungen
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die „Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ von Rainer Maria Rilke und beleuchtet, wie die Erfahrung des Parisaufenthalts sowohl das Schreiben des Romans als auch dessen Form beeinflusst. Die Arbeit untersucht die Interaktion von Rilkes und Maltes subjektiver Wahrnehmung der Großstadt und den soziokulturellen Veränderungen im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts.
- Rilkes persönliches Erleben in Paris als auslösender Moment für die Entstehung der Aufzeichnungen
- Die Bedeutung des Großstadtlebens für die Gestaltung der Erzählstruktur
- Der Einfluss der städtischen Wirklichkeit auf Maltes Wahrnehmung und die Form der Aufzeichnungen
- Die Verbindung zwischen der „Moderne“ und dem Wandel des Romans
- Die Grenzen der traditionellen Erzähltheorie in Bezug auf die Aufzeichnungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Rilkes anfängliche Ablehnung von Paris dar und führt die Hauptfigur Malte Laurids Brigge ein, dessen Reflexionen und Erinnerungen den Kern der „Aufzeichnungen“ bilden. Das erste Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten, den Roman in die Erzähltheorie einzuordnen. Die „Aufzeichnungen“ erfüllen die traditionellen Anforderungen an einen Roman nicht vollständig, da sie keine feste Chronologie, eine kausale Abfolge von Ereignissen oder ein erzähltes Ende aufweisen.
Kapitel 3 betrachtet die Revolutionen der Moderne, insbesondere Urbanisierung und Technisierung, und deren Einfluss auf Rilkes Parisaufenthalt und die „Aufzeichnungen“. Kapitel 4 untersucht Maltes Erfahrung in Paris und wie er „sehen“ lernt. Kapitel 5 analysiert, wie der Verlust der Erzählfähigkeit und die städtische Wahrnehmung die Form der Aufzeichnungen beeinflussen.
Schlüsselwörter
Die „Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“, Rainer Maria Rilke, Paris, Großstadt, Moderne, Urbanisierung, Technisierung, Erzähltheorie, Roman, Anti-Narrativik, subjektive Wahrnehmung, städtische Wirklichkeit, Erlebnismotive, Schlüsselerfahrungen.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 1996, Paris als Wirklichkeitserfahrung bei Rilke. Die "Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1131296