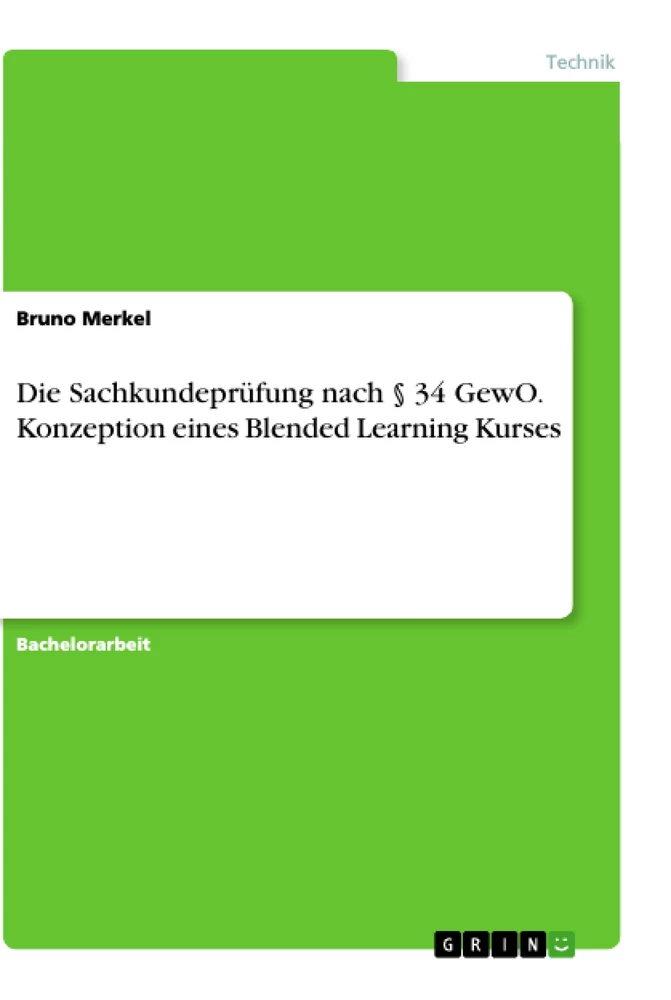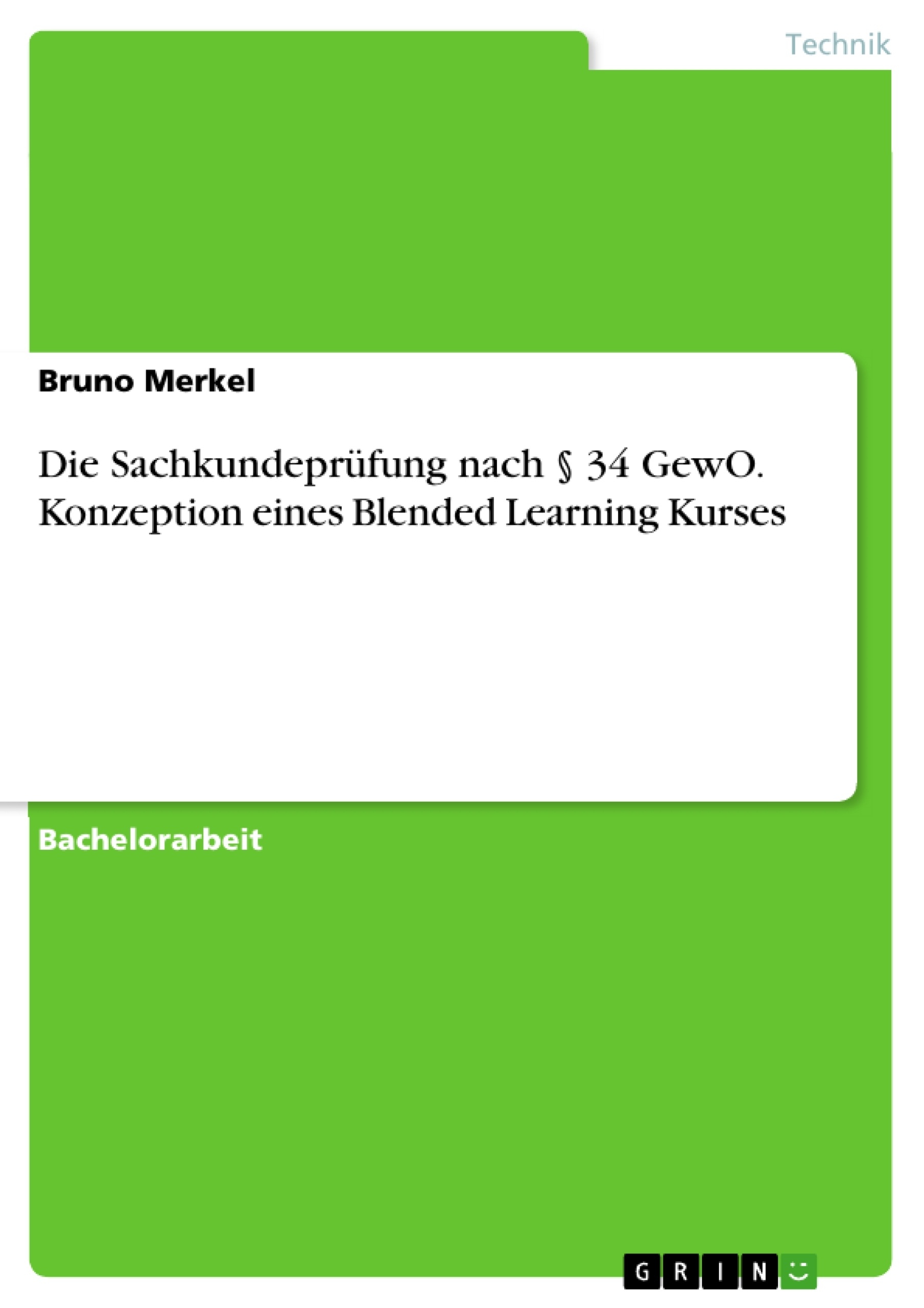Die aktuelle Lage, die durch das Covid-19 Virus hervorgerufen wird, zwingt Unternehmen sowie allmögliche Schulformen und Institutionen zum Lockdown und dazu, neue Kommunikationswege sowie Home-Office-Möglichkeiten einzuschlagen. Dazu gehören auch berufsvorbereitende Maßnahmen und ihre Lehrformen, die es nun aus der Ferne zu schulen gilt. Hinzu kommt der Bedarf an Lehrformen, die es ermöglichen orts- und zeitunabhängig sowie eigenverantwortlich und selbstorganisiert, statt fremdgesteuert zu lernen.
Der Grund für die derartig flankierte Kompetenzentwicklung ist ein Paradigmenwechsel, möglicherweise ausgelöst durch den demographischen Wandel. Ein mögliches Mittel dafür ist das Blended Learning, das in dieser wissenschaftlichen Arbeit primär thematisiert wird. Die SKP gemäß der Verordnung § 34a GewO sowie die dort geforderten Kompetenzen dienen dieser wissenschaftlichen Arbeit als Fallbeispiel und dem BL als Lehr- und Lernform zur Kompetenzentwicklung, die es in dieser Arbeit mit dem Hauptaugenmerk darauf zu untersuchen gilt.
Blended Learning ist eine Mischform aus klassischen und computerunterstützten Lehrmethoden und hält seit geraumer Zeit die Position an der Trendspitze der bevorzugten Lernformen von Unternehmen. Dies ist den empirisch erhobenen Daten der auf Expertenmeinungen basierenden Studie "KI@Ed noch nicht in der Fläche angekommen" zu entnehmen. Die Studienreihe soll unter anderem Aufschluss über die Frage geben, wo die größten geschäftlichen Erfolge zu erwarten sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Herleitung des Themas
- 1.2 Herleitung der Forschungsfrage
- 1.3 Vorstellung der Methodik
- 2. Kompetenzen
- 2.1 Kompetenzbegriff
- 2.2 Normierung der Kompetenzen in der beruflichen Bildung
- 2.3 Modell zur Kompetenzentwicklung
- 2.4 Möglichkeiten der Kompetenzentwicklung
- 2.4.1 Analyse der Zielgruppe
- 2.4.2 Analyse der Vorgaben zur SKP
- 2.4.3 Analyse des Prüfungsablaufs
- 2.4.4 Analyse der Lehrinhalte
- 2.4.5 Analyse der Prüfungsvorbereitung
- 2.4.6 Homo Ludens und Homo Faber
- 2.6 Kompetenzfeststellung und Anreize zur Umsetzung
- 3. Blended Learning
- 3.1 Blended-Learning-Konzept
- 3.2 Einsatz in der Kompetenzentwicklung
- 4. Untersuchungsgegenstand “§ 34a GewO Lern-App”
- 4.1 Forschungsdesign
- 4.2 Erhebungsverfahren
- 4.3 Stichprobenauswahl
- 4.4 Datenaufbereitung und -Auswertung
- 4.5 Gütekriterien und Wahrung ethischer Standards
- 4.6 Ergebnisse
- 4.7 Diskussion
- 5. Fazit
- 5.1 Zusammenfassung und Evaluation der Ergebnisse
- 5.2 Reflexion der Methodik
- 5.3 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit konzipiert einen Blended-Learning-Kurs zur Sachkundeprüfung nach § 34a GewO. Ziel ist die Entwicklung eines effektiven und praxisorientierten Lernprogramms, welches die Kompetenzentwicklung der Teilnehmer optimal unterstützt. Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte, um dieses Ziel zu erreichen.
- Kompetenzentwicklung im Kontext der Sachkundeprüfung § 34a GewO
- Entwicklung eines geeigneten Blended-Learning-Konzepts
- Analyse der Zielgruppe und deren Lernbedürfnisse
- Methoden der Kompetenzfeststellung und -förderung
- Anwendung und Evaluation des entwickelten Kurskonzepts
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, erläutert die Herleitung des Themas und der Forschungsfrage. Es wird die Methodik vorgestellt, die zur Beantwortung der Forschungsfrage verwendet wird. Die Einleitung schafft den Rahmen für die gesamte Arbeit und legt die Grundlage für die folgenden Kapitel.
2. Kompetenzen: Dieses Kapitel befasst sich umfassend mit dem Kompetenzbegriff und dessen Normierung in der beruflichen Bildung. Es präsentiert ein Modell zur Kompetenzentwicklung und analysiert verschiedene Möglichkeiten, diese im Kontext der Sachkundeprüfung nach § 34a GewO zu fördern. Die Analyse der Zielgruppe, der Vorgaben zur Prüfung, des Prüfungsablaufs und der Lehrinhalte bildet den Kern dieses Kapitels. Der Bezug zu den Konzepten "Homo Ludens" und "Homo Faber" wird hergestellt, um die Lernmotivation zu beleuchten. Abschließend werden Methoden zur Kompetenzfeststellung und Anreizsysteme diskutiert.
3. Blended Learning: In diesem Kapitel wird das Blended-Learning-Konzept detailliert beschrieben und dessen Einsatzmöglichkeiten zur Kompetenzentwicklung im Kontext der Sachkundeprüfung untersucht. Es werden verschiedene Aspekte des Blended Learning beleuchtet und deren Anwendbarkeit auf die spezifischen Anforderungen der Zielgruppe analysiert. Der Fokus liegt auf der Optimierung des Lernprozesses durch den gezielten Einsatz verschiedener Lernmethoden und -medien.
4. Untersuchungsgegenstand “§ 34a GewO Lern-App”: Dieses Kapitel beschreibt das Forschungsdesign, die angewendeten Erhebungsverfahren und die Auswahl der Stichprobe. Die Datenaufbereitung und -auswertung werden detailliert dargestellt, ebenso wie die angewandten Gütekriterien und die Wahrung ethischer Standards. Es werden die Ergebnisse der Untersuchung präsentiert und diskutiert. Dieser Abschnitt bildet den empirischen Kern der Arbeit.
Schlüsselwörter
Blended Learning, Kompetenzentwicklung, Sachkundeprüfung § 34a GewO, § 34a GewO Lern-App, Kompetenzbegriff, berufliche Bildung, Lernmethodik, Forschungsdesign, Empirie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Blended-Learning-Arbeit (§ 34a GewO Lern-App)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Konzeption eines Blended-Learning-Kurses zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung nach § 34a GewO. Ziel ist die Entwicklung eines effektiven und praxisorientierten Lernprogramms zur optimalen Unterstützung der Kompetenzentwicklung der Teilnehmer.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte der Kompetenzentwicklung im Kontext der Sachkundeprüfung § 34a GewO, die Entwicklung eines geeigneten Blended-Learning-Konzepts, die Analyse der Zielgruppe und deren Lernbedürfnisse, Methoden der Kompetenzfeststellung und -förderung sowie die Anwendung und Evaluation des entwickelten Kurskonzepts. Es werden der Kompetenzbegriff, seine Normierung in der beruflichen Bildung und verschiedene Modelle zur Kompetenzentwicklung untersucht. Der Einsatz von Blended Learning und die Analyse von "Homo Ludens" und "Homo Faber" im Kontext der Lernmotivation spielen ebenfalls eine Rolle.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (mit Herleitung des Themas und der Forschungsfrage sowie Methodik), Kompetenzen (Kompetenzbegriff, Normierung, Modelle zur Kompetenzentwicklung), Blended Learning (Konzept und Einsatz), Untersuchungsgegenstand „§ 34a GewO Lern-App“ (Forschungsdesign, Erhebungsverfahren, Ergebnisse, Diskussion) und Fazit (Zusammenfassung, Reflexion der Methodik, Ausblick).
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine empirische Forschungsmethode. Kapitel 4 beschreibt detailliert das Forschungsdesign, die Erhebungsverfahren, die Stichprobenauswahl, die Datenaufbereitung und -auswertung, die Gütekriterien und die Wahrung ethischer Standards. Die genaue Methodik wird in der Einleitung und im Fazit reflektiert.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die konkreten Ergebnisse der Untersuchung werden in Kapitel 4 ("Untersuchungsgegenstand “§ 34a GewO Lern-App”) präsentiert und diskutiert. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse findet sich im Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Blended Learning, Kompetenzentwicklung, Sachkundeprüfung § 34a GewO, § 34a GewO Lern-App, Kompetenzbegriff, berufliche Bildung, Lernmethodik, Forschungsdesign, Empirie.
Welche Zielgruppe wird angesprochen?
Die Zielgruppe der entwickelten Lern-App und der Arbeit selbst sind Teilnehmer der Sachkundeprüfung nach § 34a GewO.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit (Kapitel 5) fasst die Ergebnisse zusammen, evaluiert sie, reflektiert die angewandte Methodik und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsarbeiten.
- Quote paper
- Bruno Merkel (Author), 2021, Die Sachkundeprüfung nach § 34 GewO. Konzeption eines Blended Learning Kurses, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1131374