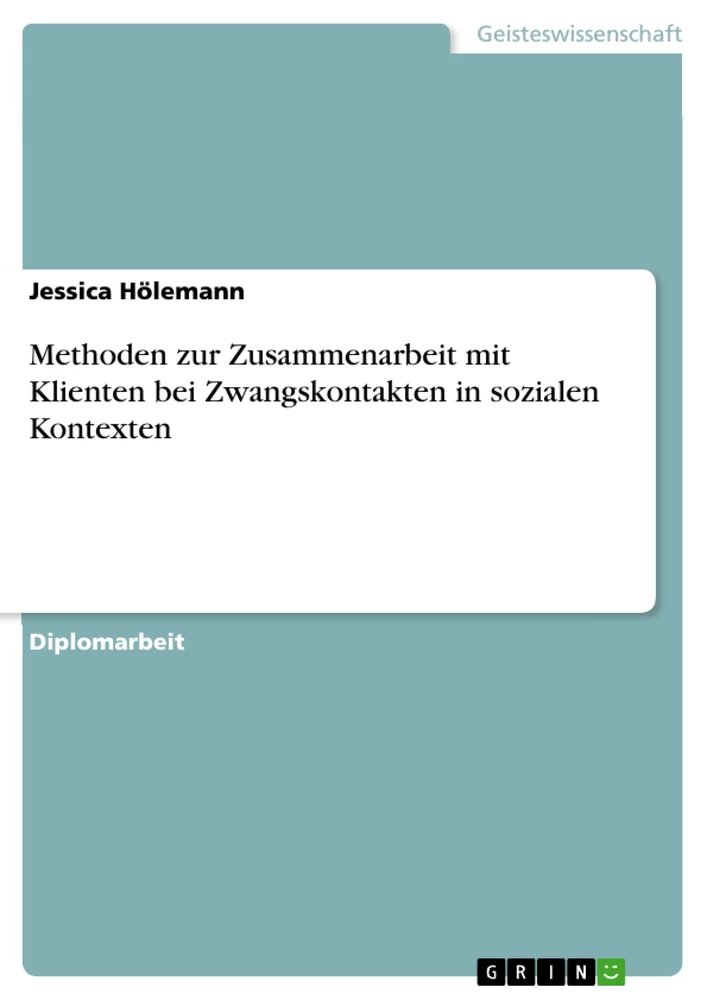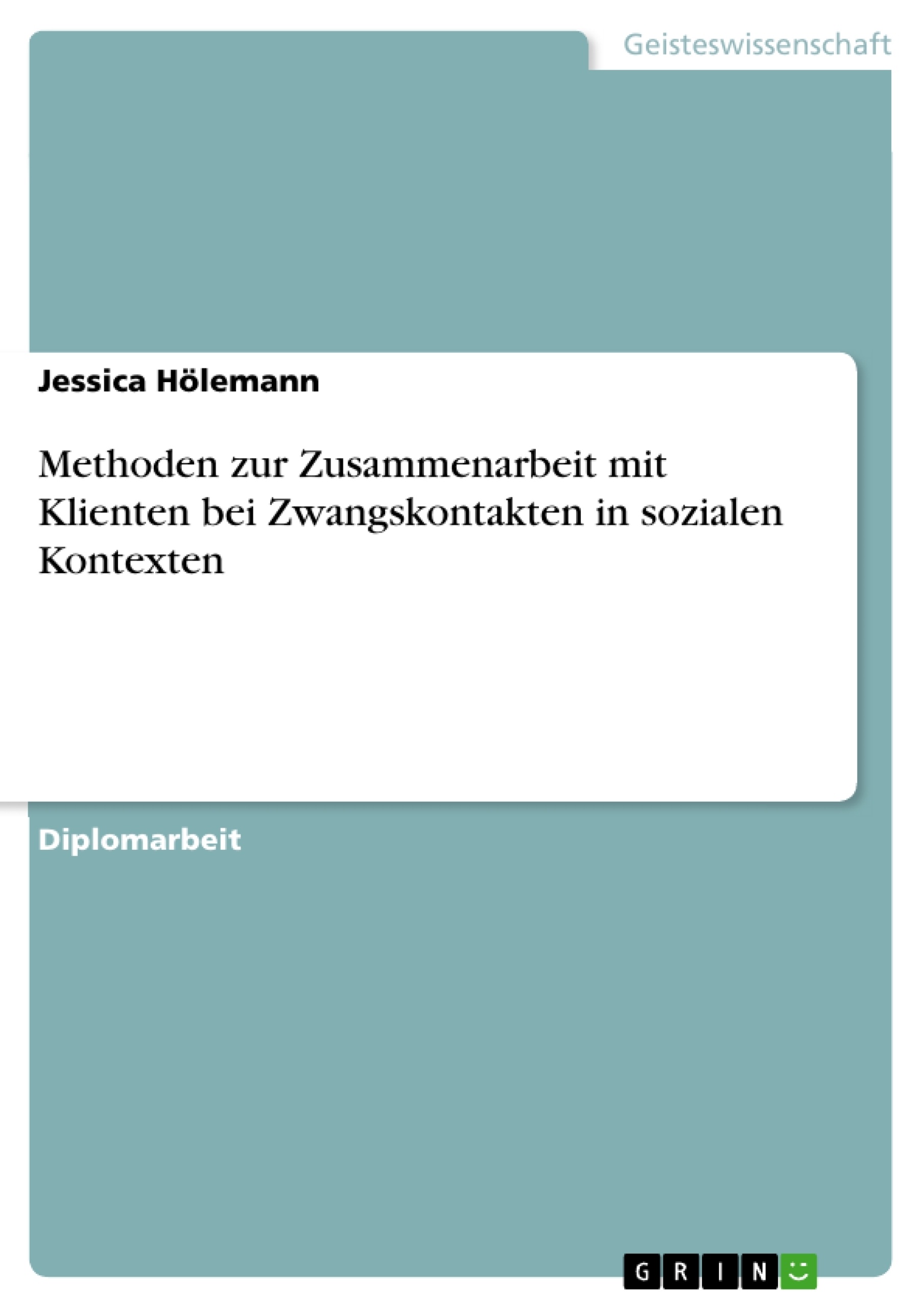Ein häufig genanntes Motiv für die Berufswahl der Sozialen Arbeit ist der Wunsch, Menschen bei Änderungen ihrer schwierigen Lebensumstände zu helfen. Dies soll auf der Basis von freiwilliger Annahme der Hilfe erfolgen, wobei die Betroffenen ausdrücklich das Ziel einer veränderten Situation haben sollen. Es ist die Vorstellung verbreitet, dass sich Klienten und ihre Lebenssituation nur ändern, wenn sie dies auch wirklich anstreben und motiviert sind. Auch ein professioneller Helfer wünscht sich dann eine gewisse Wertschätzung und Dankbarkeit neben der finanziellen Entlohnung.
Im Gegensatz dazu steht allerdings eine große Zahl an Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit, in denen mit Klienten gearbeitet werden muss, die diese Hilfe gar nicht wollen und sich gegen jegliche Mitarbeit wehren – die Arbeit im Zwangskontext. TROTTER formuliert treffende Fragen zu dem Umgang mit dieser Klientel:
- „Wie kann jemandem geholfen werden, der keinerlei Interesse an Hilfe hat?
- Was können Sie mit KlientInnen im Wohlfahrts- oder Justizsystem tun, die zu einer Änderung nicht motiviert sind?
- Wie können Sie jemanden beraten, der nicht einmal bemerkt hat, dass er ein Problem hat?
- Wie arbeiten Sie mit Menschen, deren Wertvorstellungen komplett unterschiedlich von Ihren sind?
- Wie können Sie jemandem gleichzeitig bei der Lösung der Probleme helfen und Macht über ihn ausüben?“
Blickwechsel: Die in den Medien aufgezeigten Fälle von Kindesmisshandlung oder sogar -tötung scheinen in den letzten Wochen kein Ende zu nehmen.
Die Fachkräfte Sozialer Arbeit stehen ebenso zunehmend im Blickfeld der Öffentlichkeit. In Politik und Gesellschaft gibt es aktuelle Diskussionen über Kontroll- und Zwangsmaßnahmen, um solche Fälle rechtzeitig zu erkennen. Der Einsatz von Druck und Zwang wird als ein Weg zu Angeboten der Sozialen Arbeit diskutiert. So könnte die Anzahl von Klienten, die eigentlich keine Hilfe von Fachkräften wollen, durch Maßnahmen wie beispielsweise verpflichtende Erziehungskurse oder Anti-Gewalt-Trainings, noch zunehmen.
Über die Arbeit von Fachkräften der Sozialen Arbeit mit Klienten bei Zwangskontakten schreibt GUMPINGER:
„Soziale Arbeit im Zwangskontext ist die schwierigste und emotional aufwändigste Variante des professionellen Helfens und sie geschieht immer noch in einer methodischen Grauzone mit sehr wenig Unterstützung in Form theoretischer Fundierung und wissenschaftlicher Absicherung.“[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Erläuterung Zwangskontakte
- 2.1 Definition Zwangskontakte
- 2.2 Zwangskontakte in der Sozialen Arbeit
- 2.3 Klienten in Zwangskontakten
- 2.3.1 Initiativen zu Kontaktaufnahmen
- 2.3.2 Formen und Hintergründe von Abwehrverhalten
- 2.4 Sozialarbeiter in Zwangskontakten
- 3. Zwangskontakte im Allgemeinen Sozialdienst
- 3.1 Beschreibung des Allgemeinen Sozialdienstes
- 3.2 Klientel des Allgemeinen Sozialdienstes
- 3.3 Aufgaben der Fachkräfte im Allgemeinen Sozialdienst
- 3.4 Hintergründe für Zwangskontakte im ASD
- 4. Methoden Sozialer Arbeit bei Zwangskontakten
- 4.1 Motivierende Gesprächsführung
- 4.1.1 Hintergründe der motivierenden Gesprächsführung
- 4.1.2 Vorgehen der motivierenden Gesprächsführung
- 4.2 Zusätzliche Handlungsansätze für Zwangskontakte
- 4.1 Motivierende Gesprächsführung
- 5. Rückschlüsse für die Soziale Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht methodische Ansätze für die Zusammenarbeit mit Klienten in Zwangskontakten im Kontext der Sozialen Arbeit. Ziel ist es, eine praxisnahe Arbeitshilfe zu erstellen, die Sozialarbeiter*innen bei der Bewältigung der Herausforderungen in solchen Situationen unterstützt.
- Definition und Herausforderungen von Zwangskontakten in der Sozialen Arbeit
- Analyse der spezifischen Situation von Klienten und Sozialarbeiter*innen in Zwangskontakten
- Methoden der Sozialen Arbeit im Umgang mit Zwangskontakten, insbesondere die motivierende Gesprächsführung
- Zusätzliche Handlungsansätze und Strategien für den Umgang mit Abwehrverhalten
- Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die Praxis der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den Spannungsbogen zwischen dem idealisierten Bild der Sozialen Arbeit, das auf freiwilliger Hilfe basiert, und der Realität von Zwangskontakten. Sie stellt die zentrale Frage nach dem Umgang mit Klienten, die keine Hilfe wünschen, und verweist auf aktuelle gesellschaftliche Diskussionen um Zwangsmaßnahmen und die zunehmende Öffentlichkeit der Sozialen Arbeit. Die Arbeit formuliert das Ziel, eine praxisnahe Arbeitshilfe für die Zusammenarbeit mit Klienten in Zwangskontakten zu liefern.
2. Erläuterung Zwangskontakte: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Definition von Zwangskontakten und deren Bedeutung im Kontext Sozialer Arbeit. Es analysiert das Verhalten von Klienten in Zwangskontakten, einschließlich der Ursachen für Abwehrverhalten und Initiativen zur Kontaktaufnahme. Weiterhin wird die Rolle und die Herausforderungen für Sozialarbeiter*innen in solchen Situationen beleuchtet.
3. Zwangskontakte im Allgemeinen Sozialdienst: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf den Besonderheiten von Zwangskontakten innerhalb des Allgemeinen Sozialdienstes (ASD). Es beschreibt die Struktur und Klientel des ASD, die Aufgaben der Fachkräfte und die spezifischen Hintergründe, die zu Zwangskontakten in diesem Bereich führen. Die Analyse unterstreicht die spezifischen Schwierigkeiten, die in diesem Kontext auftreten.
4. Methoden Sozialer Arbeit bei Zwangskontakten: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Methoden der Sozialen Arbeit, die im Umgang mit Zwangskontakten Anwendung finden. Ein Schwerpunkt liegt auf der motivierenden Gesprächsführung, deren Hintergründe und Vorgehensweise detailliert beschrieben werden. Zusätzlich werden weitere Handlungsansätze für den Umgang mit Zwangskontakten vorgestellt und diskutiert, um ein breiteres methodisches Spektrum aufzuzeigen.
5. Rückschlüsse für die Soziale Arbeit: Das vorletzte Kapitel zieht Schlussfolgerungen aus den vorangegangenen Kapiteln und liefert wichtige Erkenntnisse für die Praxis der Sozialen Arbeit. Es wird auf die Herausforderungen und die Notwendigkeit von weiterführenden Forschung und Entwicklung im Umgang mit Zwangskontakten eingegangen.
Schlüsselwörter
Zwangskontakte, Soziale Arbeit, Allgemeiner Sozialdienst, Motivierende Gesprächsführung, Klientenarbeit, Abwehrverhalten, Methoden, Praxis, Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Methodische Ansätze für die Zusammenarbeit mit Klienten in Zwangskontakten im Kontext der Sozialen Arbeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht methodische Ansätze für die Zusammenarbeit mit Klienten in Zwangskontakten im Kontext der Sozialen Arbeit. Ziel ist die Erstellung einer praxisnahen Arbeitshilfe für Sozialarbeiter*innen im Umgang mit den Herausforderungen solcher Situationen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Herausforderungen von Zwangskontakten, analysiert die Situation von Klienten und Sozialarbeiter*innen in diesen Kontakten, untersucht Methoden der Sozialen Arbeit (insbesondere die motivierende Gesprächsführung), präsentiert zusätzliche Handlungsansätze und Strategien für den Umgang mit Abwehrverhalten und zieht abschließende Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die Praxis.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Erläuterung von Zwangskontakten, Zwangskontakte im Allgemeinen Sozialdienst (ASD), Methoden der Sozialen Arbeit bei Zwangskontakten und Rückschlüsse für die Soziale Arbeit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas, beginnend mit einer Definition und Ausleuchtung des Kontextes, über die Analyse von Situationen und Methoden bis hin zu Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen.
Was wird unter Zwangskontakten verstanden?
Die Arbeit liefert eine umfassende Definition von Zwangskontakten im Kontext der Sozialen Arbeit. Sie analysiert das Verhalten von Klienten in solchen Situationen, einschließlich der Ursachen für Abwehrverhalten und Initiativen zur Kontaktaufnahme, sowie die Rolle und Herausforderungen für Sozialarbeiter*innen.
Welche Rolle spielt der Allgemeine Sozialdienst (ASD)?
Ein Kapitel widmet sich speziell den Zwangskontakten im ASD. Es beschreibt die Struktur und Klientel des ASD, die Aufgaben der Fachkräfte und die spezifischen Hintergründe, die zu Zwangskontakten in diesem Bereich führen. Die Analyse hebt die besonderen Schwierigkeiten in diesem Kontext hervor.
Welche Methoden der Sozialen Arbeit werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Methoden, die im Umgang mit Zwangskontakten Anwendung finden. Ein Schwerpunkt liegt auf der motivierenden Gesprächsführung, inklusive Hintergründe und Vorgehensweise. Zusätzliche Handlungsansätze erweitern das methodische Spektrum.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das letzte Kapitel zieht Schlussfolgerungen aus den vorherigen Kapiteln und bietet wichtige Erkenntnisse für die Praxis. Es thematisiert die Herausforderungen und die Notwendigkeit weiterer Forschung und Entwicklung im Umgang mit Zwangskontakten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Zwangskontakte, Soziale Arbeit, Allgemeiner Sozialdienst, Motivierende Gesprächsführung, Klientenarbeit, Abwehrverhalten, Methoden, Praxis, Herausforderungen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Sozialarbeiter*innen, Studierende der Sozialen Arbeit, Wissenschaftler*innen im Bereich Sozialer Arbeit und alle, die sich mit dem Thema Zwangskontakte in der Sozialen Arbeit auseinandersetzen.
Wo finde ich detailliertere Informationen?
Detailliertere Informationen finden sich im vollständigen Text der Diplomarbeit, der ein Inhaltsverzeichnis, Kapitelzusammenfassungen und eine ausführliche Erläuterung der einzelnen Themen beinhaltet.
- Quote paper
- Diplom Soz.päd. Jessica Hölemann (Author), 2008, Methoden zur Zusammenarbeit mit Klienten bei Zwangskontakten in sozialen Kontexten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113196