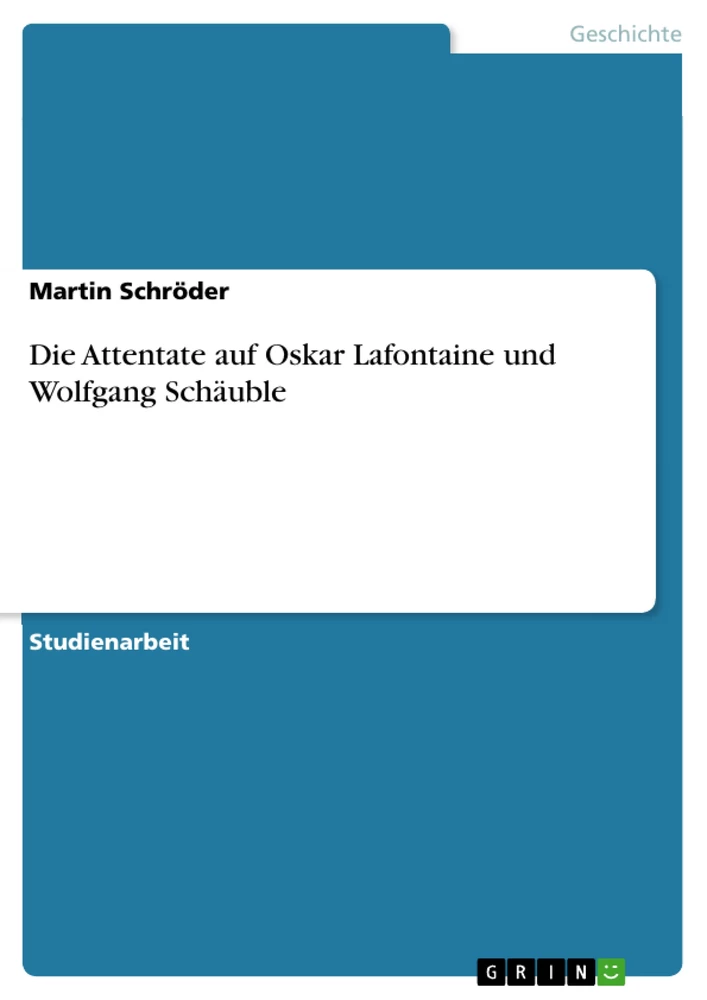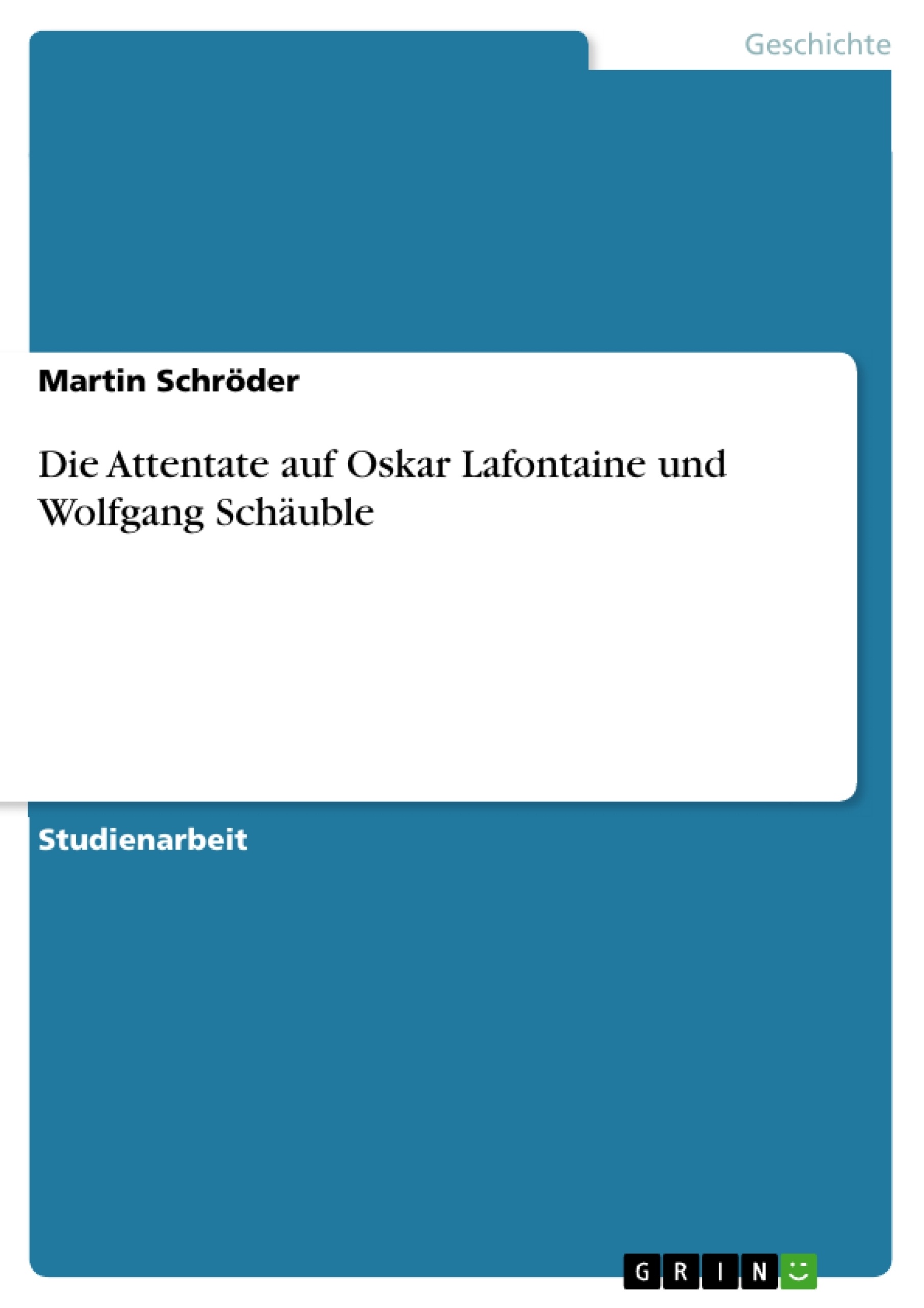Du sollst nicht töten. So besagt es das 5. Gebot. Eine einfache Regel, doch schon immer hat der Mensch diese missachtet und ist seinen Mitmenschen mit Gewalt begegnet. „Homo homini lupus“ – der Mensch ist dem Menschen ein Wolf – mit diesem Satz bringt es Thomas Hobbes in seinem Werk „Leviathan“ ganz treffend auf den Punkt. Die Erörterung ob der Mensch von Natur aus gut oder böse ist, soll nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein, es ist jedoch festzustellen, dass es bestimmter Regulationsmechanismen und Ordnungsprinzipien bedarf, um ein störungsfreies menschliches Zusammenleben zu gewährleisten.
In vielen Fällen richten sich Gewalt und Aggression gegen eben jene politischen und gesellschaftlichen Systeme und deren Repräsentanten, Personen von öffentlichem Interesse. Solche in der Regel politisch oder ideologisch motivierten Anschläge, Attentate genannt, hat es zu allen Zeiten gegeben. Sie wurden seit Beginn der schriftlich fixierten Menschheitsgeschichte registriert und analysiert. Schon in der Antike wurden rege Diskussionen darüber geführt, ob der Tyrannenmord rechtmäßig sei. Das Attentat auf Julius Caesar in den Iden des März des Jahres 44 v. Chr. gilt geradezu als klassisches Beispiel für den politischen Mord in der Geschichte.
Doch muss man nicht unbedingt so weit in die Vergangenheit schauen. Allein im noch jungen 21. Jahrhundert fanden bereits mehrere Attentate und Attentatsversuche auf bedeutende politische Amts- und Würdenträger statt. Der Anschlag auf Benazir Bhutto am 27. Dezember 2007 löste überall große Bestürzung aus und begrub die Hoffnung auf einen schnellen und friedlichen politischen Machtwechsel in Pakistan, und erst vor vier Wochen, am 11. Februar 2008, wurde José Ramos-Horta, Staatspräsident von Osttimor, von Rebellen bei einem Attentat durch mehrere Schüsse schwer verletzt.
Auch die deutsche Geschichte ist nicht frei von politischen Anschlägen. Zu nennen wären an dieser Stelle die Morde an Matthias Erzberger, einem Politiker der Zentrumspartei, im Jahre 1921 und an dem damaligen Reichsaußenminister Walther Rathenau im Folgejahr. Auch auf Bundeskanzler Konrad Adenauer wurde 1952 ein Bombenattentat verübt, welches fehlschlug und stattdessen einen unbeteiligten Polizisten tötete.
Inhaltsverzeichnis
- Forschungsstand
- Attentat und Attentäter – Definition und Charakterisierung der Begriffe
- Das Attentat auf Oskar Lafontaine
- Die Biographie und politische Karriere Lafontaines bis zu dem Zeitpunkt des Anschlags
- Das Attentat
- Die Attentäterin
- Das Attentat auf Wolfgang Schäuble
- Die Biographie und politische Karriere Schäubles bis zu dem Zeitpunkt des Anschlags
- Das Attentat
- Der Attentäter
- Die Folgen der Attentate
- Posttraumatisches Belastungssyndrom als Folge durchlebter Extremsituationen
- Erschütterte Grundüberzeugungen
- Politische Folgen
- Hätten die Attentate verhindert werden können?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Attentate auf Oskar Lafontaine und Wolfgang Schäuble im Jahr 1990. Ziel ist es, den Verlauf und die Hintergründe der Anschläge zu beleuchten, die persönlichen und politischen Folgen zu analysieren und die Frage zu beantworten, ob die Attentate durch konsequentes Eingreifen der Behörden hätten verhindert werden können. Die Arbeit konzentriert sich auf die individuellen Fälle, ohne sich auf allgemeine Theorien zum politischen Terrorismus zu konzentrieren.
- Analyse der Attentate auf Oskar Lafontaine und Wolfgang Schäuble
- Untersuchung der Hintergründe und Motive der Attentäter
- Bewertung der persönlichen und politischen Folgen der Anschläge
- Diskussion der Möglichkeiten zur Prävention solcher Anschläge
- Einordnung der Ereignisse in den historischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Forschungsstand: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über den bestehenden Forschungsstand zu Attentaten im Allgemeinen. Es wird deutlich, dass die Literatur zwar umfangreich, aber oft wenig tiefgehend ist, mit Fokus auf Beschreibung anstatt Analyse. Die Arbeit von Franklin L. Ford wird als beste bisherige Darstellung genannt, obwohl sie aufgrund des Umfangs Abstriche in der Analyse machen musste. Die Arbeit von Sven Felix Kellerhoff wird als aktuellster Stand genannt, mit dem Schwerpunkt auf den Attentätern. Die Anschläge auf Lafontaine und Schäuble werden aufgrund ihrer "geringen" historischen Bedeutung in der Literatur kaum erwähnt, daher werden Biographien und zeitgenössische Artikel als Informationsquellen genannt.
Attentat und Attentäter – Definition und Charakterisierung der Begriffe: Dieses Kapitel (welches im vorliegenden Textfragment fehlt) würde voraussichtlich eine Definition von "Attentat" und "Attentäter" liefern und diese Begriffe im Kontext politischer Gewalt einordnen. Es wäre zu erwarten, dass historische und philosophische Perspektiven einbezogen werden, um die Motivationen hinter Attentaten besser zu verstehen. Dies bildet die theoretische Grundlage für die anschließende Fallstudie.
Das Attentat auf Oskar Lafontaine: Dieser Abschnitt würde die Biographie und politische Karriere Lafontaines bis zum Attentat detailliert darstellen, um den Kontext des Anschlags zu verdeutlichen. Der Ablauf des Attentats selbst würde rekonstruiert und analysiert werden. Der Fokus läge auf der Beschreibung der Attentäterin, ihren Motiven und ihrer psychischen Verfassung. Die Rolle der Medienberichterstattung im Zusammenhang mit dem Ereignis wäre ein weiterer wichtiger Aspekt.
Das Attentat auf Wolfgang Schäuble: Ähnlich wie im vorherigen Kapitel, würde dieser Abschnitt Schäubles Biographie und politische Karriere vor dem Attentat detailliert beschreiben. Der Ablauf des Attentats würde analysiert, inklusive der Rolle des Attentäters und seiner Motive. Die dauerhaften physischen und psychischen Folgen des Attentats auf Schäuble, insbesondere seine Querschnittslähmung, würden ausführlich behandelt. Es wird eine vergleichende Analyse mit dem Attentat auf Lafontaine durchgeführt.
Die Folgen der Attentate: Dieses Kapitel analysiert die Folgen der Attentate auf verschiedenen Ebenen. Es würde die unmittelbaren Folgen, wie das posttraumatische Belastungssyndrom der Opfer, untersuchen. Weiterhin würden die langfristigen politischen Auswirkungen der Anschläge analysiert und diskutiert werden, wobei die Veränderungen in der politischen Landschaft, im Umgang mit Sicherheit und im öffentlichen Diskurs im Fokus stehen.
Hätten die Attentate verhindert werden können?: Dieser Abschnitt (welches im vorliegenden Textfragment fehlt) würde kritisch die Sicherheitsvorkehrungen und das Handeln der Behörden vor und während der Attentate untersuchen. Es würden die Möglichkeiten zur Prävention analysiert und bewertet werden, mögliche Verbesserungspotenziale und Lessons Learned diskutiert. Dies kann sowohl Sicherheitsmaßnahmen als auch präventive Maßnahmen zur Deeskalation und Intervention umfassen.
Schlüsselwörter
Attentate, Oskar Lafontaine, Wolfgang Schäuble, politische Gewalt, Motivforschung, Folgen von Attentaten, Sicherheitspolitik, Prävention, Posttraumatisches Belastungssyndrom, Biographie, Politische Karriere.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Attentate auf Oskar Lafontaine und Wolfgang Schäuble
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die Attentate auf Oskar Lafontaine und Wolfgang Schäuble im Jahr 1990. Sie untersucht den Verlauf der Anschläge, die Hintergründe und Motive der Attentäter, die persönlichen und politischen Folgen sowie die Frage der Vermeidbarkeit der Attentate.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit beinhaltet eine Analyse der Attentate, eine Untersuchung der Motive der Attentäter, eine Bewertung der persönlichen und politischen Folgen, eine Diskussion der Möglichkeiten zur Prävention und eine Einordnung der Ereignisse in den historischen Kontext. Sie konzentriert sich auf die Einzelfälle und vermeidet allgemeine Theorien zum politischen Terrorismus.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Forschungsstand, Definitionen von Attentat und Attentäter, detaillierte Beschreibungen der Attentate auf Lafontaine und Schäuble (inklusive Biografien der Opfer und Täter), den Folgen der Attentate (einschließlich des posttraumatischen Belastungssyndroms) und der Frage nach der Vermeidbarkeit der Anschläge. Abschließend folgt ein Fazit.
Wie wird der Forschungsstand dargestellt?
Das Kapitel zum Forschungsstand zeigt, dass die vorhandene Literatur zu Attentaten oft beschreibend statt analytisch ist. Die Arbeit von Franklin L. Ford wird als beste Darstellung genannt, während die Arbeit von Sven Felix Kellerhoff als aktuellster Stand, jedoch mit Fokus auf die Attentäter, erwähnt wird. Die Attentate auf Lafontaine und Schäuble werden in der Literatur aufgrund ihrer "geringen" historischen Bedeutung kaum behandelt.
Wie werden die Attentate auf Lafontaine und Schäuble beschrieben?
Die Kapitel zu den einzelnen Attentaten beschreiben detailliert die Biografien und politischen Karrieren der Opfer bis zum Zeitpunkt der Anschläge. Der Ablauf der Attentate wird rekonstruiert, die Täter und ihre Motive analysiert. Besonderes Augenmerk liegt auf den Folgen für die Opfer, insbesondere Schäubles dauerhafte Querschnittslähmung. Ein Vergleich beider Attentate wird durchgeführt.
Welche Folgen der Attentate werden untersucht?
Die Arbeit untersucht sowohl die unmittelbaren Folgen wie das posttraumatische Belastungssyndrom der Opfer als auch die langfristigen politischen Auswirkungen. Es werden Veränderungen in der politischen Landschaft, im Umgang mit Sicherheit und im öffentlichen Diskurs analysiert.
Wie wird die Frage der Vermeidbarkeit der Attentate behandelt?
Dieses Kapitel analysiert kritisch die Sicherheitsvorkehrungen und das Handeln der Behörden vor und während der Attentate. Es bewertet die Möglichkeiten zur Prävention und diskutiert Verbesserungspotenziale und Lehren aus den Ereignissen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Attentate, Oskar Lafontaine, Wolfgang Schäuble, politische Gewalt, Motivforschung, Folgen von Attentaten, Sicherheitspolitik, Prävention, Posttraumatisches Belastungssyndrom, Biographie, Politische Karriere.
- Quote paper
- Martin Schröder (Author), 2008, Die Attentate auf Oskar Lafontaine und Wolfgang Schäuble, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113205