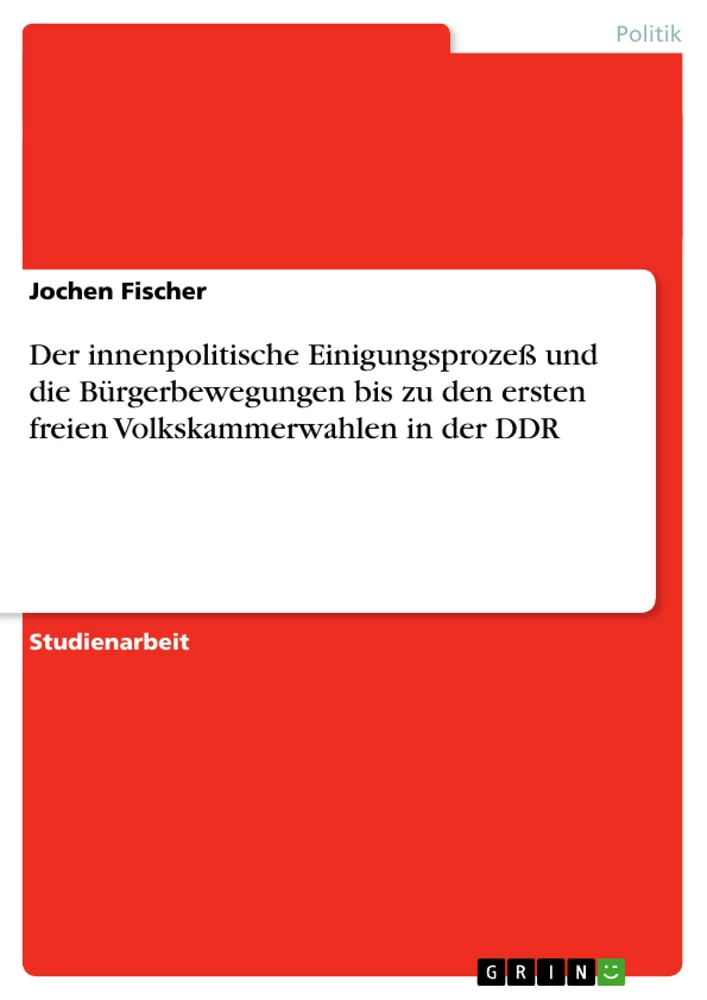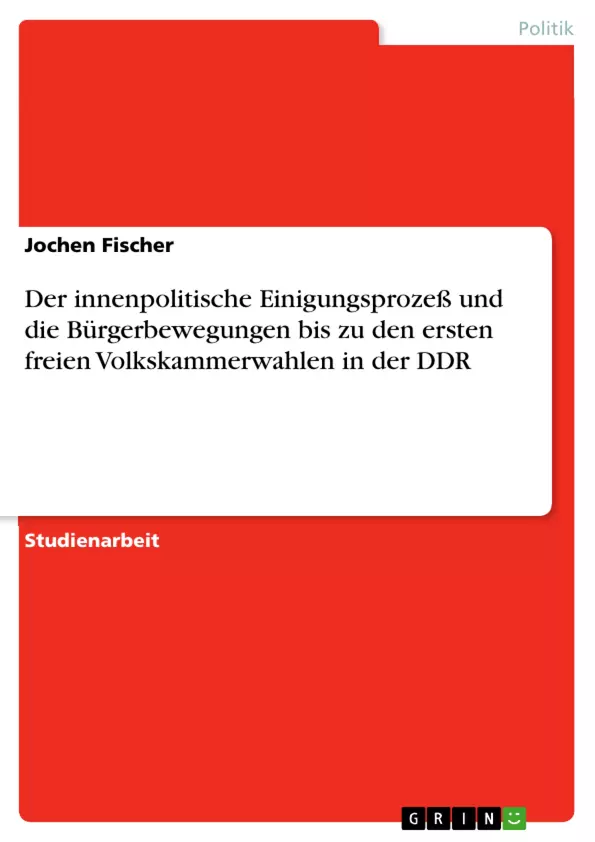Bei der Suche nach den Auslösern der Wende in der DDR werden neben dem wirtschaftlichen Bankrott, stets die Bürgerbewegungen als Initiatoren genannt. Im Rückblick auf die Entwicklung bis zum 3.Oktober 1990 stellt sich dann jedoch die Frage, warum diese Bewegungen im innenpolitischen Einigungsprozeß der beiden deutschen Staaten im Gegensatz zu den ehemaligen Blockparteien Parteien nur eine Randerscheinung darstellen? Der Zusammenbruch der DDR kam im Herbst 1989 ebenso überraschend wie die Geschwindigkeit mit der der Umbruch von statten ging. Der Reformprozeß, der durch Massendemonstrationen, Ausreisewelle und den sich formierenden oppositionellen Bürgerbewegungen eingeleitet worden war, entwickelte eine rasante Eigendynamik, so daß sich bald die Forderungen der Demonstranten änderten. Die Proteste überschritten nun die ursprünglichen Vorstellungen der Bürgerbewegungen. War es zu Beginn noch der Ruf nach Veränderungen in der DDR, der die Oppositionskräfte einte, differenzierte sich der Protest im November/Dezember 1989 in Vereinigungsbefürworter und DDR-Reformer1. Mit dem Zehn- Punkte-Plan Helmut Kohls und den zunehmenden Forderungen der DDR-Bevölkerung nach der deutschen Einheit, war, wie es der damalige Bundespräsident von Weizsäcker formuliert, „der Rubikon überschritten. Die zweite Wende gewann die Oberhand.“2 Die Oppositionsbewegung spaltete sich und war aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage, die ihr aufgedrängte Macht zu übernehmen. Die ersten freien Wahlen entwickelten sich zunehmend zu einer Richtungsentscheidung über den zukünftigen Weg der DDR. Schließlich gingen die Bürgerbewegungen vier Monate nach der Wende als Verlierer der Wahl hervor. Die neue Regierung unter der Führung des CDU Politikers Lothar de Maizière trieb nun die Vereinigung der beiden deutschen Staaten voran. Mit der Einführung der Wirtschafts-, Währungs-, und Sozialunion am 1. Juli 1990 war die erste Hürde auf dem Weg zur Einheit genommen. Nach langen Verhandlungen einigten sich die Bundesrepublik und die DDR darauf, sich am 3.Oktober 1990 durch Beitritt der DDR nach Art. 23 GG zu vereinigen. Die Wahlen zur Volkskammer in der DDR am 18. März 1990 erhalten vor allem im Bewußtsein der darauffolgenden politischen Entscheidungen einen hohen Stellenwert. Um so interessanter ist es, die Phase von der Wende im Herbst 1989 bis zu diesen Wahlen zu beleuchten und die Entwicklung der Protagonisten des Umbruchs zu betrachten [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Entwicklungen in der DDR nach dem 9. November 1989
- 2.1. Das Kabinett Modrow
- 2.2. Der 'Runde Tisch' und die 'Regierung der nationalen Verantwortung'
- 2.3. Wahlkampf und erste freie Volkskammerwahlen
- 3. Einflußnahme der Bundesrepublik
- 3.1. Die Regierung Kohl
- 3.2. Die westlichen Parteien
- 4. Die Bürgerbewegungen in der DDR
- 4.1. Entstehung und Entwicklung in der DDR
- 4.2. Einfluß auf die Wende am 9. November
- 4.3. Machtkontrolle oder Machtübernahme?
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den innenpolitischen Einigungsprozess in der DDR und den Einfluss von Bürgerbewegungen auf die Ereignisse bis zu den ersten freien Volkskammerwahlen im Jahr 1990. Die Arbeit analysiert die Entwicklungen in der DDR nach dem Mauerfall, die Rolle der Bundesrepublik und die Entwicklung sowie den Einfluss der Bürgerbewegungen.
- Die Entwicklungen in der DDR nach dem 9. November 1989
- Die Rolle der Bundesrepublik und ihrer politischen Akteure im Einigungsprozess
- Die Entstehung, Entwicklung und der Einfluss der Bürgerbewegungen in der DDR
- Der Einfluss der Bürgerbewegungen auf die Wende am 9. November
- Die Rolle der Bürgerbewegungen im Einigungsprozess und ihre politische Positionierung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt die Problematik der Arbeit dar und beleuchtet die Rolle der Bürgerbewegungen im Kontext des Einigungsprozesses. Sie stellt die Forschungsfrage in den Vordergrund: Warum blieben die Bürgerbewegungen im Einigungsprozess trotz ihres initiierenden Einflusses auf die Wende im Hintergrund?
- Kapitel 2: Die Entwicklungen in der DDR nach dem 9. November
Dieses Kapitel befasst sich mit den politischen Entwicklungen in der DDR nach dem Fall der Mauer. Es beschreibt die Bildung des Kabinetts Modrow, den 'Runden Tisch' und die 'Regierung der nationalen Verantwortung', sowie den Wahlkampf und die ersten freien Volkskammerwahlen.
- Kapitel 3: Einflußnahme der Bundesrepublik
Dieses Kapitel untersucht den Einfluss der Bundesrepublik auf den Einigungsprozess. Es analysiert die Rolle der Regierung Kohl und die Beteiligung westlicher Parteien an den politischen Entwicklungen in der DDR.
- Kapitel 4: Die Bürgerbewegungen in der DDR
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Bürgerbewegungen in der DDR. Es beleuchtet ihre Entstehung und Entwicklung, ihren Einfluss auf die Wende und die Frage nach ihrer Machtkontrolle oder Machtübernahme.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen: DDR, Einigungsprozess, Bürgerbewegungen, Wende, Volkskammerwahlen, Bundesrepublik, Politik, Einflussnahme, Machtkontrolle, Machtübernahme, Regierung Modrow, 'Runder Tisch', 'Regierung der nationalen Verantwortung', Helmut Kohl, Willy Brandt, Richard von Weizsäcker, Manfred Behrend.
Häufig gestellte Fragen
Warum spielten die Bürgerbewegungen nach der Wende nur eine Randrolle?
Obwohl sie Initiatoren waren, spalteten sie sich in Vereinigungsbefürworter und DDR-Reformer. Zudem fehlte ihnen oft die professionelle Parteistruktur gegenüber den West-Parteien.
Was war der "Runde Tisch" in der DDR?
Ein Gremium aus Vertretern der alten Macht (SED/Blockparteien) und neuen Oppositionsgruppen, das den Übergang zur Demokratie und die ersten Wahlen vorbereitete.
Welche Bedeutung hatten die Volkskammerwahlen vom 18. März 1990?
Es waren die ersten freien Wahlen in der DDR. Sie galten als Richtungsentscheidung für eine schnelle Wiedervereinigung, die von der "Allianz für Deutschland" gewonnen wurde.
Was beinhaltete Helmut Kohls Zehn-Punkte-Plan?
Ein Programm vom November 1989, das den Weg zur Überwindung der Teilung Deutschlands über konföderative Strukturen bis hin zur staatlichen Einheit skizzierte.
Wie beeinflusste die Bundesrepublik den Wahlkampf in der DDR?
Westliche Parteien unterstützten ihre Partner in der DDR massiv mit Logistik, Finanzen und prominenten Wahlhelfern, was den Wahlkampf stark prägte.
Was war die "Regierung der nationalen Verantwortung"?
Eine Übergangsregierung unter Hans Modrow, in die Anfang 1990 auch Vertreter der Oppositionsgruppen des Runden Tisches als Minister ohne Geschäftsbereich eintraten.
- Arbeit zitieren
- Jochen Fischer (Autor:in), 1999, Der innenpolitische Einigungsprozeß und die Bürgerbewegungen bis zu den ersten freien Volkskammerwahlen in der DDR, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11321