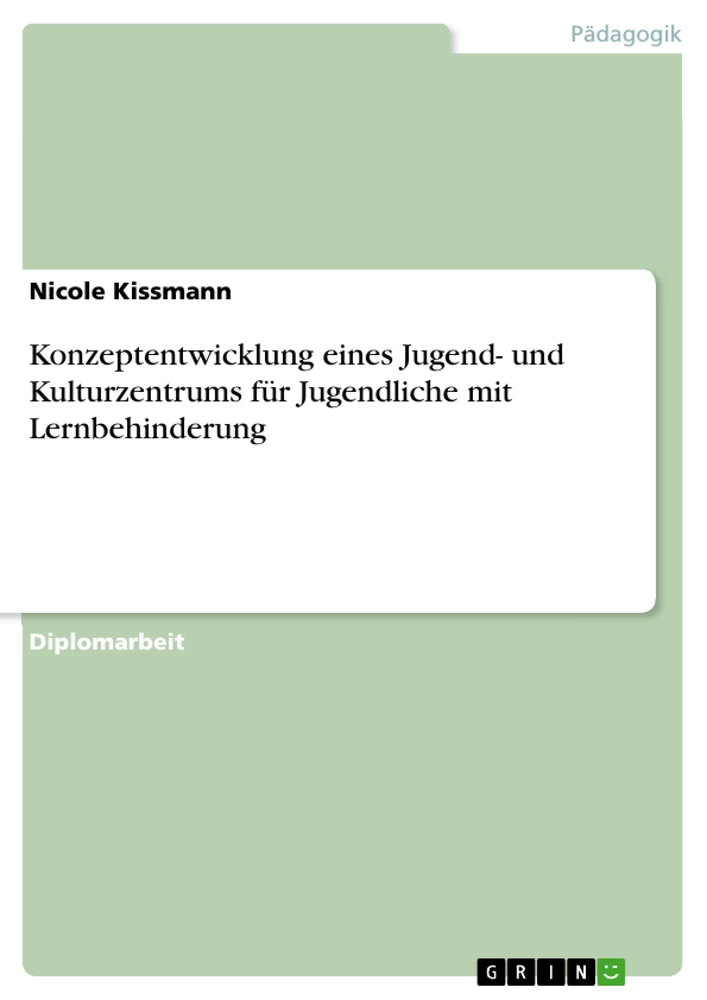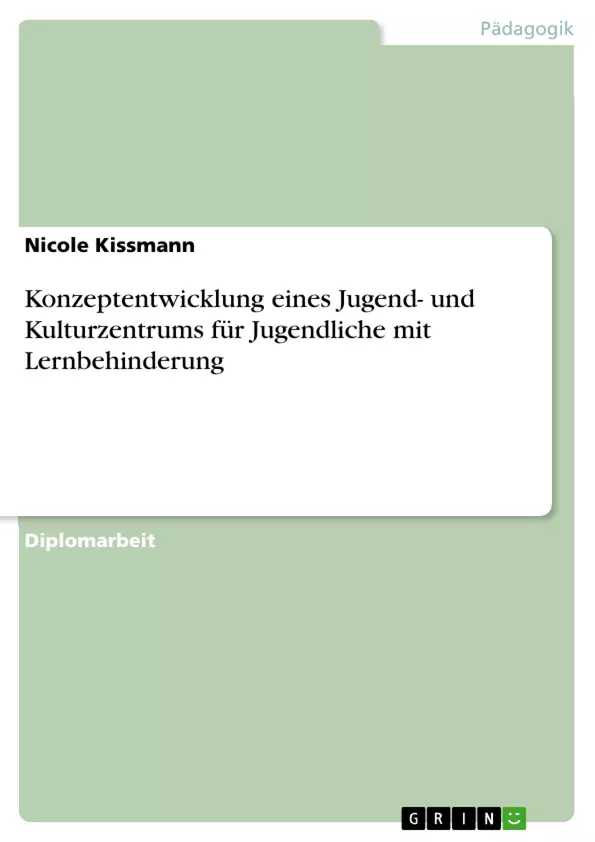Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit Jugendlichen mit Lernbehinderung (LB) und setzt sich mit ihrem Mangel an sozialen Kontakten auseinander. Reaktionen aus dem Umfeld auf die Jugendlichen mit LB (Stigmatisierung durch LB) sowie Störungen in der Sozialkompetenz der Jugendlichen mit LB und die daraus resultierende mögliche soziale Isolation werden empirisch belegt.
Angesichts der oben genannten Defizite in der Sozialkompetenz bei Jugendlichen mit LB und deren möglichen sozialen Isolation, ist ein pädagogischer Handlungsbedarf gegeben, damit die Jugendlichen mit LB durch pädagogische Hilfestellung (z.B. durch das BetreuerInnenteam) eine Situation erleben, wo sie soziale Kontakte herstellen können. In Form eines Jugend- und Kulturzentrums für Jugendliche mit LB kann eine Möglichkeit im Freizeitbereich geboten werden, die Jugendliche mit LB von der möglichen sozialen Isolation bewahren.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Jugendalter
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Definitionen von Jugendalter
- 1.3 Zur speziellen Problemlage lernbehinderter Jugendlicher
- 1.4 Peergruppe
- 1.5 Zusammenfassung
- 2. Behinderung
- 2.1 Einleitung
- 2.2 Definition von Behinderung laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
- 2.3 Definition der österreichischen Bundesregierung
- 2.4 Behinderung durch das soziale Umfeld
- 3. Lernbehinderung
- 3.1 Einleitung
- 3.2 Zur Diskussion um den Begriff der Lernbehinderung
- 3.3 Kategorisierung von Lernbehinderungen
- 3.3.1 Lernbehinderung
- 3.3.2 Lernstörung
- 3.3.3 Lernstörung und Verhaltensauffälligkeiten aufgrund früherer traumatisierender Erfahrungen
- 3.3.3.1 Missbrauch und/oder Gewalt
- 3.3.3.2 Desorganisierte und/oder desorientierte Bindungsbeziehungen
- 3.3.4 Lernbeeinträchtigung
- 3.3.5 Lernverwahrlosung
- 3.3.6 Lernbehinderung und Verhaltensstörungen
- 3.4 Einflussfaktor 'Gesellschaftliche Veränderungen'
- 3.5 Ursachen-Modelle von Lernbehinderung
- 3.6 Klassifizierung von Defiziten
- 3.7 Das „Feststellverfahren“
- 3.8 Folgen des Etiketts des lernbehinderten Jugendlichen
- 4. Beschreibung der Störungen in der Sozialkompetenz bei Jugendlichen mit Lernbehinderung
- 4.1 Einleitung
- 4.2 Definitionen von „Sozialkompetenz“ und von „sozialer Isolation“
- 4.2.1 Sozialkompetenz
- 4.2.2 Soziale Isolation
- 4.3 Störungen in der Sozialkompetenz
- 4.4 Empirische Ergebnisse
- 4.4.1 Untersuchung von Wocken (1982)
- 4.4.2 Tabelle von Schmidt (1987)
- 4.5 Der Weg zur möglichen sozialen Isolation
- 4.6 Zusammenfassung
- 5. Freizeit
- 5.1 Einleitung
- 5.2 Definition und Bedeutung von Freizeit
- 5.3 Freizeitaktivitäten von Jugendlichen mit LB und nicht behinderten Jugendlichen
- 5.4 Konturen einer integrativen Didaktik der Freizeit
- 5.5 Positive Beispiele erfolgreicher Integration im Freizeitbereich
- 5.5.1 Projekt „Integration Gemeinsame Ferien“ beim Jugendfreizeit- und Bildungswerk (jfbw) des Stadtjugendausschuß e. V. Karlsruhe
- 5.5.2 Integration im Jugend- und Kulturzentrum „House“ in Mureck/Stmk.
- 5.6 Kritische Anmerkung der integrativen Freizeitgestaltung
- 5.7 Zusammenfassung
- 6. Normalisierungs- und Integrationsprinzip
- 6.1 Einleitung
- 6.2 Das Normalisierungsprinzip
- 6.3 Das Integrationsprinzip
- 7. Jugend- und Kulturzentrum - Projekteinreichung
- 7.1 Einleitung
- 7.2 Sinn und Zweck des Jugend- und Kulturzentrums
- 7.3 Das BetreuerInnenteam
- 7.3.1 Einleitung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die soziale Isolation von Jugendlichen mit Lernbehinderung und entwickelt ein Konzept für ein Jugend- und Kulturzentrum als Lösungsansatz. Das Ziel ist, pädagogische Hilfestellungen im Freizeitbereich zu konzipieren, um soziale Kontakte zu fördern und Isolation zu vermeiden.
- Soziale Isolation Jugendlicher mit Lernbehinderung
- Störungen der Sozialkompetenz bei Jugendlichen mit Lernbehinderung
- Bedeutung von Freizeitaktivitäten für die soziale Integration
- Normalisierungs- und Integrationsprinzipien
- Konzeptentwicklung eines Jugend- und Kulturzentrums
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der sozialen Isolation von Jugendlichen mit Lernbehinderung ein und skizziert den Aufbau und die Ziele der Arbeit. Sie beleuchtet den Mangel an sozialen Kontakten und die Notwendigkeit pädagogischer Interventionen.
1. Jugendalter: Dieses Kapitel definiert das Jugendalter und beleuchtet die spezifischen Herausforderungen für Jugendliche mit Lernbehinderung in dieser Lebensphase. Es untersucht die Bedeutung der Peergruppe und deren Einfluss auf die soziale Entwicklung. Die Zusammenfassung unterstreicht die besonderen Bedürfnisse dieser Gruppe und die Notwendigkeit adäquater Unterstützung.
2. Behinderung: Das Kapitel analysiert verschiedene Definitionen von Behinderung, sowohl aus der Perspektive der WHO als auch der österreichischen Bundesregierung. Es betont den Einfluss des sozialen Umfelds auf die Wahrnehmung und Erfahrung von Behinderung und zeigt, wie Stigmatisierung die soziale Teilhabe einschränken kann. Der Fokus liegt auf dem Verständnis von Behinderung als komplexem biopsychosozialen Phänomen.
3. Lernbehinderung: Dieses Kapitel widmet sich der Definition und Kategorisierung von Lernbehinderungen, inklusive der Diskussion um die verschiedenen Begriffsdefinitionen (Lernstörung, Lernbeeinträchtigung, etc.). Es werden Ursachenmodelle beleuchtet und die Folgen des „Etiketts“ lernbehinderter Jugendlicher auf deren soziale Integration untersucht. Die Kapitelzusammenfassung zeigt die Komplexität des Themas und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung.
4. Beschreibung der Störungen in der Sozialkompetenz bei Jugendlichen mit Lernbehinderung: Dieses Kapitel definiert Sozialkompetenz und soziale Isolation und analysiert empirische Befunde zu Störungen der Sozialkompetenz bei Jugendlichen mit Lernbehinderung. Es beschreibt den Weg von möglichen Defiziten hin zu sozialer Isolation und hebt die Bedeutung von Interventionen hervor. Die Zusammenfassung betont den Zusammenhang zwischen Sozialkompetenzdefiziten und sozialer Isolation.
5. Freizeit: Das Kapitel untersucht die Bedeutung von Freizeit für Jugendliche im Allgemeinen und insbesondere für Jugendliche mit Lernbehinderung. Es analysiert Freizeitaktivitäten und diskutiert integrative Ansätze in der Freizeitgestaltung. Positive Beispiele erfolgreicher Integrationsmodelle werden vorgestellt, um Lösungsansätze aufzuzeigen. Die Zusammenfassung stellt die Freizeit als wichtigen Bereich für soziale Teilhabe heraus.
6. Normalisierungs- und Integrationsprinzip: Dieses Kapitel beschreibt und vergleicht die Normalisierungs- und Integrationsprinzipien und diskutiert deren Relevanz für die soziale Teilhabe von Jugendlichen mit Lernbehinderung. Die Zusammenfassung betont die Bedeutung beider Prinzipien für die Entwicklung inklusiver Strukturen.
7. Jugend- und Kulturzentrum - Projekteinreichung: Dieses Kapitel stellt das Konzept eines Jugend- und Kulturzentrums für Jugendliche mit Lernbehinderung vor. Es beschreibt den Sinn und Zweck des Zentrums und skizziert die Rolle des BetreuerInnenteams. Die Zusammenfassung fasst die Kernideen des Konzeptes zusammen und verdeutlicht dessen Potenzial zur Förderung der sozialen Integration.
Schlüsselwörter
Lernbehinderung, Jugendalter, soziale Isolation, Sozialkompetenz, Integration, Normalisierung, Freizeitgestaltung, Jugend- und Kulturzentrum, pädagogische Hilfestellung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Soziale Isolation Jugendlicher mit Lernbehinderung
Was ist der Hauptfokus dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die soziale Isolation von Jugendlichen mit Lernbehinderung und entwickelt ein Konzept für ein Jugend- und Kulturzentrum als Lösungsansatz. Der Fokus liegt auf der Konzipierung pädagogischer Hilfestellungen im Freizeitbereich, um soziale Kontakte zu fördern und Isolation zu vermeiden.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt umfassend die Themen Soziale Isolation Jugendlicher mit Lernbehinderung, Störungen der Sozialkompetenz, die Bedeutung von Freizeitaktivitäten für die soziale Integration, Normalisierungs- und Integrationsprinzipien sowie die Konzeptentwicklung eines Jugend- und Kulturzentrums.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert. Sie beginnt mit einer Einleitung und einer Definition des Jugendalters und des Begriffs Behinderung, einschließlich Lernbehinderung mit ihren verschiedenen Ausprägungen und Ursachen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung von Störungen in der Sozialkompetenz bei Jugendlichen mit Lernbehinderung und der Analyse empirischer Befunde. Die Bedeutung von Freizeitaktivitäten für die soziale Integration und integrative Ansätze werden ebenfalls untersucht. Die Arbeit schließt mit der Präsentation eines Konzepts für ein Jugend- und Kulturzentrum als Lösungsansatz.
Welche Definitionen von Behinderung werden verwendet?
Die Arbeit verwendet Definitionen von Behinderung gemäß der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der österreichischen Bundesregierung. Sie betont auch den Einfluss des sozialen Umfelds auf die Wahrnehmung und Erfahrung von Behinderung.
Wie werden Lernbehinderungen kategorisiert?
Die Arbeit differenziert zwischen Lernbehinderung, Lernstörung, Lernbeeinträchtigung und Lernverwahrlosung. Sie berücksichtigt auch den Zusammenhang zwischen Lernstörungen und Verhaltensauffälligkeiten aufgrund früherer traumatisierender Erfahrungen (Missbrauch, Gewalt, desorganisierte Bindungsbeziehungen).
Welche empirischen Ergebnisse werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf empirische Ergebnisse von Wocken (1982) und Schmidt (1987) zur Beschreibung von Störungen der Sozialkompetenz bei Jugendlichen mit Lernbehinderung.
Welches Konzept wird für die Förderung sozialer Integration vorgestellt?
Die Arbeit entwickelt ein Konzept für ein Jugend- und Kulturzentrum, das als Ort der Begegnung und der Förderung sozialer Kontakte für Jugendliche mit Lernbehinderung dienen soll. Das Konzept beinhaltet die Beschreibung des Zentrums, seiner Ziele und die Rolle des BetreuerInnenteams.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Lernbehinderung, Jugendalter, soziale Isolation, Sozialkompetenz, Integration, Normalisierung, Freizeitgestaltung, Jugend- und Kulturzentrum, pädagogische Hilfestellung.
Welche Prinzipien spielen eine Rolle in der Arbeit?
Die Arbeit behandelt die Normalisierungs- und Integrationsprinzipien und deren Relevanz für die soziale Teilhabe von Jugendlichen mit Lernbehinderung.
- Arbeit zitieren
- Mag. Phil. Nicole Kissmann (Autor:in), 2005, Konzeptentwicklung eines Jugend- und Kulturzentrums für Jugendliche mit Lernbehinderung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113224