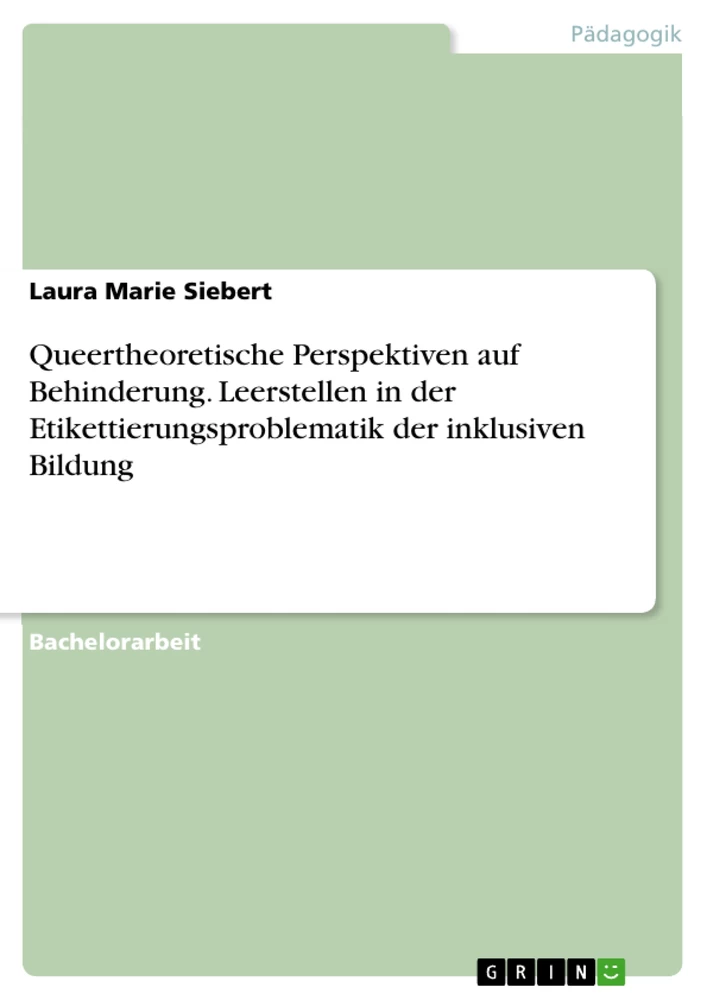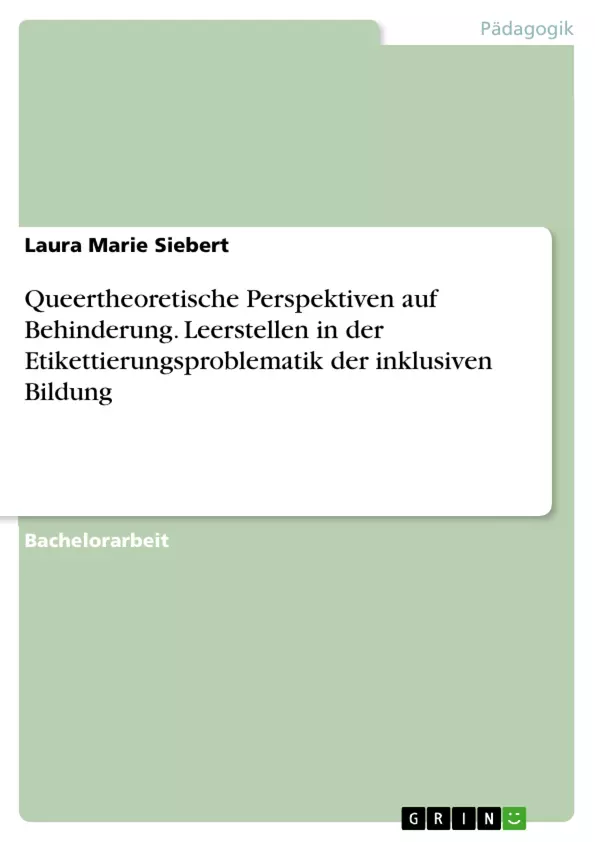Die vorliegende Arbeit soll ein Mosaiksteinchen darstellen, das einen Anschluss an die inklusive Bildung und speziell die Etikettierungsproblematik via der Interdependenzen von Queer-Theorie und Behinderung ermöglicht. Die Fragen danach, inwieweit sich die Überlegungen der Queertheoretiker:innen Michel Foucault und Judith Butler zu Macht, Normalisierung, Körper und Subjektivität auf Behinderung beziehen lassen und welche Leerstellen dadurch in der Etikettierungsproblematik aufgedeckt werden können, werden in dieser Arbeit zu diesem Zweck beantwortet.
Dafür wird in der Darstellung des theoretischen Rahmens zunächst kurz die Entwicklung der Queer Studies, ihre Strömungen und ihre übergeordneten Ziele beschrieben und zudem dargestellt, welchen Platz die Theorien Foucaults und Butlers darin einnehmen. Auch der kulturelle Behinderungsbegriff wird anhand seiner Entwicklung aus vorausgehenden Modellen von Behinderung abgesteckt, während die Etikettierungsproblematik anhand ausgewählter Stimmen des Dekategorisierungsdiskurses und im Zusammenhang mit der Anerkennungstheorie dargestellt wird. Im dritten Kapitel folgt eine Erläuterung der Interdependenzen zwischen den Queer Studies, Behinderung und der inklusiven Bildung, wobei zunächst übergeordnete Zusammenhänge und Ziele zwischen den Queer und den Disability Studies aufgezeigt werden, die die weiteren Relationen anbahnen. Mithilfe von Foucault wird gezeigt, welche Rolle der Körper im kulturellen Modell von Behinderung einnimmt, wie sich dies im Kontext der Pädagogik widerspiegelt und wie sich dadurch die diskursive Produktion von behinderten Körpern und Behinderung vollzieht.
Im darauffolgenden Abschnitt wird daran anschließend die Bedeutung der Subjektivitätstheorie von Butler für die inklusive Pädagogik im Kontext der Anerkennungsproblematik und damit auch von Zuschreibung und Etikettierung genauer beleuchtet. Nachfolgend werden diese Erkenntnisse kritisch hinterfragend auf die Etikettierungsproblematik und ihre ausgewählten Stimmen, sowie auf die der Problematik innewohnende Anerkennungstheorie angewandt. Die Leerstellen, die sich übergreifend aus dieser Betrachtung ergeben, werden abschließend nochmals zugespitzt herausgearbeitet. Im letzten Kapitel werden die zentralen Aspekte und Ergebnisse der Arbeit nochmals rekapituliert und pointiert zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Rahmen
- 2.1 Queer Studies
- 2.2 Der kulturelle Behinderungsbegriff
- 2.3 Etikettierungsproblematik
- 3. Interdependenzen von Queer Studies, Behinderung und inklusiver Bildung
- 3.1 Zusammenhänge von Queer Studies und Disability Studies
- 3.2 Macht, Körper und Normalisierung
- 3.3 Subjektivierung und Anerkennung
- 4. Leerstellen in der Etikettierungsproblematik
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Etikettierungsproblematik in der inklusiven Bildung unter queertheoretischen Perspektiven. Ziel ist es, die Leerstellen aufzuzeigen, die sich aus der Anwendung queertheoretischer Konzepte auf die Behinderungsdiskussion ergeben. Die Arbeit analysiert die Interdependenzen zwischen Queer Studies, Disability Studies und inklusiver Bildung.
- Queertheoretische Perspektiven auf Behinderung
- Der kulturelle Behinderungsbegriff und seine Konstruktion
- Machtstrukturen und Normalisierungsprozesse im Kontext von Behinderung
- Etikettierung und Anerkennung in der inklusiven Bildung
- Leerstellen und Forschungsdesiderate in der Etikettierungsproblematik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Etikettierungsproblematik in der inklusiven Bildung ein. Sie beschreibt den Kontext des steigenden Ressourcenbedarfs und die damit verbundene Zunahme von Etikettierungen von Schüler*innen als förderbedürftig. Die Arbeit positioniert sich im Diskurs um Dekategorisierung und Anerkennung und kündigt die Anwendung queertheoretischer Ansätze an, um die Problematik zu beleuchten, insbesondere die Theorien von Foucault und Butler zu Macht, Normalisierung, Körper und Subjektivität im Kontext von Behinderung.
2. Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel legt den theoretischen Grundstein der Arbeit. Zunächst wird ein Überblick über die Queer Studies gegeben, ihre Entwicklung, Strömungen und zentralen Ziele, sowie die Rolle von Foucault und Butlers Theorien. Der kulturelle Behinderungsbegriff wird definiert und in seinen historischen Kontext eingeordnet. Abschließend wird die Etikettierungsproblematik im Kontext des Dekategorisierungsdiskurses und der Anerkennungstheorie dargestellt.
3. Interdependenzen von Queer Studies, Behinderung und inklusiver Bildung: Dieses Kapitel untersucht die Verbindungen zwischen Queer Studies und Disability Studies. Es analysiert die Rolle des Körpers im kulturellen Modell von Behinderung nach Foucault, die diskursive Konstruktion behinderter Körper und die Bedeutung von Butlers Subjektivitätstheorie für die inklusive Pädagogik im Kontext der Anerkennung und Etikettierung. Die Kapitel vernetzen die theoretischen Konzepte mit der Praxis inklusiver Bildung.
4. Leerstellen in der Etikettierungsproblematik: Dieses Kapitel wendet die in den vorherigen Kapiteln dargestellten Erkenntnisse kritisch auf die Etikettierungsproblematik und die zugrundeliegende Anerkennungstheorie an. Es identifiziert und analysiert die Leerstellen, die sich aus der queertheoretischen Perspektive auf die Problematik ergeben.
Schlüsselwörter
Queer Studies, Disability Studies, Inklusive Bildung, Etikettierungsproblematik, Behinderung, Foucault, Butler, Macht, Normalisierung, Körper, Subjektivität, Anerkennung, Dekategorisierung, Intersektionalität.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Etikettierungsproblematik in der inklusiven Bildung unter queertheoretischen Perspektiven
Was ist der Gegenstand der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Etikettierungsproblematik in der inklusiven Bildung unter queertheoretischen Perspektiven. Sie analysiert die Interdependenzen zwischen Queer Studies, Disability Studies und inklusiver Bildung und beleuchtet die Leerstellen, die sich aus der Anwendung queertheoretischer Konzepte auf die Behinderungsdiskussion ergeben.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Queer Studies, insbesondere die Theorien von Foucault und Butler zu Macht, Normalisierung, Körper und Subjektivität. Der kulturelle Behinderungsbegriff wird ebenso thematisiert wie die Anerkennungstheorie im Kontext der Dekategorisierung.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Queertheoretische Perspektiven auf Behinderung; den kulturellen Behinderungsbegriff und seine Konstruktion; Machtstrukturen und Normalisierungsprozesse im Kontext von Behinderung; Etikettierung und Anerkennung in der inklusiven Bildung; Leerstellen und Forschungsdesiderate in der Etikettierungsproblematik; Zusammenhänge von Queer Studies und Disability Studies; sowie Subjektivierung und Anerkennung im Kontext von Behinderung und inklusiver Bildung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theoretischer Rahmen (mit Unterkapiteln zu Queer Studies, dem kulturellen Behinderungsbegriff und der Etikettierungsproblematik), Interdependenzen von Queer Studies, Behinderung und inklusiver Bildung, Leerstellen in der Etikettierungsproblematik und Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel wird in der vorliegenden HTML-Datei zusammengefasst.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Queer Studies, Disability Studies, Inklusive Bildung, Etikettierungsproblematik, Behinderung, Foucault, Butler, Macht, Normalisierung, Körper, Subjektivität, Anerkennung, Dekategorisierung, Intersektionalität.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Leerstellen aufzuzeigen, die sich aus der Anwendung queertheoretischer Konzepte auf die Behinderungsdiskussion ergeben, und die Interdependenzen zwischen Queer Studies, Disability Studies und inklusiver Bildung zu analysieren.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden geboten?
Die HTML-Datei enthält Zusammenfassungen zu allen Kapiteln, inklusive Einleitung, theoretischem Rahmen, der Analyse der Interdependenzen zwischen den verschiedenen Studienfeldern, der kritischen Auseinandersetzung mit den Leerstellen in der Etikettierungsproblematik und einem Ausblick.
- Arbeit zitieren
- Laura Marie Siebert (Autor:in), 2021, Queertheoretische Perspektiven auf Behinderung. Leerstellen in der Etikettierungsproblematik der inklusiven Bildung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1132284