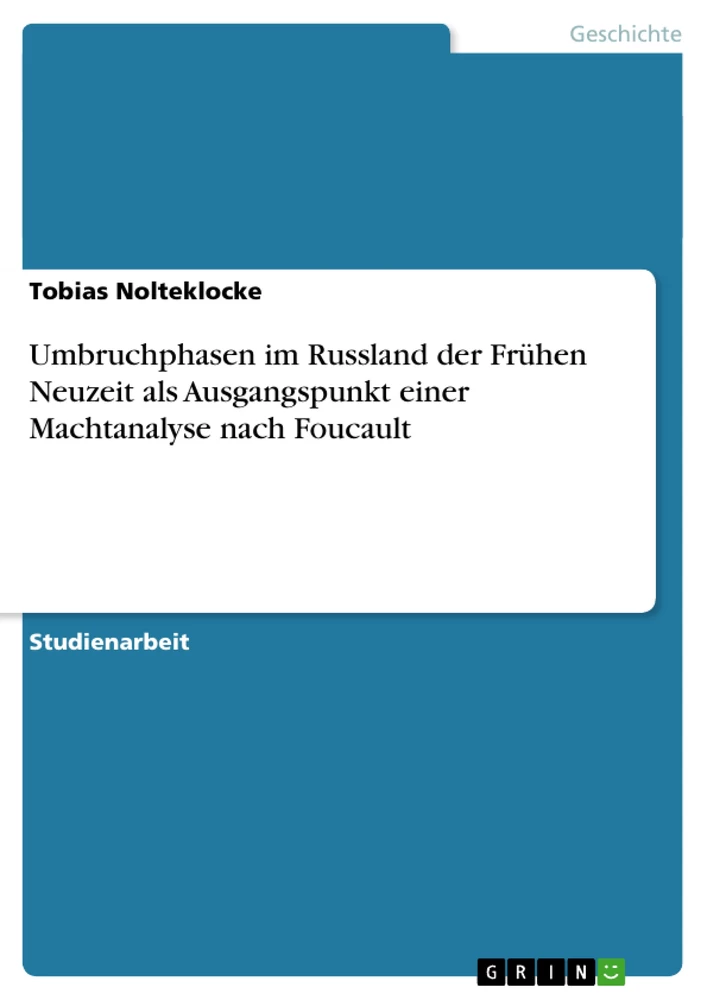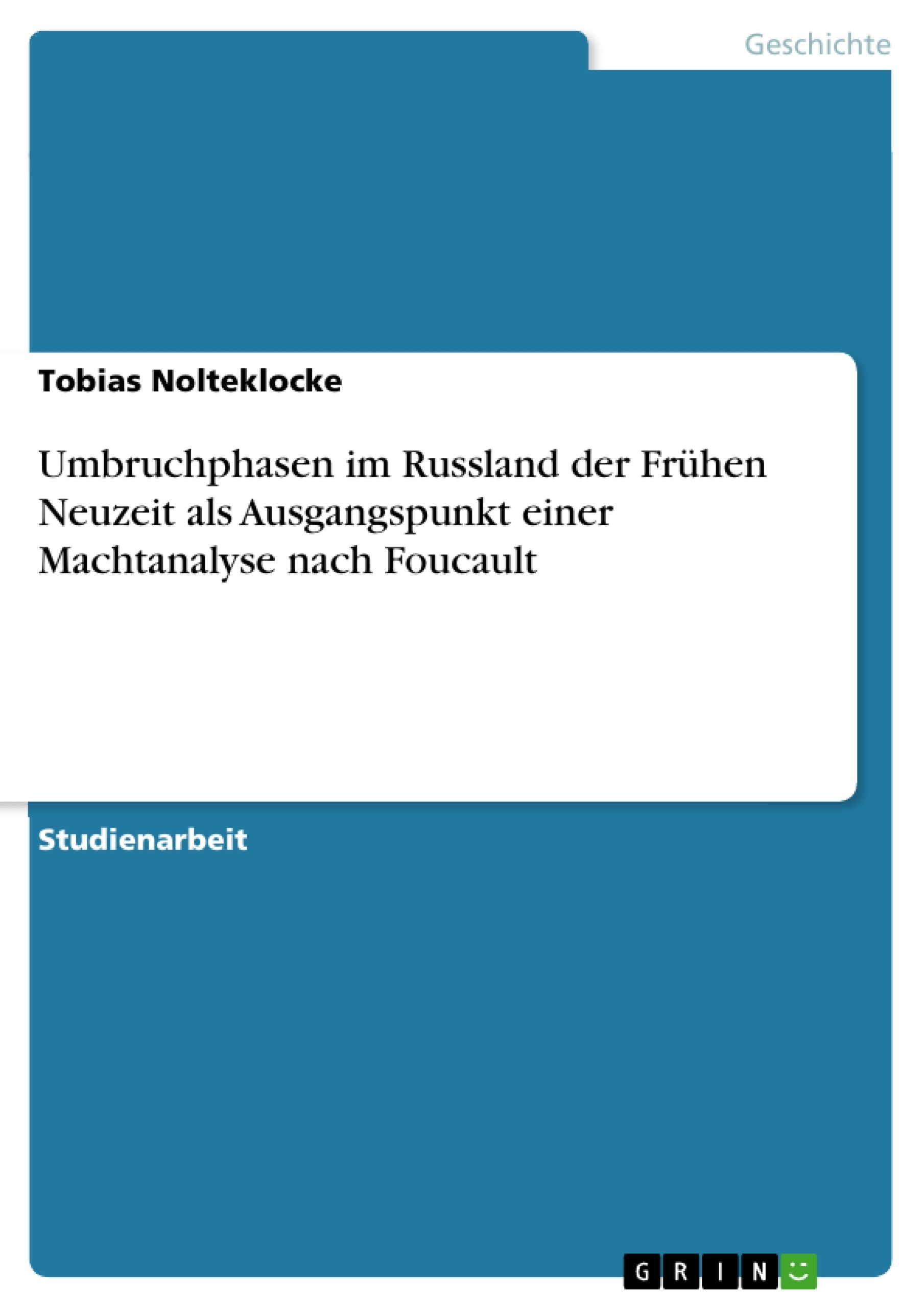Herrschaft bzw. Machtausübung wird nicht allein von „oben nach unten“ ausgeübt, vielmehr bestehen in der Mentalität der Herrscher und Beherrschten „Andockpunkte“, die zu einem Austausch führen. Neben rationalen Elementen (z.B. materielle Anreize) können auch
irrationale Elemente wie Religion, Traditionen solche Andockpunkte darstellen. Mithilfe dieser Andockpunkte kommt es bei der Machtausübung gleichzeitig zu Verhandlungen über dieselbe
zwischen den Akteuren. Es bildet sich eine spezifische Form des Herrschens heraus, welche mit dem Begriff der Gouvernementalität umschrieben werden kann. Der Begriff der Gouvernementalität deutet darauf hin, dass Herrschaftsausübung auch über Interessensgegensätze hinweg auf kollektive Mentalitäten aufgelagert ist. Dabei kommt es zur Akzeptanz von Herrschaft, die als vernünftig, notwendig oder als unvermeidlich angesehen
wird. Es ergibt sich einerseits also eine Herrschaft im Einverständnis mit den Beherrschten, die andererseits allerdings nicht unumschränkt gilt, sondern zwischen den beteiligten Akteuren
immer neu verhandelt wird. Diese Perspektive auf Machtverhältnisse, die auf die Arbeiten des Franzosen Michel Foucault zurückgeht, wird auf seine Anwendbarkeit für das Russland der frühen Neuzeit überprüft.
Hauptthese ist dabei, dass die Macht der russischen Zaren nicht unumschränkt war, sondern durch ein spezifisches Machtgefüge durch den Adel begrenzt wurde.
Untersuchungsgegenstand sind also die Machtverhältnisse zwischen den Zaren und dem Russischen Adel. Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich vom 15. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.
Da der Hauptzweck dieser Arbeit die Darlegung eines theoretischen Ansatzes und die Prüfung seiner Anwendbarkeit auf das Verhältnis zwischen Zar und Adel ist, wird in dieser Arbeit im Hinblick auf die historischen Fakten von einem Referenztext ausgegangen. Ausgewählt wurde der Aufsatz „Der russische Adel von 1700 bis 1917“ von Manfred Hildermaier, der sich nach eigener Aussage nicht mit politischer Macht beschäftigt. Es wird sich jedoch zeigen lassen, dass mit dem Ansatz von Foucault aus diesem Text Aussagen über die Machtverhältnisse im Russland der frühen Neuzeit erarbeitet werden können. An geeigneter Stelle werden zudem
aktuellere Arbeiten herangezogen oder auf diese verwiesen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen und Begrifflichkeiten des Russischen Adels
- Der Begriff der Gouvernementalität
- Michel Foucault und die Entwicklung seines Ansatzes
- Macht und Herrschaft
- Machtanalyse
- Machtanalyse im Russland der Frühen Neuzeit
- Die Regentschaft von Ivan IV.
- Die Regentschaft von Peter I.
- Die Regentschaft von Katharina II.
- Stärken und Schwächen des Ansatzes
- Stärken
- Schwächen
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Machtanalyse im Russland der Frühen Neuzeit anhand des theoretischen Ansatzes von Michel Foucault. Ziel ist es, die Anwendbarkeit des Begriffs der Gouvernementalität auf die Machtverhältnisse zwischen den Zaren und dem Russischen Adel zu überprüfen. Die Arbeit analysiert die spezifischen Formen der Machtausübung und die Interaktion zwischen den Akteuren im Kontext der russischen Geschichte.
- Die Entwicklung des Begriffs der Gouvernementalität bei Michel Foucault
- Die Machtverhältnisse zwischen Zar und Adel im Russland der Frühen Neuzeit
- Die Rolle des Adels in der Machtausübung und -kontrolle
- Die Bedeutung von Traditionen, Religion und Mentalitäten für die Machtausübung
- Die spezifischen Formen der Regierungsführung im Russland der Frühen Neuzeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Hauptthese der Arbeit vor. Sie erläutert den theoretischen Rahmen der Arbeit und die Bedeutung des Begriffs der Gouvernementalität für die Analyse der Machtverhältnisse im Russland der Frühen Neuzeit. Das zweite Kapitel definiert die grundlegenden Begriffe des Russischen Adels und beschreibt die soziale Struktur dieser Gruppe. Es beleuchtet die Abhängigkeit des Adels von der zaristischen Zentralgewalt und die Rolle des Gottesgnadentums für die Legitimation der Herrschaft. Das dritte Kapitel erläutert den theoretischen Ansatz von Michel Foucault und die Entwicklung des Begriffs der Gouvernementalität. Es analysiert die verschiedenen Formen der Machtausübung und die Bedeutung von Disziplinierung und Selbstverwaltung für die Herrschaft. Das vierte Kapitel untersucht die Machtanalyse im Russland der Frühen Neuzeit anhand der Regentschaften von Ivan IV., Peter I. und Katharina II. Es analysiert die spezifischen Formen der Regierungsführung und die Interaktion zwischen Zar und Adel in diesen Epochen. Das fünfte Kapitel bewertet den Ansatz von Foucault und reflektiert seine Stärken und Schwächen im Hinblick auf die Analyse der Machtverhältnisse im Russland der Frühen Neuzeit. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und formuliert weiterführende Fragen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Machtanalyse, die Gouvernementalität, den Russischen Adel, die Zaren, die Frühe Neuzeit, die Regentschaften von Ivan IV., Peter I. und Katharina II., die Machtverhältnisse, die Disziplinierung, die Selbstverwaltung, die Traditionen, die Religion und die Mentalitäten.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Gouvernementalität“ bei Foucault?
Er bezeichnet eine Form der Herrschaftsausübung, die auf kollektiven Mentalitäten beruht und Machtverhältnisse zwischen Herrschern und Beherrschten immer neu verhandelt.
War die Macht der russischen Zaren wirklich unumschränkt?
Die Hauptthese der Arbeit lautet, dass die Macht der Zaren durch ein spezifisches Machtgefüge und die Interessen des Adels begrenzt war.
Welche Herrscher werden in der Machtanalyse untersucht?
Die Arbeit analysiert die Regentschaften von Ivan IV. (dem Schrecklichen), Peter I. (dem Großen) und Katharina II. (der Großen).
Welche Rolle spielten Religion und Tradition für die russische Macht?
Religion und Tradition dienten als „Andockpunkte“, die zur Akzeptanz der Herrschaft führten und diese als notwendig oder unvermeidlich erscheinen ließen.
Welchen Beitrag leistet der Adel zur Regierungsführung?
Der Adel war nicht nur Untertan, sondern agierte in einem Austauschverhältnis mit der Zentralgewalt, wobei Machtverhältnisse oft durch materielle Anreize oder Disziplinierung gestaltet wurden.
- Quote paper
- Tobias Nolteklocke (Author), 2008, Umbruchphasen im Russland der Frühen Neuzeit als Ausgangspunkt einer Machtanalyse nach Foucault, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113229