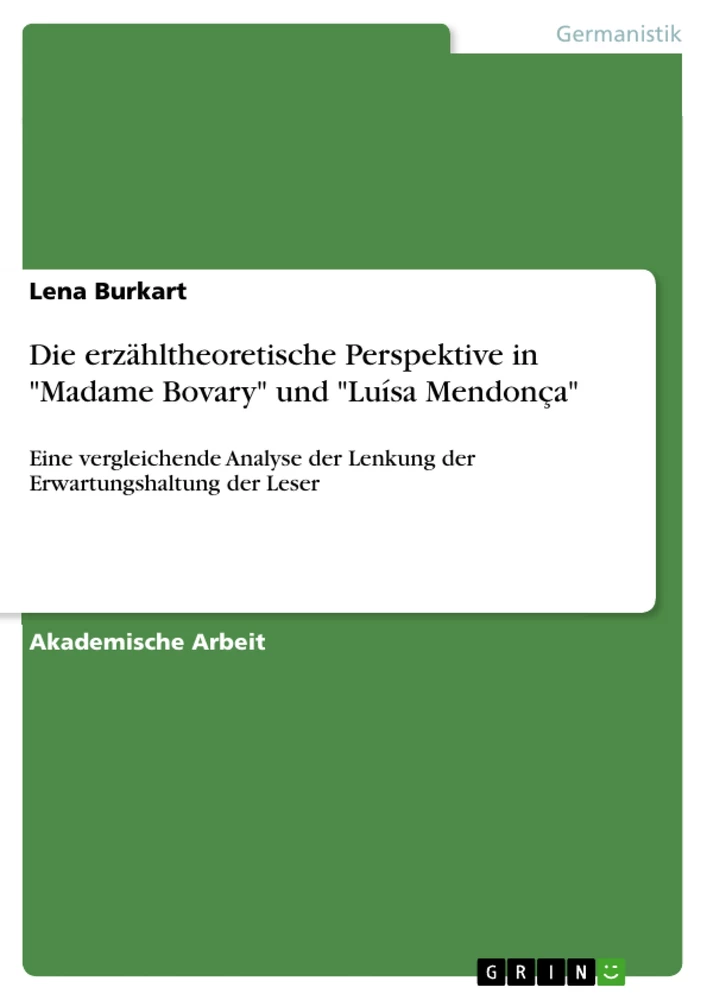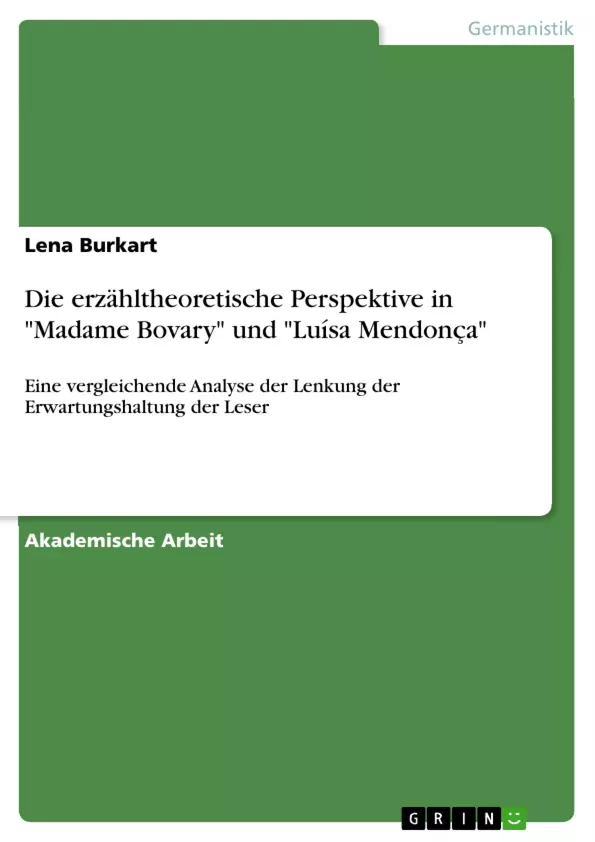Im Januar 1857 wird vor dem Pariser Polizeigericht die Hauptverhandlung gegen Gustave Flaubert eröffnet. Die Anklage gegen den bis dahin wenig bekannten Autor lautet, die öffentliche und religiöse Moral verletzt zu haben. Der Vorwurf richtet sich gegen den im selben Jahr erschienenen Erstlingsroman „Emma Bovary- Sitten der Provinz“. Darin schildert Flaubert das Leben der Emma Bovary, die durch zahlreiche Ehebrüche versucht, ihrem tristen Leben in der Provinz zu entfliehen. Dies sind Vorkommnisse, welche den damaligen Moralvorstellungen widersprechen, insbesondere die Flaubert vorgeworfene Verharmlosung des Ehebruchs. Der Prozess sorgt für Aufsehen in ganz Frankreich und bringt Flaubert zunehmende Bekanntheit ein. Trotz der schweren Vorwürfe gegen ihn, wird Flaubert letztendlich freigesprochen.
Den Freispruch hat er seinem Schreibstil zu verdanken; durch den er zudem als Wegbereiter für den Realismus gilt. Neben einer objektiven Beschreibung der Geschehnisse spielt auch die Verwendung der Perspektive eine wichtige Rolle. Bei dieser Art des Erzählens findet demnach eine subtile Lenkung des Lesers statt. Aus dieser Annahme leitet sich folgende Hauptthese ab: Die durch die Perspektive erzeugte Erwartungshaltung des Lesers lässt sich ohne eine Beschreibung der Geschehnisse selbst erfüllen. Dies soll im Folgenden durch den Vergleich des zuvor erwähnten Romans “Madame Bovary” von Gustave Flaubert und “O Primo Basílio” von Eça de Queiroz untersucht werden, mit Schwerpunkt auf den beiden Kutsch-Szenen. Des Weiteren werden die erzähltheoretische Perspektive im Sinn der “Focalisation” und die Erzählweisen der Romane miteinbezogen, um durch Untersuchung der narrativen Gestaltung die Szenen miteinander vergleichen und auswerten zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Kutschszene in „Madame Bovary\" (Teil III, 1.)
- Vorgeschichte (Teil II, 15.)
- Analyse der Kutschszene
- Die Kutschszene in „Luísa Mendonça\" (Kapitel 5)
- Vorgeschichte
- Analyse und Vergleich der Kutschszenen
- Fazit
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert zwei Kutsch-Szenen aus den Romanen „Madame Bovary“ von Gustave Flaubert und „O Primo Basílio“ von Eça de Queiroz. Ziel ist es, die Bedeutung der Perspektive und der Erzählweise für die Entstehung von Erwartungen beim Leser zu untersuchen. Dabei stehen die erzähltheoretische Perspektive der „Focalisation“ und die Erzählweisen der Romane im Vordergrund.
- Die Bedeutung der Perspektive und der Erzählweise für die Gestaltung von Erwartungen beim Leser
- Die Rolle der „Focalisation“ als erzähltheoretische Perspektive
- Vergleich der Kutsch-Szenen aus „Madame Bovary“ und „O Primo Basílio“ im Hinblick auf ihre narrative Gestaltung
- Analyse der erzähltechnischen Mittel, die in den beiden Szenen zur Konstruktion von Erwartungen beim Leser eingesetzt werden
- Zusammenhang zwischen der Darstellung der Kutsch-Szenen und der thematischen Schwerpunkte der Romane
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentralen Fragestellungen und den theoretischen Hintergrund der Arbeit dar. Sie führt außerdem die beiden Romane „Madame Bovary“ und „O Primo Basílio“ sowie ihre zentralen Figuren ein.
Das zweite Kapitel behandelt die Kutschszene in „Madame Bovary“. Zunächst wird die Vorgeschichte der Szene in Teil II, 15 beleuchtet. Im Mittelpunkt steht dabei die Ambivalenz zwischen Großstadt und Provinz, die durch die Figuren Léon und Emma repräsentiert wird. Zudem wird die Entstehung von Emmas Begehren nach einem perfekten Liebhaber untersucht, welches durch die Lektüre von romantischen Werken geprägt ist.
Das dritte Kapitel widmet sich der Kutschszene in „Luísa Mendonça“. Auch hier werden die Vorgeschichte und die relevanten Kontextfaktoren beleuchtet. Die Analyse der Kutschszene soll schließlich einen Vergleich der beiden Szenen ermöglichen, um ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Hinblick auf die Konstruktion von Erwartungen beim Leser aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Realismus, Naturalismus, „Madame Bovary“, „O Primo Basílio“, Kutschszene, Perspektive, Erzählweise, Focalisation, Erwartungshaltung, Provinzroman, Großstadt, Ehebruch, Begehren, Mimesis, romantische Literatur
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Hauptthese dieser erzähltheoretischen Untersuchung?
Die These lautet, dass die durch die Perspektive erzeugte Erwartungshaltung des Lesers sich auch ohne direkte Beschreibung der Geschehnisse erfüllen lässt.
Welche zwei Romane werden miteinander verglichen?
Verglichen werden „Madame Bovary“ von Gustave Flaubert und „O Primo Basílio“ (im Text als „Luísa Mendonça“ bezeichnet) von Eça de Queiroz.
Warum steht die „Kutsch-Szene“ im Fokus der Analyse?
Die Kutsch-Szenen dienen als Paradebeispiele für die narrative Gestaltung und die subtile Lenkung des Lesers durch die Erzählperspektive.
Was versteht man unter „Focalisation“?
Focalisation ist ein Begriff der Erzähltheorie, der beschreibt, aus wessen Sicht die Ereignisse wahrgenommen und dem Leser präsentiert werden.
Warum wurde Gustave Flaubert 1857 vor Gericht gestellt?
Ihm wurde vorgeworfen, mit „Madame Bovary“ die öffentliche und religiöse Moral verletzt und den Ehebruch verharmlost zu haben.
- Quote paper
- Lena Burkart (Author), 2017, Die erzähltheoretische Perspektive in "Madame Bovary" und "Luísa Mendonça", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1132594