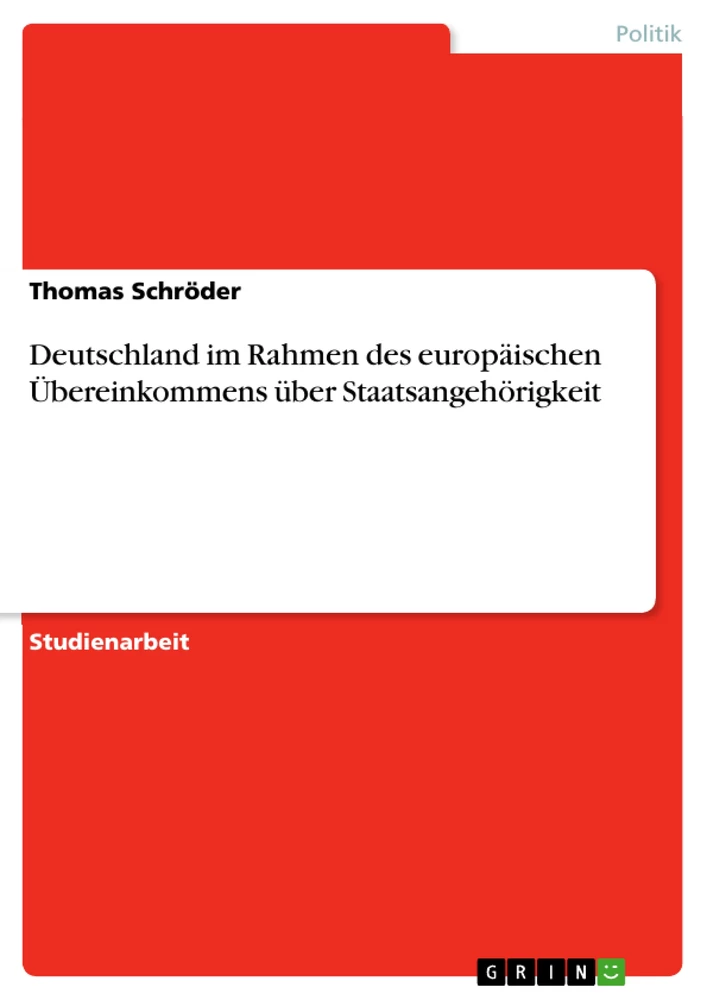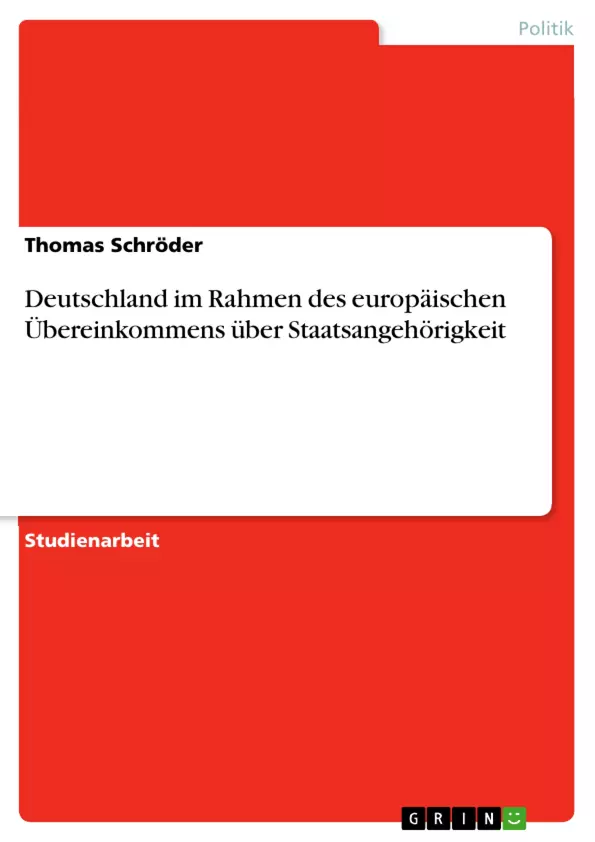Eine Notwendigkeit, Staatsangehörigkeitsfragen staatsvertraglich zu regeln ergab sich im 19. Jahrhundert aufgrund einer Auswanderungswelle von Europa nach Nord- und Südamerika. Zur Lösung des Auswanderungsproblems, wurden Verträge zwischen Ein- und Auswanderungsland geschlossen. Das erste große mehrseitige Vertragswerk zu Fragen der Staatsangehörigkeit entstand auf der Haager Kodifikationskonferenz von 1930. Nach dem zweiten Weltkrieg bemühten sich insbesondere die Vereinten Nationen um die Lösung von Staatsangehörigkeitsproblemen und trugen nachhaltig zur Verabschiedung völkerrechtlicher Verträge in diesem Bereich bei. Mit dem Übereinkommen über die Verringerung der Mehrstaatigkeit und die Wehrpflicht von Mehrstaatern vom 6. Mai 1963 sowie nachfolgenden Protokollen steht auch der Europarat in der Tradition, seinen Vertragsstaaten von supranationaler Ebene aus Regelungen zu geben. Zahlreiche Veränderungen im innerstaatlichen und internationalen Recht und natürlich die Entwicklung Europas ließen die Akteure des Europarats Ende der neunziger Jahre schließlich die Notwendigkeit einer ausführlichen Übereinkunft zu Fragen der Staatsangehörigkeit erkennen. Der Europarat verabschiedete daraufhin am 6.November 1997 ein Abkommen, mit dem nicht nur einzelne Fragen der Mehrstaatigkeit und der Wehrpflicht abgedeckt werden, sondern mit dem zum ersten Mal ein umfassendes Vertragswerk vorgelegt wurde, dass entsprechend der Ereignisse in den ehemaligen Ostblockstaaten sogar Fragen der Staatsangehörigkeit bei Staatensukzession einbezieht.
In der vorliegenden Arbeit zum Thema vom 6. November 1997 werden, die Regelungen dieses Übereinkommens in Bezug auf a) den Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit, b) Mehrstaatigkeit und Wehrpflicht und schließlich c) Staatsangehörigkeit bei Staatensukzession dargestellt.
Ausgehend von den zentralen Begriffen, die sich in Teilen in den beiden näher betrachteten Übereinkommen wieder finden, wird im zweiten Teil dieser Arbeit die Institution des Europarates, sein Aufbau, seine Instrumente und Arbeitsfelder, beleuchtet.
Im dritten Teil der Arbeit, dem Hauptteil, ein historischer Abriss zu den -Aktivitäten des Europarats in Hinblick auf die Lösung von Staatsangehörigkeitsproblemen gegeben.
Anschließend erfolgt die Darstellung der Regelungsbereiche des 1963er Übereinkommens (ETS No. 43) und seiner nachfolgenden Protokolle.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zentrale Begriffe
- Staatsangehörigkeit
- Mehrstaatigkeit und Staatenlosigkeit
- Staatensukzession
- Europarat
- Aufbau und Organe
- Arbeitsfelder und Ziele
- Übereinkommen ETS No. 43 & 166
- Historischer Hintergrund der Europarats-Aktivitäten
- Europäisches Übereinkommen vom 06.05.1963 & Protokolle
- Europäisches Übereinkommen vom 06. November 1997
- Mehrstaatigkeit und Wehrpflicht
- Staatsangehörigkeit bei Staatensukzession
- Deutschland im Kontext des Europäischen Übereinkommens
- Fazit
- Anhang
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Europäischen Übereinkommen über Staatsangehörigkeit vom 6. November 1997 und analysiert dessen Regelungen im Hinblick auf den Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit, die Mehrstaatigkeit und Wehrpflicht sowie die Staatsangehörigkeit bei Staatensukzession. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des Europarats in Bezug auf Staatsangehörigkeitsprobleme und analysiert die Position Deutschlands im Kontext der beiden Europaratsübereinkommen.
- Historische Entwicklung des Europarats in Bezug auf Staatsangehörigkeitsprobleme
- Regelungen des Europäischen Übereinkommens über Staatsangehörigkeit vom 6. November 1997
- Mehrstaatigkeit und Wehrpflicht im Kontext des Übereinkommens
- Staatsangehörigkeit bei Staatensukzession
- Position Deutschlands im Kontext der beiden Europaratsübereinkommen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Notwendigkeit der staatsvertraglichen Regelung von Staatsangehörigkeitsfragen im 19. Jahrhundert dar und beleuchtet die historischen Entwicklungen, die zur Verabschiedung völkerrechtlicher Verträge in diesem Bereich führten. Die Arbeit fokussiert sich auf das Europäische Übereinkommen vom 6. November 1997, das ein umfassendes Vertragswerk zur Staatsangehörigkeit darstellt und insbesondere Fragen der Mehrstaatigkeit, Wehrpflicht und Staatensukzession behandelt.
Das Kapitel "Zentrale Begriffe" definiert die Schlüsselbegriffe Staatsangehörigkeit, Mehrstaatigkeit und Staatenlosigkeit sowie Staatensukzession und erläutert deren Bedeutung im Kontext des Europäischen Übereinkommens. Die Staatsangehörigkeit wird als rechtliches Band zwischen einer Person und ihrem Heimatstaat definiert, das aus bestimmten Rechten und Pflichten gegenüber dem Staat resultiert. Die Mehrstaatigkeit beschreibt die gleichzeitige Staatsangehörigkeit zu mehreren Staaten, während die Staatenlosigkeit die Abwesenheit einer Staatsangehörigkeit bezeichnet. Die Staatensukzession bezieht sich auf die Rechtsnachfolge eines Staates durch einen anderen Staat.
Das Kapitel "Europarat" beleuchtet die Institution des Europarats, seinen Aufbau, seine Organe, Arbeitsfelder und Ziele. Der Europarat ist eine internationale Organisation, die sich für die Förderung der Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Europa einsetzt. Der Europarat verfügt über verschiedene Organe, darunter die Parlamentarische Versammlung, den Ministerrat und den Generalsekretär. Die Arbeit des Europarats umfasst verschiedene Bereiche, darunter die Menschenrechte, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Bildung und die Kultur.
Das Kapitel "Übereinkommen ETS No. 43 & 166" gibt einen historischen Abriss der Europarats-Aktivitäten in Bezug auf die Lösung von Staatsangehörigkeitsproblemen. Es stellt das Europäische Übereinkommen vom 6. Mai 1963 (ETS No. 43) und seine nachfolgenden Protokolle sowie das Europäische Übereinkommen vom 6. November 1997 (ETS No. 166) dar. Das Übereinkommen von 1963 befasst sich mit der Verringerung der Mehrstaatigkeit und der Wehrpflicht von Mehrstaatern, während das Übereinkommen von 1997 ein umfassendes Vertragswerk zur Staatsangehörigkeit darstellt, das auch Fragen der Staatensukzession behandelt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Europäische Übereinkommen über Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeit, Mehrstaatigkeit, Staatenlosigkeit, Staatensukzession, Wehrpflicht, Europarat, Deutschland, Völkerrecht, internationales Recht, Rechtsnachfolge, Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was regelt das Europäische Übereinkommen über Staatsangehörigkeit von 1997?
Es ist ein umfassendes Vertragswerk des Europarats, das den Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit, Mehrstaatigkeit, Wehrpflicht sowie Fragen der Staatensukzession regelt.
Was versteht man unter Staatensukzession?
Staatensukzession bezeichnet die Rechtsnachfolge eines Staates durch einen anderen, zum Beispiel nach dem Zerfall des Ostblocks, und die damit verbundenen Fragen zur Staatsangehörigkeit der Bürger.
Welche Ziele verfolgt der Europarat bei Staatsangehörigkeitsfragen?
Der Europarat strebt die Verringerung von Staatenlosigkeit an und möchte klare supranationale Regelungen schaffen, um Konflikte bei Mehrstaatigkeit und Wehrpflicht zu vermeiden.
Wie steht Deutschland zu den Übereinkommen des Europarats?
Die Arbeit analysiert die Position Deutschlands im Kontext des Übereinkommens von 1963 (ETS No. 43) und des neueren Abkommens von 1997 sowie deren Umsetzung in nationales Recht.
Was ist der Unterschied zwischen Mehrstaatigkeit und Staatenlosigkeit?
Mehrstaatigkeit bedeutet, dass eine Person mehrere Staatsangehörigkeiten gleichzeitig besitzt. Staatenlosigkeit hingegen bedeutet, dass keine rechtliche Bindung zu irgendeinem Staat besteht.
Warum wurden Staatsangehörigkeitsfragen völkerrechtlich geregelt?
Die Notwendigkeit entstand bereits im 19. Jahrhundert durch Auswanderungswellen und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Vereinten Nationen und den Europarat weiter vorangetrieben.
- Quote paper
- Thomas Schröder (Author), 2005, Deutschland im Rahmen des europäischen Übereinkommens über Staatsangehörigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113291