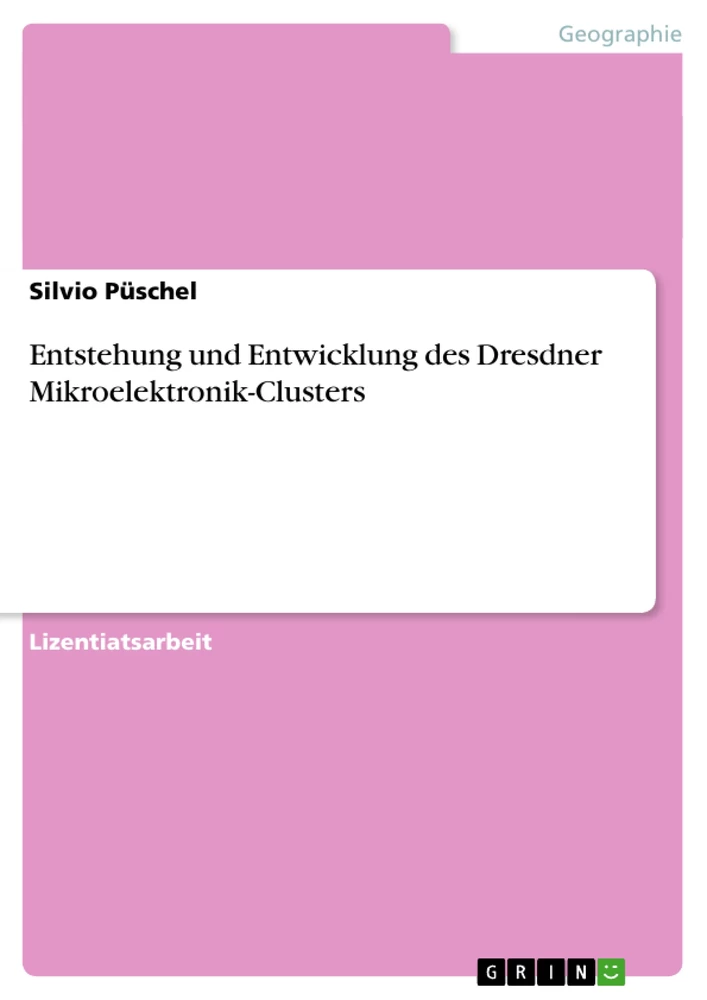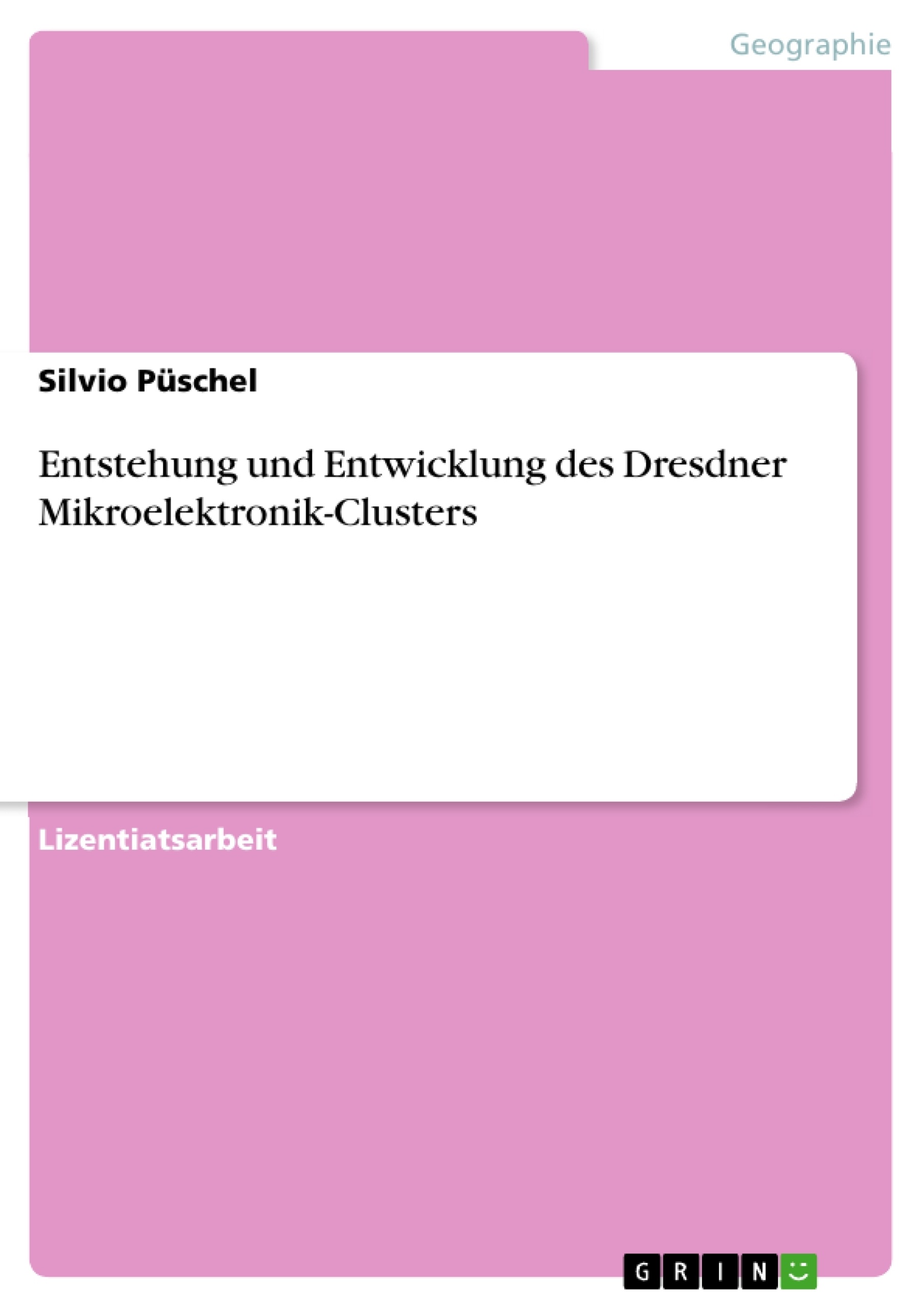Die Mikroelektronik ist eine Schlüsseltechnologie unserer Zeit. Ihre Produkte begegnen uns häufig im täglichen Leben. Ohne sie würde es z.B. keine Mobilfunktelefone und Computer geben. Sie ermöglicht verbesserte Informations- und Kommunikationstechnologien und ebnete damit den Weg für die Globalisierung der Wirtschaft.
Mit der Globalisierung verliert der Standort eines Unternehmens eigentlich an Bedeutung, da Kapital und Waren kostengünstiger transferierbar sind. Das Gegenteil ist jedoch der Fall, der Standort und damit die Standortwahl von Unternehmen haben eine zunehmende Bedeutung bekommen (vgl. Fritsch et al., 1998, 244 f.). Dabei werden die innovativsten und wachstumsstärksten Regionen in der jeweiligen Branche bevorzugt. Der führende Standort in der Mikroelektronik ist das „Silicon Valley“ in den USA. Es ist das Musterbeispiel für einen erfolgreichen Cluster (vgl. Saxenian, 1985).
Cluster bieten eine Erklärung dafür, warum der Standort immer wichtiger wird, sich bestimmte Regionen wirtschaftlich besser entwickeln und Unternehmen in diesen Regionen meist innovativer sind (vgl. Porter, 1998). Auch in Deutschland existieren Cluster, wie z.B. die optische Industrie in Wetzlar (vgl. Enright, 2003, 109), die Essbesteckindustrie in Solingen (vgl. van der Linde, 2003, 141) und die optoelektronische Industrie in Jena (vgl. Krätke und Scheuplein, 2001, 9). Ein weiterer deutscher Cluster ist dem Vorbild „Silicon Valley“ im Bezug auf seinen Namen und der Branche ähnlich. Die Rede ist vom „Silicon Saxony“, dessen Zentrum in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden liegt. In dieser Stadt hat sich in den letzten Jahren ein innovativer und wachstumsstarker Standort der Mikroelektronik entwickelt.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Cluster
- 2.1.1. Begriffsdefinition
- 2.1.2. Merkmale
- 2.1.3. Entstehung und Entwicklung
- 2.2. Eigenschaften und Entstehung von Wissen
- 2.3. Lokales Wissen: Spillover und Transaktionskosten
- 2.4. Die Bedeutung von „face-to-face“-Kontakten
- 2.5. Pfadabhängigkeit von Regionen
- 3. Die Entstehung des Dresdner Mikroelektronik-Clusters
- 3.1. Vielfältige Wurzeln
- 3.2. Gründung einer „Arbeitsstelle“
- 3.3. Zeit der Kombinate
- 3.4. Niedergang und Gründungswelle
- 3.5. Bau der „,Leuchttürme“
- 3.6. Ergebnisse der bisherigen Entwicklung
- 4. Standortfaktoren
- 4.1. Humankapital
- 4.2. Infrastruktur
- 4.3. Netzwerke
- 4.4. Politik und finanzielle Förderung
- 4.5. Die räumliche Nähe zu Chemnitz und Freiberg
- 4.6. Weitere Standortfaktoren
- 5. Der Dresdner Mikroelektronik-Cluster
- 5.1. Beschreibung des Clusters
- 5.1.1. Geographischer Bereich
- 5.1.2. Internationale Bedeutung
- 5.1.3. Innovationsfähigkeit
- 5.1.4. Eigentümerstruktur
- 5.2. Funktionsweise des Clusters
- 5.2.1. Horizontale Beziehungen
- 5.2.2. Vertikale Beziehungen
- 6. Fazit
- Literaturverzeichnis
- Interviewpartner
- Anhang
- I. Biographie: Prof. Dr.-Ing. habil. Werner Hartmann
- II. Chronologische Übersicht zur Entwicklung der ZMD AG
- III. Profile von Unternehmen und Forschungseinrichtungen
- 1. Hersteller
- a. Advanced Micro Devices, Inc. Saxony Limited Liability Company & Co. KG
- b. Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. OHG
- c. KSW Microtec AG
- d. Microelectronic Packaging Dresden GmbH
- e. Philips Semiconductors Dresden AG
- f. RHe Microsystems GmbH
- g. SAW Components Dresden GmbH
- h. Zentrum Mikroelektronik Dresden AG
- 2. Forschungseinrichtungen
- a. Advanced Mask Technology Center GmbH & Co. KG
- b. Forschungszentrum Rossendorf e. V., Institut für Ionenstrahlphysik und Materialforschung
- c. Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen, Außenstelle Entwurfsautomatisierung Dresden
- d. Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme
- e. Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahlentechnik
- f. Technischen Universität Dresden, Institut für Halbleiter- und Mikrosystemtechnik
- 3. Zulieferer
- a. DuPont Photomasks Germany GmbH
- b. Süss MicroTec Test Systems GmbH
- IV. Niederlassungen internationaler Ausrüstungshersteller in Dresden
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung des Dresdner Mikroelektronik-Clusters. Ziel ist es, die Entstehung und Entwicklung des Clusters zu analysieren und die wichtigsten Standortfaktoren zu identifizieren. Dabei werden die theoretischen Grundlagen der Clusterforschung sowie die Bedeutung von Wissen, Spillover-Effekten und „face-to-face“-Kontakten beleuchtet. Die Arbeit untersucht die Rolle der Pfadabhängigkeit von Regionen und die Bedeutung von Politik und finanzieller Förderung für die Clusterentwicklung.
- Die Entstehung und Entwicklung des Dresdner Mikroelektronik-Clusters
- Die wichtigsten Standortfaktoren des Clusters
- Die Rolle von Wissen, Spillover-Effekten und „face-to-face“-Kontakten
- Die Bedeutung von Pfadabhängigkeit und Politik für die Clusterentwicklung
- Die Funktionsweise des Clusters und seine internationalen Beziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und stellt die Forschungsfrage sowie die Zielsetzung der Arbeit dar. Kapitel 2 behandelt die theoretischen Grundlagen der Clusterforschung. Es werden die Begriffsdefinition, die Merkmale und die Entstehung von Clustern erläutert. Außerdem werden die Eigenschaften und die Entstehung von Wissen sowie die Bedeutung von Spillover-Effekten und „face-to-face“-Kontakten für die Clusterentwicklung diskutiert. Kapitel 3 analysiert die Entstehung des Dresdner Mikroelektronik-Clusters. Es werden die vielfältigen Wurzeln des Clusters, die Gründung einer „Arbeitsstelle“, die Zeit der Kombinate, der Niedergang und die Gründungswelle sowie der Bau der „Leuchttürme“ beleuchtet. Kapitel 4 untersucht die wichtigsten Standortfaktoren des Clusters. Es werden das Humankapital, die Infrastruktur, die Netzwerke, die Politik und die finanzielle Förderung sowie die räumliche Nähe zu Chemnitz und Freiberg analysiert. Kapitel 5 beschreibt den Dresdner Mikroelektronik-Cluster und seine Funktionsweise. Es werden der geographische Bereich, die internationale Bedeutung, die Innovationsfähigkeit, die Eigentümerstruktur sowie die horizontalen und vertikalen Beziehungen des Clusters dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Mikroelektronik-Cluster, die Clusterentwicklung, die Standortfaktoren, das Humankapital, die Infrastruktur, die Netzwerke, die Politik und die finanzielle Förderung, die Spillover-Effekte, die „face-to-face“-Kontakte, die Pfadabhängigkeit von Regionen, die internationale Bedeutung, die Innovationsfähigkeit und die Funktionsweise des Clusters. Der Text beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des Dresdner Mikroelektronik-Clusters und analysiert die wichtigsten Faktoren, die zu seinem Erfolg beigetragen haben.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem "Silicon Saxony"?
Es bezeichnet den Mikroelektronik-Cluster in Dresden, der nach dem Vorbild des Silicon Valley entstanden ist und heute ein führender Standort in Europa ist.
Welche Standortfaktoren begünstigten die Entwicklung in Dresden?
Wichtige Faktoren waren hochqualifiziertes Humankapital, eine starke Infrastruktur, politische Förderung und die räumliche Nähe zu Forschungszentren in Chemnitz und Freiberg.
Warum sind "face-to-face"-Kontakte in einem Cluster wichtig?
Der direkte persönliche Austausch fördert den Wissenstransfer (Spillover-Effekte) und stärkt das Vertrauen zwischen den Netzwerkpartnern.
Welche Rolle spielten die "Leuchttürme" für Dresden?
Großinvestitionen von Unternehmen wie AMD (heute Globalfoundries) und Infineon wirkten als Ankerpunkte, die zahlreiche Zulieferer und Forschungseinrichtungen anzogen.
Was bedeutet Pfadabhängigkeit in Bezug auf Dresden?
Es beschreibt, wie historische Wurzeln (z.B. die Mikroelektronik-Tradition der DDR-Kombinate) die Basis für den heutigen Erfolg des Standorts bildeten.
- Arbeit zitieren
- Silvio Püschel (Autor:in), 2004, Entstehung und Entwicklung des Dresdner Mikroelektronik-Clusters, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113346