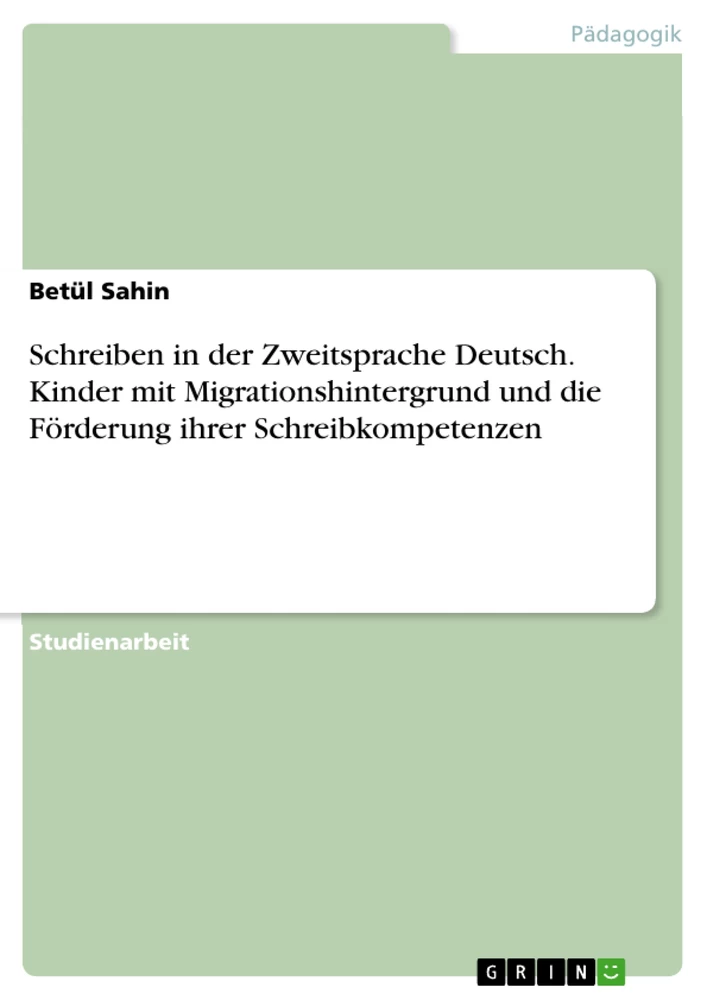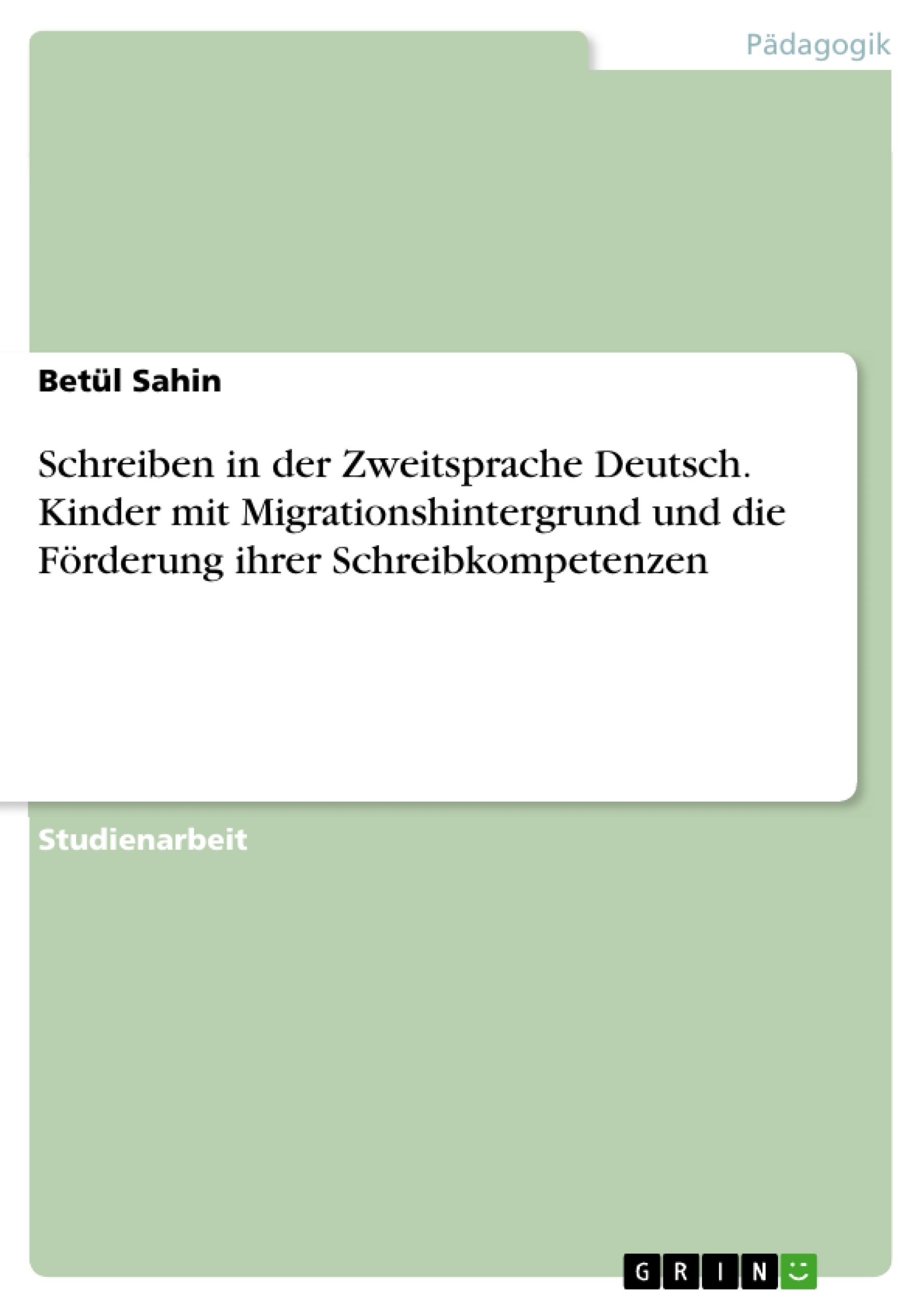Sind die Schulleistungen der Kinder mit einem Migrationshintergrund schlechter? Wie kann die Förderung der Schreibkompetenz erfolgen? Diese Fragen sollen im Laufe der Arbeit analysiert werden. Am Anfang der wissenschaftlichen Arbeit wird die Schreibkompetenz mit einem passenden Modell erläutert. Daraufhin erfolgt die Definition des Schreibprozesses sowie die Entwicklung und die Vorstellung eines Modelles. Infolgedessen wird das Kapitel „Definition Deutsch als Zweitsprache“ näher erklärt. Der letzte Abschnitt handelt von der Messung, Beurteilung und der Förderung in der Zweitsprache Deutsch.
Das Beherrschen der Schrift wird in dem deutschen Kulturkreis spätestens nach Beendigung der Schule vorausgesetzt. Die Schriftsprache ist eine Art Mitteilung und beinhaltet gedankliche Prozesse. Der Schreiber konzipiert einen Schreibplan, sammelt und ordnet seine Gedanken für das Schreiben, um Reflexionen über ein Thema darzulegen. Einen Text auf Papier zu bringen ist viel mehr als Buchstaben auf das Papier zu schreiben, auch wenn sich das anfänglich als schwer erweist. Diese Schwierigkeiten machen sich oft bei Schülerinnen und Schülern bemerkbar, die einen Migrationshintergrund aufweisen. Mehr als ein Viertel der deutschen Bevölkerung besitzt nämlich einen Migrationshintergrund. Daher ist heute ein Klassenzimmer ohne ein Kind, welches einen Migrationshintergrund aufweist, kaum vorstellbar. Es komm immer wieder mal, dass Eltern ihren Kindern als erstes die eigene Muttersprache beibringen. Dadurch erwerben diese Kinder die deutsche Sprache erst mit Beginn des Kindergartens und sind daher den Erstsprachlern sprachlich unterlegen. Dieser Nachteil macht sich im Laufe der Schullaufbahn bemerkbar. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Schreibkompetenz der Lernenden von Anfang an zu fördern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Schreibkompetenz
- 2.1. Ein Schreibkompetenzmodell
- 3. Prozesse beim Erwerb des Schreibens
- 3.1. Definition des Schreibprozesses
- 3.2. Entwicklung des Schreibprozesses
- 3.3. Das Modell von Hayes & Flower
- 4. Prozessorientierte Schreibdidaktik
- 4.1. Definition Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
- 4.2. Schriftlichkeit in der Zweitsprache
- 5. Schreibkompetenzen messen, beurteilen und fördern in der Zweitsprache
- 5.1. Messung von Schreibkompetenz in der Zweitsprache Deutsch
- 5.2. Beurteilung von Schreibkompetenz in der Zweitsprache Deutsch
- 5.3. Förderung von Schreibkompetenz in der Zweitsprache Deutsch
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Schreibkompetenz von Kindern mit Migrationshintergrund. Ziel ist es, die Herausforderungen und Möglichkeiten der Förderung dieser Schüler im Bereich des Schreibens zu analysieren. Dabei wird insbesondere die Rolle der Zweitsprachigkeit und die Bedeutung eines prozessorientierten Schreibdidaktik-Ansatzes beleuchtet.
- Entwicklung der Schreibkompetenz bei Kindern mit Migrationshintergrund
- Herausforderungen und Chancen des Schreibens in der Zweitsprache
- Modellvorstellungen zum Schreibprozess und deren Relevanz für den Unterricht
- Bedeutung der prozessorientierten Schreibdidaktik für die Förderung der Schreibkompetenz
- Methoden zur Messung, Beurteilung und Förderung von Schreibkompetenz in der Zweitsprache Deutsch
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik des Schreibens für Kinder mit Migrationshintergrund in den deutschen Kontext. Sie erläutert die Bedeutung der Schreibkompetenz und die Herausforderungen, die sich aus dem Spracherwerb in der Zweitsprache ergeben. Kapitel 2 führt den Begriff der Schreibkompetenz ein und stellt ein Modell vor, das die verschiedenen Teilkompetenzen des Schreibens beschreibt. Kapitel 3 widmet sich der Entwicklung des Schreibprozesses und stellt verschiedene Modellvorstellungen vor, die den Schreibprozess als ein komplexes System von kognitiven Prozessen beschreiben. Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem Konzept der Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und beleuchtet die Besonderheiten des Schreibens in der Zweitsprache. Der Zusammenhang zwischen Zweisprachigkeit und Schulleistung wird ebenfalls behandelt. Kapitel 5 widmet sich der Messung, Beurteilung und Förderung der Schreibkompetenz in der Zweitsprache Deutsch.
Schlüsselwörter
Schreibkompetenz, Migrationshintergrund, Deutsch als Zweitsprache, Schreibprozess, prozessorientierte Schreibdidaktik, Schreibentwicklung, Schreibstrategie, Messung, Beurteilung, Förderung
Häufig gestellte Fragen
Warum haben Kinder mit Migrationshintergrund oft Nachteile beim Schreiben?
Oft erwerben sie Deutsch erst als Zweitsprache (DaZ) im Kindergarten, wodurch sie Erstsprachlern in der schriftlichen Ausdrucksfähigkeit zunächst unterlegen sein können.
Was ist ein Schreibkompetenzmodell?
Es beschreibt die verschiedenen Teilkompetenzen (z. B. Planung, Formulierung, Überarbeitung), die für das erfolgreiche Verfassen eines Textes notwendig sind.
Was bedeutet prozessorientierte Schreibdidaktik?
Hierbei steht nicht nur das fertige Produkt im Fokus, sondern der gesamte Weg des Schreibens inklusive Entwurfsphasen und Reflexion.
Wie kann man Schreibkompetenz in der Zweitsprache fördern?
Durch gezielte Schreibstrategien, prozessorientierte Unterstützung und eine wertschätzende Beurteilung, die den individuellen Lernfortschritt berücksichtigt.
Was besagt das Schreibprozess-Modell von Hayes & Flower?
Es unterteilt das Schreiben in drei Hauptprozesse: Planung (Planning), Übersetzung in Sprache (Translating) und Überprüfung (Reviewing).
- Citar trabajo
- Betül Sahin (Autor), 2021, Schreiben in der Zweitsprache Deutsch. Kinder mit Migrationshintergrund und die Förderung ihrer Schreibkompetenzen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1133498