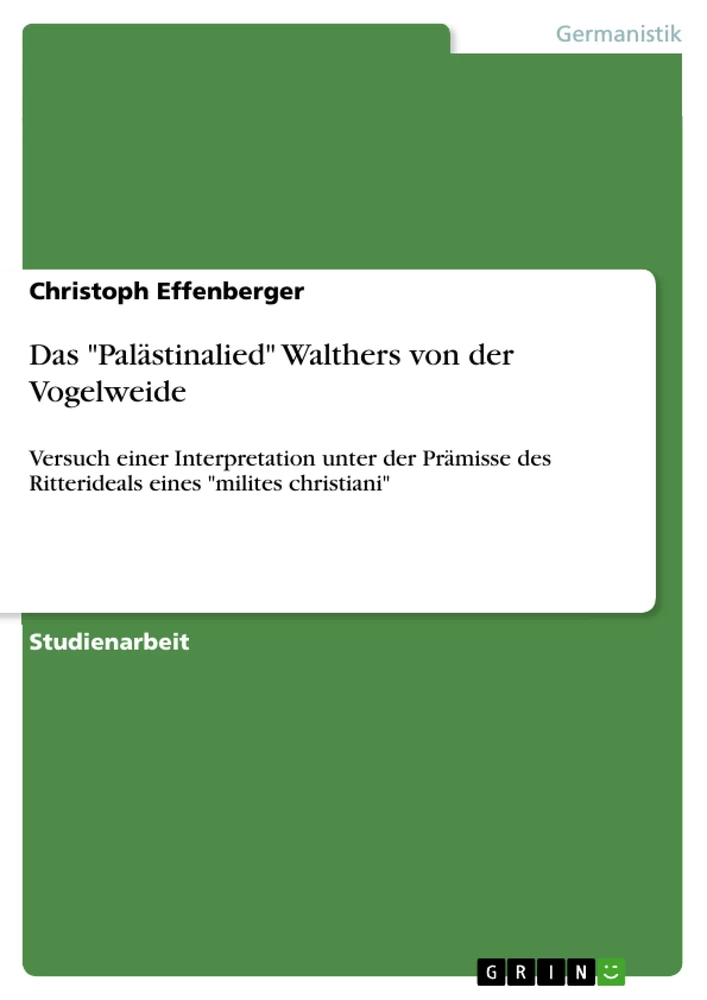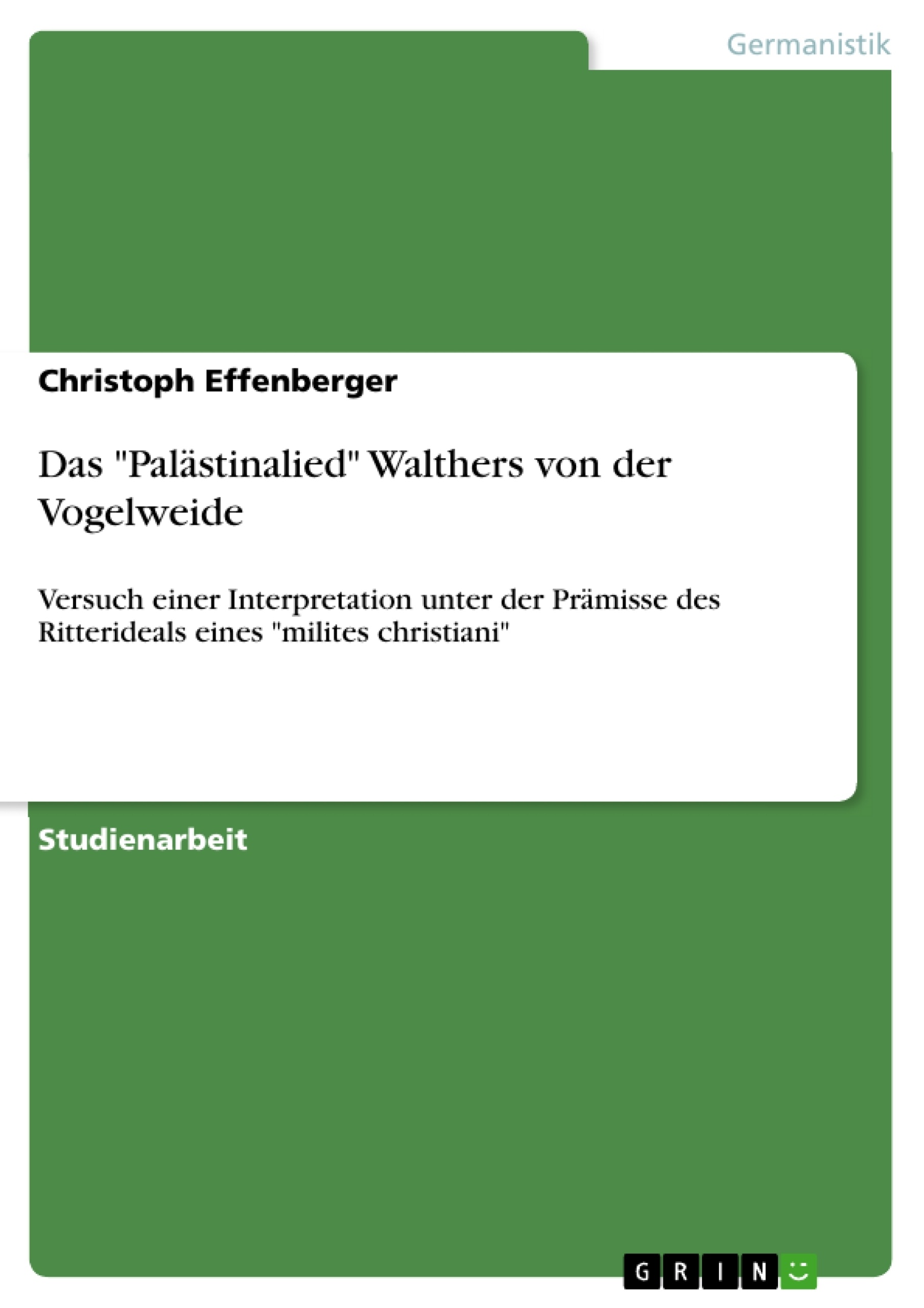Über das sogenannte „Palästinalied“ Walthers von der Vogelweide existiert ein umfangreiches Korpus an wissenschaftlichen Beiträgen. Das dominierende Thema der vergangenen Forschungsdiskussionen war die Frage nach der wahren Anzahl und der Echtheit der insgesamt 12 überlieferten Strophen. Seit der Arbeit von Volker Schupp aus dem Jahre 1964, die den Aufbau und den Inhalt des „Palästinaliedes“ glaubwürdig auf die „Sieben-Siegel-Reihen der Apokalypse“ der geistlichen Literatur bzw. auf das Leben und die Passion Jesu zurückgeführt hat, darf dieser Diskurs als beendet angesehen werden. Den Ergebnissen Schupps folgend habe ich für meine Untersuchung den überlieferten Gesamtkanon des Liedes auf die Strophen L 14, 38 / L 15, 6 / L 15, 13 / L 15, 20 / L 15, 27 /
L 15, 34 / L 16,1 / L 16, 8 und L 16, 29 beschränkt.
Mit dem breiten wissenschaftlichen Konsens zur Strophenanzahl bzw. -echtheit haben die Mediävisten das Interesse am „Palästinalied“ fast völlig verloren. Auslöser hierfür mögen die fehlenden Kenntnisse zur chronologischen und damit kontextuellen Einordnung des Liedes gewesen sein. Ein gewisses Aufsehen erregte die Entdeckung, dass es sich bei Walthers religiösem Lied um eine metrisch-melodische Kontrafaktur des provenzalischen Minneliedes „Lanquan li jorn son lonc en mai“ von Jaufre Rudel handelt. Die Bewertung dieser Feststellung ist jedoch sehr schwierig, weitläufig und nach der mir vorliegenden Literatur noch nicht vollständig abgeschlossen.
Neben diesen fundamentalen Erkenntnissen existieren verschiedenste Interpretations- und Deutungsversuche des „Palästinaliedes“, die thematisch um den religiösen Tenor des Textes kreisen .
Christa Ortmann hat im Jahr 2001 eine Untersuchung des lyrischen Ich im „Palästinalied“ vorgelegt. Ausgangspunkt ihrer Analyse ist die Sprecherrolle eines „Pilgers“ im Heiligen Land. Die Identifizierung des von Walther installierten Sprechers mit einem ritterlichen Kreuzfahrer lehnte Ortmann mit dem Verweis auf die Strophe L 124, 35 der sogenannten „Elegie“ ab. Dieser Rückschluss wird auf den ersten Blick durchaus vom rein religiösen Tenor des Liedes bestätigt. Auch im Standardwerk zur Kreuzzugsdichtung von Wentzlaff-Eggebert wird jeglicher Bezug zum Höfisch-Ritterlichen abgelehnt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung, Forschungsdiskussion, Fragestellung
- Hauptteil
- Das Ritterideal des „,milites christiani" und seine Widerspiegelung im ,,Palästinalied".
- Die Sprecherrolle eines „milites christiani“ - Kulturgeschichtliche Hintergründe und mögliche Motive Walthers.
- Abschlussbetrachtung
- Bibliographie
- Monographien und Herausgeberschaften
- Zeitschriftenartikel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit einer Interpretation des „Palästinaliedes“ von Walther von der Vogelweide unter der Prämisse des Ritterideals eines „milites christiani“. Ziel ist es, die Sprecherrolle des Liedes im Kontext der Kreuzzugsbewegung und des neuen Ritterideals zu analysieren und die kulturgeschichtlichen Hintergründe und Motive Walthers zu beleuchten.
- Das Ritterideal des „milites christiani“ und seine Merkmale im „Palästinalied“
- Die Sprecherrolle eines „milites christiani“ im „Palästinalied“
- Kulturgeschichtliche Einflüsse auf die Entstehung und den Inhalt des Liedes
- Die latenten Auseinandersetzungen zwischen römischer Kurie und deutschem Kaiserhaus
- Die mögliche Motivation Walthers zur Installierung einer Sprecherrolle mit ritterlich-christlichem Hintergrund
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Forschungsdiskussion zum „Palästinalied“ und stellt die Fragestellung der Arbeit vor. Der Hauptteil analysiert das Ritterideal des „milites christiani“ und seine Widerspiegelung im „Palästinalied“. Dabei werden die kulturgeschichtlichen Hintergründe und möglichen Motive Walthers zur Installierung einer Sprecherrolle mit ritterlich-christlichem Hintergrund beleuchtet. Die Abschlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das „Palästinalied“, Walther von der Vogelweide, das Ritterideal des „milites christiani“, die Kreuzzugsbewegung, die kulturgeschichtlichen Hintergründe, die Sprecherrolle, die Motive Walthers, die Auseinandersetzungen zwischen römischer Kurie und deutschem Kaiserhaus.
- Quote paper
- Christoph Effenberger (Author), 2004, Das "Palästinalied" Walthers von der Vogelweide, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113369