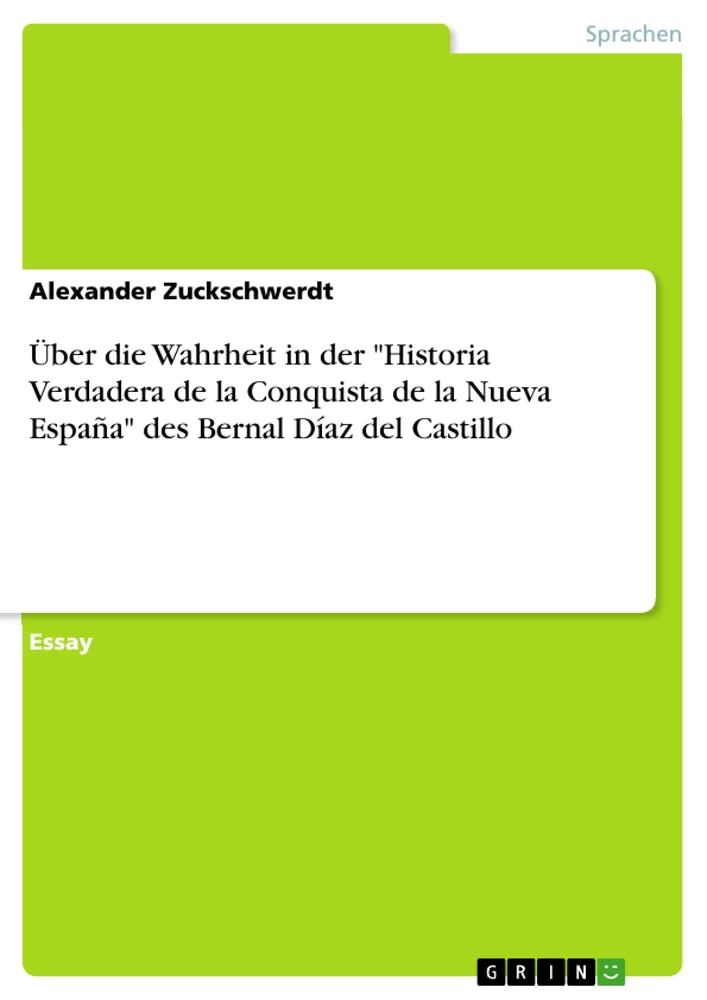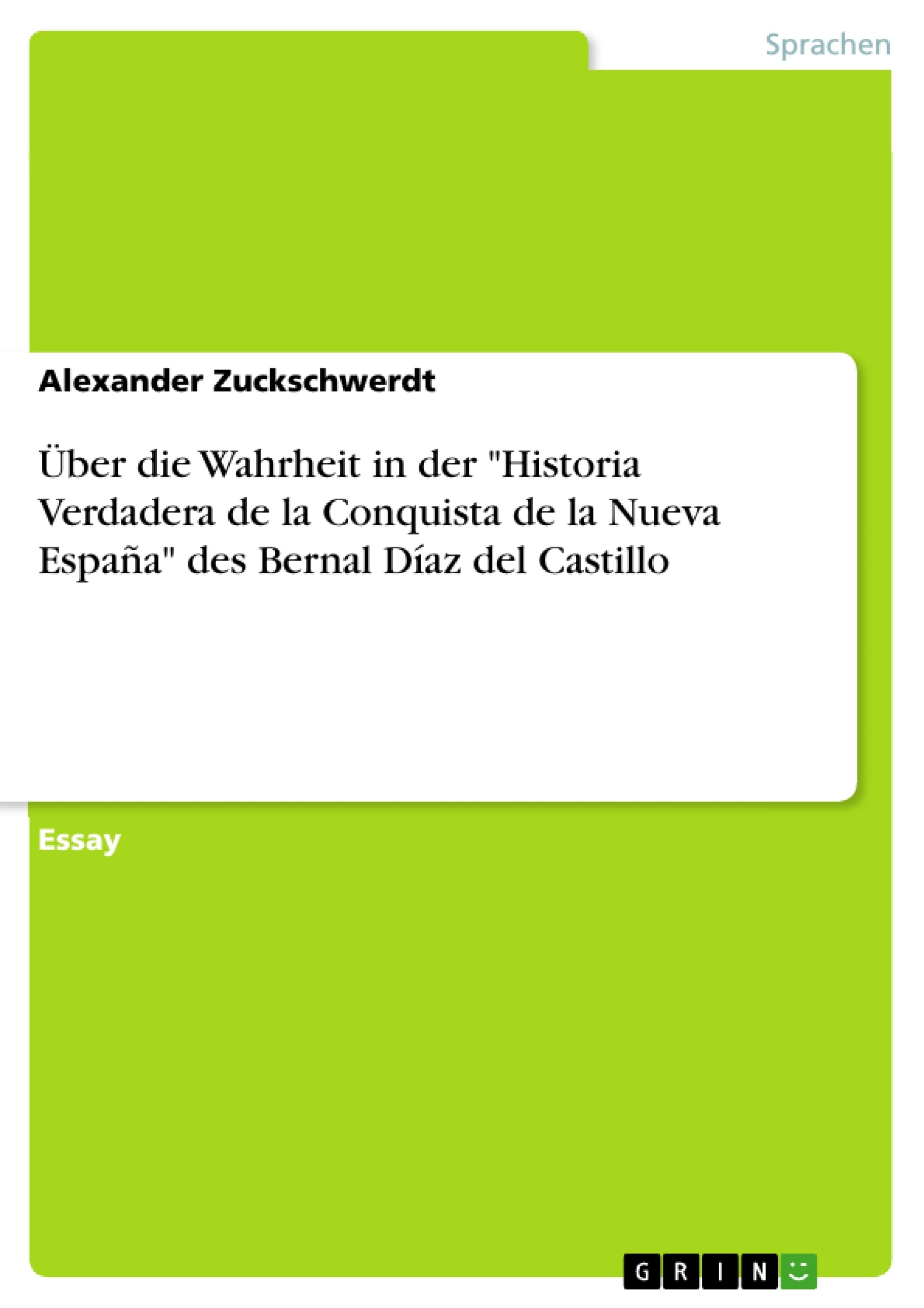Trotz der wiederholten Versicherung, „que lo que en este libro se contiene, va muy verdadero“ , die der Autor der Eroberungschronik Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo, dem Leser vom ersten Kapitel an gibt, ist dieser Wahrheitsgehalt bereits – und das zu Recht – kritisch hinterfragt und angezweifelt worden. Die insgesamt 214 Kapitel der Historia Verdadera des Soldaten, der sowohl unter dem Kommando von Francisco Hernández de Córdoba als auch Juan de Grijalva, hauptsächlich jedoch unter der Führung von Hernán Cortés an der Eroberung Mexikos und Guatemalas mitwirkte, dokumentieren einen Zeitabschnitt von ungefähr 54 Jahren, der seinen Auftakt im Jahre 1514 hat und bis zur Fertigstellung des Buches im Jahre 1568 reicht.
Nicht genug, dass allein das weit vorangeschrittene Alter des Autors von über 70 Jahren berechtigte Zweifel an der Verlässlichkeit der geschilderten Ereignisse aufkommen lässt; darüber hinaus ist es insbesondere der zeitliche Abstand zu den Geschehnissen, die Bernal Díaz zum Teil in Zitaten wiedergeben zu können meint, der die dem Text so oft attestierte Wahrheitstreue aus kritischer Sicht zuweilen nur schwierig nachvollziehen lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Trotz der wiederholten Versicherung, „que lo que en este libro se contiene, va muy verdadero“¹, die der Autor der Eroberungschronik Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo, dem Leser vom ersten Kapitel an gibt, ist dieser Wahrheitsgehalt bereits und das zu Recht – kritisch hinterfragt und angezweifelt worden.
- Die insgesamt 214 Kapitel der Historia Verdadera des Soldaten, der sowohl unter dem Kommando von Francisco Hernández de Córdoba als auch Juan de Grijalva, hauptsächlich jedoch unter der Führung von Hernán Cortés an der Eroberung Mexikos und Guatemalas mitwirkte, dokumentieren einen Zeitabschnitt von ungefähr 54 Jahren, der seinen Auftakt im Jahre 1514 hat und bis zur Fertigstellung des Buches im Jahre 1568 reicht.
- Nicht genug, dass allein das weit vorangeschrittene Alter des Autors von über 70 Jahren² berechtigte Zweifel an der Verlässlichkeit der geschilderten Ereignisse aufkommen lässt; darüber hinaus ist es insbesondere der zeitliche Abstand zu den Geschehnissen, die Bernal Díaz zum Teil in Zitaten wiedergeben zu können meint, der die dem Text so oft attestierte Wahrheitstreue³ aus kritischer Sicht zuweilen nur schwierig nachvollziehen lässt.
- Wie bekannt ist, bestand Bernal Díaz' Ansporn zur Niederschrift seiner Chronik (die gewissermaßen auch seine Memoiren enthält) primär in der Richtigstellung' der von Francisco López de Gómara (1511-1566), dem Sekretär und Hauskaplan Hernán Cortés', vorgenommenen Aufzeichnungen zu den Feldzügen des Medelliners in La Conquista de México (1551).
- Bernals grundlegendes Argument, auf das er im Laufe seines Buches zahlreiche Male zu sprechen kommt, liegt in der Tatsache begründet, dass Gómara in keiner Weise an der Eroberung teilgenommen hatte; dass er stattdessen nur dem Diktat seines Herren folgte und somit über Dinge schrieb, von denen er nichts wusste, außer dem, was ihm durch Cortés zugetragen wurde.
- Seine einzige Aufgabe, so Bernal Díaz, hätte darin bestanden, die 2 egozentrierte Erzählung des Feldherrn in einem ästhetisch ansprechenden und grammatisch korrekten Schriftstück zu fixieren, ohne dabei dem heldenhaften Mitwirken der einfachen Soldaten Tribut zu zollen beziehungsweise es überhaupt zu erwähnen: [...] lo qual] descubrimos a nuestra costa sin ser [sabidor] dello [Su Magestad, y hablando aquí] en respuesta de lo que an d[icho] y [escripto] person[as que no lo alcançaron] a saber, ni lo vieron, ni tener no[tiçia ver] dad[era de lo que sobre esta materia] propusieron, salvo habla[r a sabor de] su paladar [por escureçer, si pudiesen, nuestros] muchos y notables serviç[ios], porque no aya fama [dellos ni sean tenidos en tan]ta estima como son dinos de tener [...]ª
- Etwas weiter, im Kapitel XVIII, nimmt er erneut Bezug auf diejenigen Chronisten, an die er seine Vorwürfe richtet, und referiert gleichsam den Beweggrund für die Verschriftlichung seiner Version der Eroberungskampagnen: Estando escriviendo en esta mi corónica, acaso vi lo que escriven Gómara e Illescas y Jovio en las conquistas de México y Nueva España; y desque las leí y entendí, y vi de su policia y estas mis palabras tan groseras y sin primor, dexé d'escrevir en ella estando presentes tan buenas istorias. Y con este pensamiento torné a leer y a mirar muy bien las pláticas y razones que dizen en sus istorias y desde el principio y medio ni cabo no hablan lo que pasó en la Nueva España [...]
- Es geht aus dieser Passage nicht nur die klare Bezichtigung der historiographischen Verfälschung gegen „Gómara e Illescas y Jovio“ hervor, die für den Autor der Historia Verdadera als das distinktive Merkmal zwischen ihm und seinen Zeitgenossen fungiert; vielmehr wird hier auch deutlich, in welche assoziative Nähe Bernal Díaz den Authentizitätswert des Geschriebenen mit seinem stilistischen Wert zu bringen versucht.
- Dieses Charakteristikum im Schreibstil des Medinaers, welches sich in dem gesamten Text als omnipräsent erweist und das aus eben diesen „palabras tan groseras“ hervorgeht, verstärkt den Eindruck von Spontaneität und Unmittelbarkeit und simuliert somit eine größere Realitätsnähe, Authentizität und Unverfälschtheit des Textes.
- Bernal Díaz ob intendiert oder tatsächlich aufgrund von rhetorischem Unvermögen – beansprucht für seinen Text keine besondere Eloquenz, die, laut Bernals Reaktion auf Gómaras Schrift, sogar einschüchternd auf den Leser wirken kann („,dexé d'escrevir“); seine Wahrheit kommt aus dem Inhalt und verbirgt sich nicht hinter umständlichen Formulierungen und gelehrten Ausdrücken.
- Sie ist eine für jedermann erkenntliche und nachvollziehbare Wahrheit, die sich in einem schlichten, gleichförmigen Erzählstil präsentiert und deren Hauptmerkmal das der Enumeratio, der Aneinanderreihung mittels der Konjunktion y/e ist.
- Das Geschriebene erhält dadurch das Erscheinungsbild einer oralen Erzählung, wodurch wiederum eine größere gefühlte Nähe zwischen Text/Autor und Leser geschaffen wird, da sich bei letzterem der Eindruck einstellt, einem ihm direkt referierten Tatsachenbericht beizuwohnen.
- Gleichsam als befände der Leser sich in einem Dialog mit dem Urheber des Textes, lässt er sich von diesem seine ,Veteranengeschichte“ erzählen.
- Dieses (bewusst oder unbewusst erzeugte) hermeneutische Nähe- oder auch Vertrautheitsverhältnis prägt sich, außer auf der strukturellen Ebene, auch im Inhalt aus.
- So errichtet Bernal Díaz ein ideologisches Schlachtfeld, wo zuvor keines bestand, nämlich zwischen seinem Feind - Gómara und seinem Freund · dem Leser - indem er einen rein rhetorisch begründeten Pakt zwischen seinem Publikum und den wahren Eroberern schließt, der sich nun gegen den gemeinsamen Feind richten soll: [...] y no lo vieron ni entendieron quando lo escrivían [Gómara, Illescas y Jovio], que los verdaderos conquistadores y curiosos letores que saben lo que pasó, claramente les dirán que si todo lo que escriven de otras istorias va como lo de la Nueva España, irá todo herrado."
- Das Fundament für dieses Bündnis errichtet Bernal Díaz auf der Kenntnis über „lo que pasó“, das heißt, die Kenntnis über die wahren Umstände der Feldzüge in Amerika.
- Wer möchte als Leser schon von sich behaupten müssen, er wüsste nicht, was wirklich vorging, und das womöglich aufgrund einer irreführenden Lektüre? Ergo bleibt dem „curioso letor“ keine andere Wahl als die wahrhafte Geschichte eines Augenzeugen zu lesen, um sich ein klares und vor allem stimmiges Bild von den „,notables serviç[ios]" machen zu können.
- Einmal mehr schafft der Autor somit eine klare Abgrenzung zu seinen erklärten Nachkriegsfeinden, denjenigen nämlich, die schreiben, ohne jemals dort gewesen zu sein.
- Nur dass er sich in diesem Fall auf geschickte Weise Verstärkung zu verschaffen weiß.
- Die bis hierher dargelegte Motivation Bernals für seine Historia Verdadera, nämlich die Korrektur der bisherigen Geschichtsschreibung (die damals den Rang einer solchen erst noch erreichen musste) 10, wie sie von Ohrenzeugen wie Gómara verfasst worden war, erhält jedoch noch eine zusätzliche Nuance, die das Streben des ehemaligen königlichen Soldaten nach Ruhm und Anerkennung der geleisteten Dienste um eine eher wirtschaftlich orientierte Komponente erweitert.
- Erneut entwickelt Bernal Díaz eine strategisch geschickte Überleitung zu seinem eigentlichen Anliegen, wenn er im Kapitel CCX damit beginnt, die zahlreichen Errungenschaften der Eroberer zu benennen („los bienes que ya e propuesto que de nuestras eroicas conquistas an recresçido“)" und dem Leser – in diesem Falle natürlich dem König in erster Linie - auf der Basis eines Tauschhandels, treue Dienste gegen materielle Güter, seine persönlichen Forderungen nach Rekompensation verständlich zu machen.
- Obgleich er keine konkreten Vorstellungen äußert, weist er doch mit Nachdruck auf seine Stellung als „el más antiguo [conquistador] de todos“ und auf seine zu diesem denkwürdigen Umstand im Gegensatz stehende ökonomische Lage hin: „Y digo esto con tristeza de mi coraçon porque me veo pobre y muy viejo [...]".12
- Nicht nur in der Schilderung seiner persönlichen Lage, sondern auch in Bezug auf konkrete Ereignisse während der Eroberung selbst schreckt Bernal Díaz nicht vor Übertreibungen und Beanspruchungen zurück, die ihrerseits ebenso unrichtig bzw. ungenau sind, wie die, die er mit seinem Text bei anderen zu widerlegen und korrigieren vorgibt.
- So gibt er im zweiten Kapitel an, die Provinz Yucatan entdeckt zu haben, was allerdings bereits 1511 unter Pedro de Valdivia (wenn auch nicht erfolgreich) geschehen war.
- Diese Untreue seinen eigenen Prinzipien gegenüber, nebst der schon erwähnten zeitlichen Distanz, dem fortgeschrittenen Alter, den persönlichen Rivalitäten unter den jeweiligen Chronisten, dem steten Versuch des Autors, persönliche Vorteile zu erhalten und den zahlreichen Übernahmen Bernals just aus der Chronik, die er in seiner Schrift anklagt, 17 lässt den Text Bernals letztendlich nicht wesentlich glaubwürdiger erscheinen als den Gómaras.
- BIBLIOGRAPHIE
- Díaz del Castillo, Bernal (2005): Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. Hrsg.: José Antonio Barbón Rodríguez. Mexiko Stadt: u.a. El Colegio de México.
- Díaz del Castillo, Bernal (1988): Die Eroberung von Mexiko. Hrsg.: Georg A. Narciẞ. Frankfurt/M.: Insel.
- Díaz del Castillo, Bernal (1982): Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. Hrsg.: Carmelo Saenz de Santa María. Madrid: Instituto “Fernández de Oviedo”.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España von Bernal Díaz del Castillo und untersucht die Frage nach der Wahrheit in der Chronik. Sie beleuchtet die Motivationen des Autors, seine Kritik an anderen Chronisten, insbesondere Francisco López de Gómara, und die stilistischen Mittel, die er einsetzt, um seine Version der Geschichte als authentisch und wahrhaftig darzustellen.
- Die Authentizität der Historia Verdadera
- Die Motivationen Bernal Díaz' für die Niederschrift seiner Chronik
- Die Kritik an anderen Chronisten, insbesondere Francisco López de Gómara
- Der Schreibstil Bernal Díaz' und seine stilistischen Mittel
- Die Rolle der Wahrheit in der Geschichtsschreibung der Conquista
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse der Behauptung Bernal Díaz', dass seine Historia Verdadera die „wahre“ Geschichte der Conquista darstellt. Der Autor beleuchtet die Zweifel, die an der Wahrheitstreue des Textes bestehen, und untersucht die Gründe für diese Zweifel, wie das fortgeschrittene Alter des Autors, den zeitlichen Abstand zu den Ereignissen und die persönlichen Rivalitäten zwischen den Chronisten.
Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Motivation Bernal Díaz' für die Niederschrift seiner Chronik untersucht. Der Autor zeigt auf, dass Bernal Díaz' Hauptanliegen darin bestand, die von Francisco López de Gómara verfasste Geschichte der Conquista zu korrigieren, die er als verzerrt und unvollständig ansieht.
Die Arbeit analysiert die Kritik Bernal Díaz' an Gómara und anderen Chronisten, die seiner Meinung nach die Geschichte der Conquista falsch darstellen. Der Autor untersucht die Argumente Bernal Díaz' und zeigt auf, dass er die eigene Teilnahme an der Conquista als entscheidenden Faktor für die Authentizität seiner Geschichte ansieht.
Die Arbeit untersucht den Schreibstil Bernal Díaz' und die stilistischen Mittel, die er einsetzt, um seine Version der Geschichte als authentisch und wahrhaftig darzustellen. Der Autor zeigt auf, dass Bernal Díaz' Schreibstil von Spontaneität und Unmittelbarkeit geprägt ist und dass er bewusst auf eine einfache und klare Sprache setzt, um seine Geschichte für jedermann verständlich zu machen.
Die Arbeit schließt mit einer Diskussion über die Rolle der Wahrheit in der Geschichtsschreibung der Conquista. Der Autor zeigt auf, dass die Geschichte der Conquista von verschiedenen Perspektiven und Interpretationen geprägt ist und dass die Frage nach der Wahrheit in der Geschichte immer wieder neu gestellt werden muss.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo, die Conquista, die Authentizität, die Wahrheit, die Geschichtsschreibung, die Kritik, Francisco López de Gómara, der Schreibstil, die Spontaneität, die Unmittelbarkeit, die einfache Sprache, die Perspektive, die Interpretation.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Bernal Díaz del Castillo?
Ein spanischer Soldat, der an der Eroberung Mexikos unter Hernán Cortés teilnahm und im hohen Alter seine Chronik „Historia Verdadera“ verfasste.
Warum wird der Wahrheitsgehalt seiner Chronik angezweifelt?
Aufgrund des großen zeitlichen Abstands zu den Ereignissen (über 50 Jahre) und seines fortgeschrittenen Alters von über 70 Jahren bei der Niederschrift.
Gegen wen richtete sich Bernal Díaz mit seinem Werk?
Primär gegen Francisco López de Gómara, den er beschuldigte, eine verfälschte Geschichte zugunsten von Cortés geschrieben zu haben, ohne selbst dabei gewesen zu sein.
Welchen Schreibstil pflegte Bernal Díaz?
Er nutzte einen schlichten, fast oralen Erzählstil mit „groben Worten“, um Authentizität und die Perspektive des einfachen Soldaten zu vermitteln.
Welche persönlichen Ziele verfolgte der Autor mit dem Buch?
Neben der Richtigstellung der Geschichte suchte er nach Ruhm, Anerkennung seiner Dienste und materieller Entschädigung durch die Krone.
- Arbeit zitieren
- Alexander Zuckschwerdt (Autor:in), 2008, Über die Wahrheit in der "Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España" des Bernal Díaz del Castillo, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113409