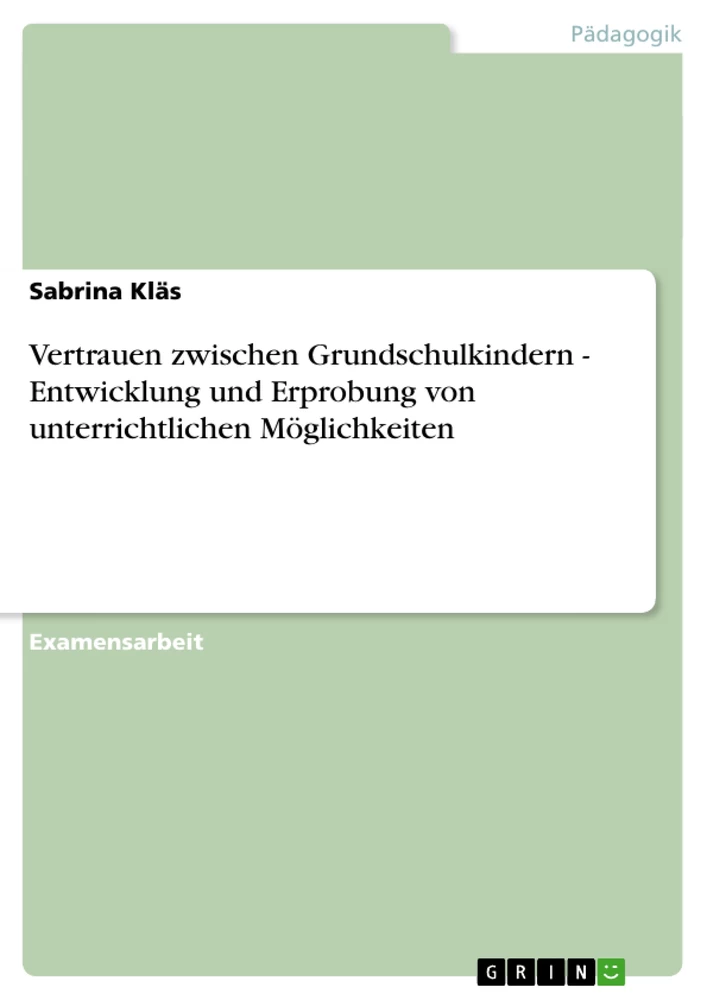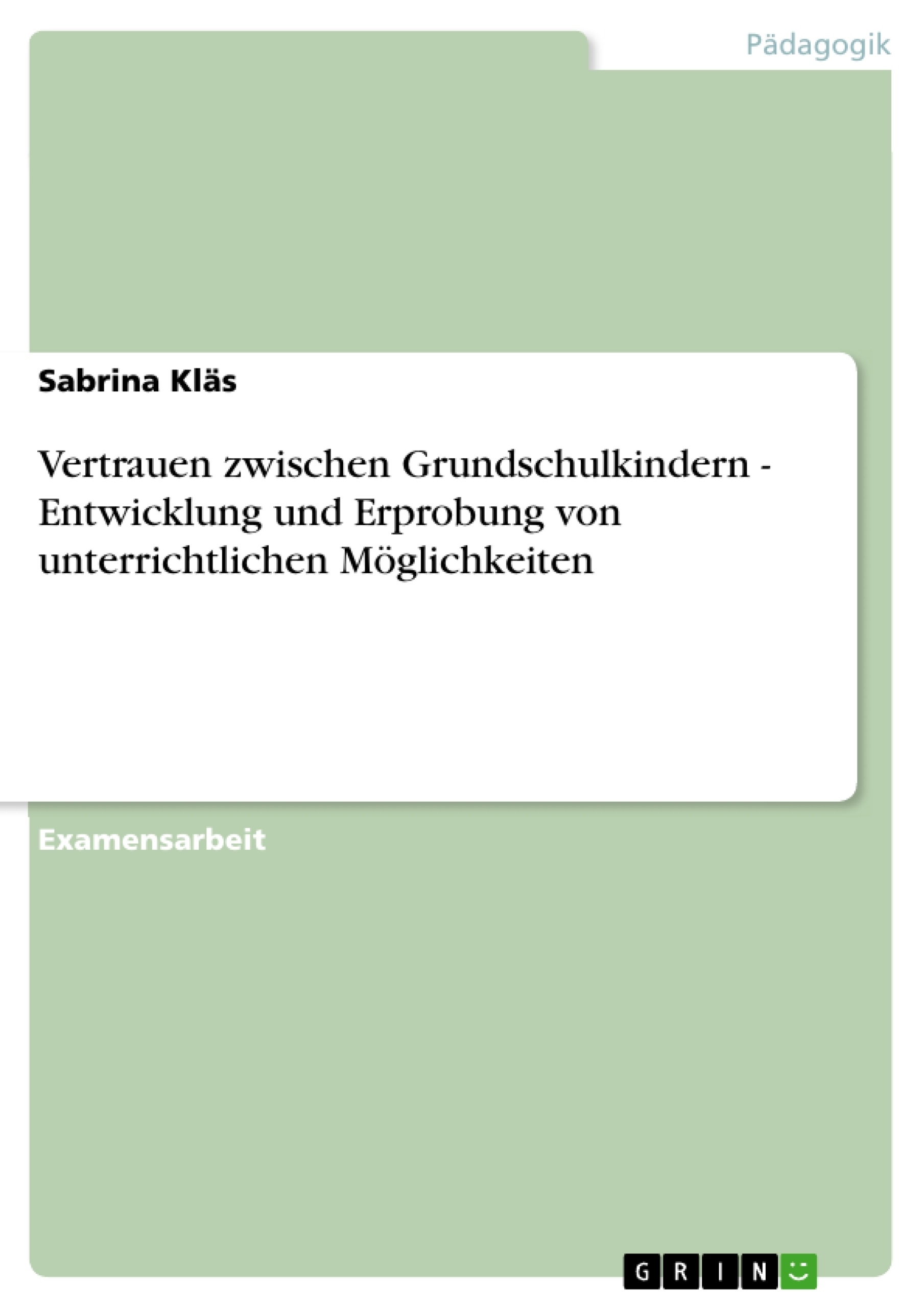Vertrauen spielt in allen Lebensbereichen eine bedeutende und nicht wegzudenkende Rolle. Es ist Voraussetzung für zwischenmenschliche
Beziehungen in Familie, Partnerschaft, Ehe, Freizeit, Arbeitswelt, Schule, Gesellschaft usw. Von ihm hängt zu einem großen Teil das Gelingen oder Scheitern zwischenmenschlicher Interaktionen und Beziehungen ab.
Auch im schulischen Bereich ist Vertrauen äußerst wichtig und bildet
die Basis eines guten Lern- und Lehrklimas. Eine einheitliche Definition gibt es allerdings nicht, da Vertrauen so komplex und universal ist, dass zu viele Assoziationen möglich sind.
Diese Arbeit geht im theoretischen Teil auf die Bedeutung von Vertrauen in der Gesellschaft und für Kinder ein. Sie stellt verschiedene Definitionsvorschläge und Merkmale von Vertrauen sowie theoretische Ansätze vor, um einen Einblick in die Entwicklungen und Wissensstände zu liefern. Des Weiteren bezieht
sie sich auf den Prozess beim Vertrauensaufbau, auf den Vertrauensverlust und die Störungen, die auf die Entwicklung von Vertrauensbeziehungen einwirken. Weitere wichtige Kapitel stellen die Kapitel 5 und 6 des theoretischen Teils dar, in denen auf die Entwicklung von Vertrauen in der Kindheit und die pädagogische Förderung von Vertrauen in Anlehnung an das soziale Lernen
ausführlich eingegangen wird.
Im theoretischen Teil der Examensarbeit werden eine Vielzahl von Ergebnissen interessanter Studien und Theorien wiedergegeben.
Der anschließende empirische Teil dieser Arbeit stützt sich auf die Ergebnisse einer soziometrischen Befragung, eines Interviews und der durchgeführten Unterrichtseinheit in einem 3. Schuljahr mit 21 Kindern. Die soziometrische Befragung sowie das Interview fanden bei jedem Kind einzeln vor und nach der Unterrichtseinheit statt.
Die Kapitel 8 und 9 beschreiben vorwiegend die Entwicklung der Unterrichtseinheit und die Untersuchungsinstrumente. Die Kapitel 10 bis 12 konzentrieren sich auf die Ergebnisse und die Auswertung der Untersuchungen und des Unterrichts, während sich das Kapitel 13 auf den Vergleich der Ergebnisse und der Erkenntnisse der ersten und zweiten Erhebung bezieht.
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- A THEORETISCHER TEIL
- 1 Die Bedeutung von Vertrauen
- 1.1 Der Begriff des Vertrauens
- 1.2 Bedeutung von Vertrauen in der Gesellschaft
- 1.3 Bedeutung von Vertrauen für Kinder
- 2 Was ist Vertrauen?
- 2.1 Definitionsvorschläge zum Begriff „Vertrauen“
- 2.2 Vertrauen und Misstrauen
- 2.3 Vertrauen als soziale Einstellung
- 2.4 Merkmale von Vertrauen
- 2.4.1 Risiko
- 2.4.2 Beziehungsdauer
- 2.4.3 Reziprozität
- 2.4.4 Bereichsspezifität
- 2.4.5 Situative Bedingungen
- 2.4.6 Soziodemographische Merkmale des Vertrauens
- 2.5 Vertrauen im Interaktionsprozess
- 3 Theoretische Ansätze zu „Vertrauen“
- 3.1 Rahmentheorie des interpersonalen Vertrauens nach Schweer
- 3.2 Funktionalistischer Ansatz nach Luhmann
- 3.3 Soziale Lerntheorie nach Rotter
- 3.4 Sozial-kognitive Entwicklung nach Selman
- 3.5 Psychoanalytischer Ansatz nach Erikson
- 3.6 „Erwartungs x Wert-Modell“
- 3.7 Attributionstheoretischer Ansatz
- 3.8 Dissonanztheorie
- 4 Vertrauen als Prozess
- 4.1 Aufbau von Vertrauen
- 4.2 Störungen beim Aufbau von Vertrauen
- 4.3 Verlust von Vertrauen
- 5 Vertrauensentwicklung in der Kindheit
- 5.1 Die Entwicklung der Beziehungen und des kindlichen Selbst
- 5.2 Die Eltern-Kind-Beziehung und die innere Organisation des Kindes
- 5.3 Selbstkonzept und Selbstvertrauen
- 5.4 Freundschaftsbeziehungen in der Kindheit
- 5.5 Vertrauensbildung in der Schule
- 5.5.1 Bedingungen im Vertrauensprozess zwischen Lehrenden und Lernenden
- 5.5.2 Lehrerverhalten und Lehrer als Vorbild
- 5.5.3 Zeit für Schülerinnen, Schüler und Eltern
- 5.5.4 Vertrauensbildung in der Schulklasse
- 5.5.5 Gesamtschulischer Kontext
- 6 Pädagogische Förderung von Vertrauen in Anlehnung an das Konzept des sozialen Lernens
- 6.1 Begriffsbestimmung und Beschreibung von sozialem Lernen
- 6.2 Notwendigkeit und Chancen sozialen Lernens im Primarbereich
- 6.3 Zielbereiche sozialen Lernens
- 6.4 Soziales Lernen im Unterricht
- 6.5 Pädagogische Möglichkeiten
- 6.6 Lehrerverhalten
- 6.7 Die Bedeutung von sozialer Anerkennung für den Schüler
- 7 Zusammenfassung
- 1 Die Bedeutung von Vertrauen
- B EMPIRISCHER TEIL
- 8 Portrait der Klasse
- 9 Entwicklung der Unterrichtseinheit
- 10 Beschreibung der Untersuchungsinstrumente
- 10.1 Soziometrische Befragung
- 10.2 Vertrauensinterview
- 10.3 Lehrerbefragung
- 11 Evaluation der ersten Erhebung
- 11.1 Soziomatrix 1
- 11.1.1 Überblick
- 11.1.2 Mittel- und Randsummenwerte
- 11.1.3 Auswertung
- 11.2 Soziogramme zur Soziomatrix 1
- 11.2.1 Soziogramm 1: Mädchengruppe
- 11.2.2 Soziogramm 2: Jungengruppe
- 11.2.3 Beschreibung der Soziogramme
- 11.3 Soziomatrix 2
- 11.3.1 Überblick
- 11.3.2 Mittel- und Randsummenwerte
- 11.3.3 Auswertung
- 11.4 Soziogramme zur Soziomatrix 2
- 11.4.1 Soziogramm 3: Mädchengruppe
- 11.4.2 Soziogramm 4: Jungengruppe
- 11.4.3 Beschreibung der Soziogramme und Vergleich mit den tatsächlichen Vertrauensbeziehungen
- 11.5 Vertrauensinterview
- 11.1 Soziomatrix 1
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Vertrauen bei Grundschulkindern. Ziel ist es, unterrichtliche Möglichkeiten zur Förderung von Vertrauen zu entwickeln und zu erproben. Die Arbeit stützt sich auf theoretische Grundlagen und empirische Daten, die in einer konkreten Schulklasse erhoben wurden.
- Der Begriff des Vertrauens und dessen Bedeutung für Kinder
- Theoretische Ansätze zur Erklärung von Vertrauen
- Vertrauensentwicklung in der Kindheit und im schulischen Kontext
- Pädagogische Möglichkeiten zur Förderung von Vertrauen
- Empirische Untersuchung des Vertrauens in einer Grundschulklasse
Zusammenfassung der Kapitel
0 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt die Forschungsfrage sowie die Methodik. Es wird der Rahmen der Arbeit abgesteckt und die Relevanz des Themas für die Grundschulpädagogik herausgestellt.
1 Die Bedeutung von Vertrauen: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Vertrauen“ und beleuchtet dessen gesellschaftliche und kindliche Bedeutung. Es werden verschiedene Facetten des Vertrauens diskutiert und dessen Relevanz für die Entwicklung von Kindern herausgearbeitet. Die verschiedenen Aspekte legen den Grundstein für die folgenden Kapitel, indem sie die Notwendigkeit der Vertrauensförderung verdeutlichen.
2 Was ist Vertrauen?: Hier werden verschiedene Definitionsansätze des Begriffs „Vertrauen“ verglichen und kontrastiert. Es wird auf den Unterschied zwischen Vertrauen und Misstrauen eingegangen und Merkmale von Vertrauen, wie Risiko, Beziehungsdauer und Reziprozität, detailliert beschrieben. Das Kapitel schafft ein fundiertes Verständnis der komplexen Natur von Vertrauen, das für das Verständnis der weiteren Kapitel essenziell ist.
3 Theoretische Ansätze zu „Vertrauen“: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene theoretische Perspektiven auf Vertrauen, darunter die Rahmentheorie von Schweer, den funktionalistischen Ansatz von Luhmann, die soziale Lerntheorie von Rotter, sowie sozial-kognitive und psychoanalytische Ansätze. Diese verschiedenen Theorien werden kritisch gegenübergestellt und bieten ein breites Spektrum an Erklärungsmöglichkeiten für das Phänomen Vertrauen. Das Kapitel dient als theoretische Basis für die spätere Analyse der empirischen Daten.
4 Vertrauen als Prozess: In diesem Kapitel wird Vertrauen als dynamischer Prozess beschrieben, der den Aufbau, mögliche Störungen und den Verlust von Vertrauen thematisiert. Die verschiedenen Phasen und Faktoren, die den Aufbau und den Abbau von Vertrauen beeinflussen, werden ausführlich analysiert. Es wird auf die Bedeutung von Kommunikation und gegenseitigen Erwartungen hingewiesen. Dieser Abschnitt verknüpft die theoretischen Grundlagen mit der praktischen Anwendung und legt die Basis für die pädagogischen Überlegungen der folgenden Kapitel.
5 Vertrauensentwicklung in der Kindheit: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung von Vertrauen im Kindesalter, beginnend mit der Eltern-Kind-Beziehung und der Entwicklung des Selbstkonzepts. Es wird der Einfluss von Freundschaftsbeziehungen und der schulischen Umgebung auf die Vertrauensbildung untersucht. Der Fokus liegt auf den Faktoren, die die Entwicklung von Vertrauen im Kontext des Erwachsenwerdens beeinflussen. Das Kapitel bereitet den Weg zum Verständnis der pädagogischen Interventionen im darauffolgenden Kapitel.
6 Pädagogische Förderung von Vertrauen in Anlehnung an das Konzept des sozialen Lernens: Hier werden pädagogische Ansätze zur Förderung von Vertrauen im Unterricht vorgestellt, die auf dem Konzept des sozialen Lernens basieren. Es werden konkrete Methoden und Strategien erläutert, die Lehrer einsetzen können, um ein vertrauensvolles Lernklima zu schaffen. Die Ausführungen betonen die aktive Rolle des Lehrers und die Bedeutung von sozialer Anerkennung für die Schüler. Der Kapitel verbindet die theoretischen und entwicklungspsychologischen Aspekte mit konkreten pädagogischen Empfehlungen.
Schlüsselwörter
Vertrauen, Grundschulkinder, Vertrauensbildung, soziale Entwicklung, pädagogische Förderung, soziales Lernen, Lehrerverhalten, empirische Untersuchung, Soziometrie, Kindheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vertrauensbildung bei Grundschulkindern
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Vertrauen bei Grundschulkindern und entwickelt sowie erprobt unterrichtliche Möglichkeiten zur Förderung von Vertrauen. Sie basiert auf theoretischen Grundlagen und empirischen Daten, die in einer konkreten Schulklasse erhoben wurden.
Welche Themen werden im theoretischen Teil behandelt?
Der theoretische Teil befasst sich mit dem Begriff des Vertrauens, seinen verschiedenen Definitionsansätzen und seiner Bedeutung für Kinder und die Gesellschaft. Er analysiert verschiedene theoretische Ansätze (Schweer, Luhmann, Rotter, Selman, Erikson u.a.) zur Erklärung von Vertrauen und beschreibt Vertrauen als Prozess mit seinen Phasen (Aufbau, Störungen, Verlust). Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Vertrauensentwicklung in der Kindheit, der Rolle der Eltern-Kind-Beziehung, von Freundschaften und dem schulischen Kontext.
Wie wird Vertrauen pädagogisch gefördert?
Der theoretische Teil geht auf pädagogische Ansätze zur Förderung von Vertrauen im Unterricht ein, insbesondere im Kontext des sozialen Lernens. Es werden konkrete Methoden und Strategien für Lehrer vorgestellt, um ein vertrauensvolles Lernklima zu schaffen, inklusive der Bedeutung von Lehrerverhalten und sozialer Anerkennung für Schüler.
Was beinhaltet der empirische Teil der Arbeit?
Der empirische Teil beschreibt eine Untersuchung in einer konkreten Grundschulklasse. Er umfasst ein Portrait der Klasse, die Entwicklung einer Unterrichtseinheit und die Beschreibung der Untersuchungsinstrumente (soziometrische Befragung, Vertrauensinterviews, Lehrerbefragung). Die Auswertung der Daten (Soziomatrizen und Soziogramme) wird detailliert dargestellt und interpretiert, um die Vertrauensbeziehungen innerhalb der Klasse zu analysieren.
Welche konkreten Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht, wie Vertrauen bei Grundschulkindern aussieht, welche Faktoren die Vertrauensentwicklung beeinflussen und welche pädagogischen Maßnahmen zur Förderung von Vertrauen effektiv sind. Der empirische Teil untersucht konkret die Vertrauensbeziehungen innerhalb einer Schulklasse.
Welche Methoden wurden im empirischen Teil eingesetzt?
Im empirischen Teil wurden soziometrische Befragungen, Vertrauensinterviews und Lehrerbefragungen eingesetzt, um die Vertrauensbeziehungen in der untersuchten Klasse zu erfassen und zu analysieren. Die Ergebnisse wurden mit Hilfe von Soziomatrizen und Soziogrammen visualisiert und interpretiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil behandelt die Bedeutung von Vertrauen, verschiedene Definitionen, theoretische Ansätze, Vertrauen als Prozess und die Vertrauensentwicklung in der Kindheit. Der empirische Teil beinhaltet die Beschreibung der untersuchten Klasse, die Entwicklung der Unterrichtseinheit, die Beschreibung der Untersuchungsinstrumente und die Auswertung der empirischen Daten.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Vertrauen, Grundschulkinder, Vertrauensbildung, soziale Entwicklung, pädagogische Förderung, soziales Lernen, Lehrerverhalten, empirische Untersuchung, Soziometrie und Kindheit.
- Citar trabajo
- Sabrina Kläs (Autor), 2007, Vertrauen zwischen Grundschulkindern - Entwicklung und Erprobung von unterrichtlichen Möglichkeiten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113446