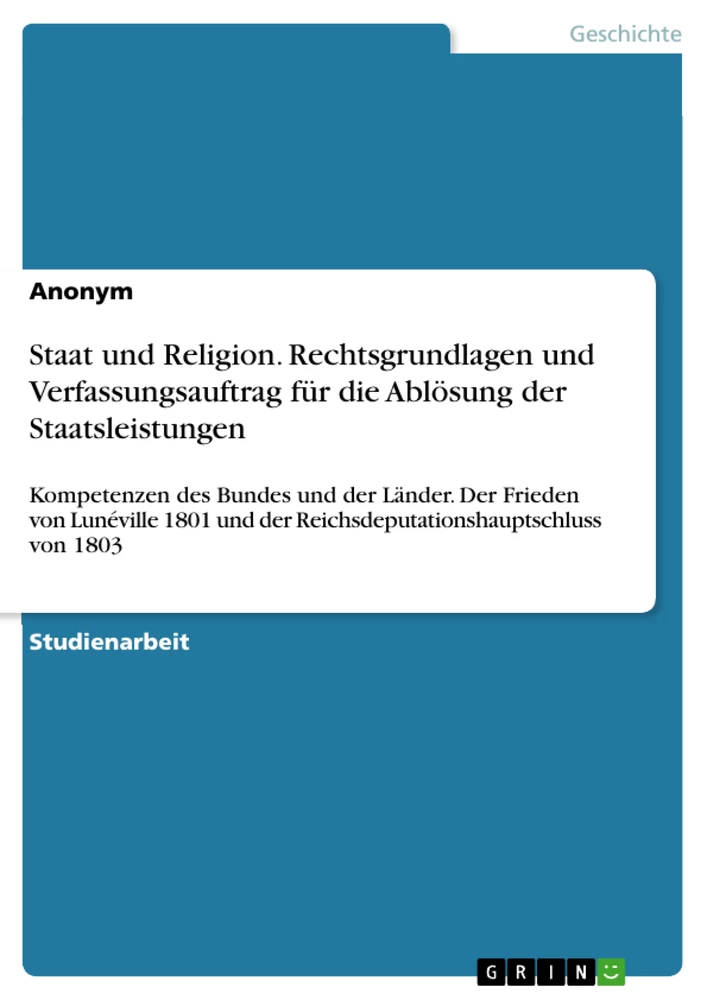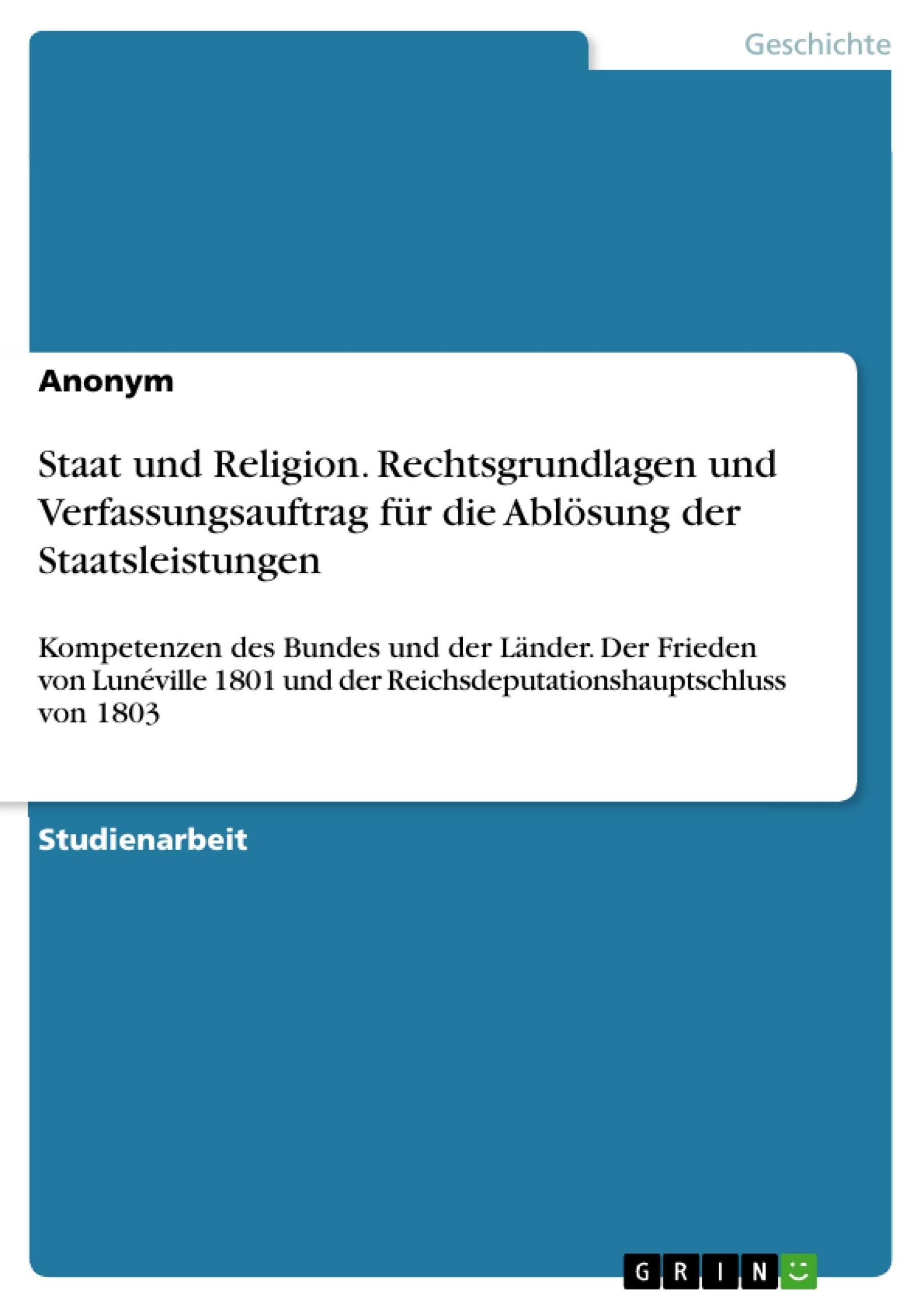In dieser Hausarbeit werden daher zunächst die Rechtsgrundlagen für die Ablösung der Staatsleistungen erläutert und der historische Kontext dieser Rechtsgrundlagen dargelegt. Dabei wird kurz auf den Frieden von Lunéville, vor allem aber auf den Reichsdeputationshauptschluss von 1803 eingegangen. Im zweiten Teil der Arbeit werden die Kompetenzen der Bundesländer und des Bundestags näher betrachtet, wobei der Fokus vor allem auf den Antrag der Grünen im Landtag Nordrhein-Westfalen (Drucksache 17/7372)7 und dem Gesetzesentwurf der Fraktionen FDP, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 19/19237)8 liegt. Im letzten Teil der Arbeit wird eine Stellungnahme abgegeben. Am Ende wird ein Fazit gezogen.
Seit über 100 Jahren soll die Ablösung der Staatsleistungen vollzogen werden. `“Höchste Zeit zu handeln“, dachten sich die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und stellten im September 2019 einen Antrag die “Staatsleistungen ablösen - Verhandlungen mit den Kirchen aufnehmen”. Der Antrag befasst sich mit den Artikel 140 des Grundgesetzes (kurz: GG) in Verbindung mit dem Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung (kurz: WRV) von 1919. In diesem Artikel geht es um die Ablösung der Staatsleistungen an die katholische und evangelische Landeskirche in Deutschland. Die Ablösung der Staatsleistungen hat ihren Ursprung im 19. Jahrhundert, genauer gesagt im Reichsdeputationshauptschluss von 1803, wo die Kirchen im Zuge der Säkularisation große Teile ihrer Territorien an den Staat abtreten und somit auch Einbußen in ihren Einnahmen hinnehmen mussten. Um den Kirchen ihre Einnahmebußen zu erstatten, wurde seitdem eine Art Pachtzins für die einverleibten Territorien bezahlt. Die WRV fordert in §138 WRV die Ablösung dieser Staatsleitungen im Sinne einer Einmalzahlung durch die Bundesländer oder eine andere Art von Ausgleich nach dem Äquivalenzprinzip. Jedoch ist bis heute weder eine Ablösesumme bezahlt, noch wurde dem Verfassungsauftrag im Sinne des Art. 140 GG nachgekommen. Um dieser Verpflichtung nachzukommen ist der Bund dazu angehalten, ein Grundsätzegesetzes zu erlassen, um die Ablösung der Staatsleistungen durch die Bundesländer zu gewährleisten. Ein halbes Jahr nach dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/die Grünen im Landtag Nordrhein-Westfalen legen sie zusammen mit den Fraktionen FDP und DIE LINKE einen Gesetzesentwurf für ein “Grundsätzegesetz zur Ablösung der Staatsleistungen” im Bundestag vor.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ein neuer Wind weht durch Europa
- Der Frieden von Lunéville 1801 und der Reichsdeputationshauptschluss von 1803
- Die Rechtsgrundlagen und der Verfassungsauftrag für die Ablösung der Staatsleistungen
- Die Kompetenzen des Bundes und der Länder bezüglich der Staatsleistungen
- Stellungnahme
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die rechtlichen und historischen Grundlagen für die Ablösung der Staatsleistungen an die evangelische und katholische Kirche in Deutschland. Sie beleuchtet die Entstehung und Entwicklung dieser Zahlungen im Kontext der Säkularisation im 19. Jahrhundert und untersucht die verfassungsrechtlichen Verpflichtungen von Bund und Ländern zur Ablösung.
- Die historischen Wurzeln der Staatsleistungen im Zusammenhang mit der Säkularisation
- Die rechtlichen Grundlagen und der Verfassungsauftrag zur Ablösung der Staatsleistungen
- Die Kompetenzen des Bundes und der Länder bei der Ablösung der Staatsleistungen
- Die aktuellen Debatten um die Staatsleistungen und die damit verbundenen finanziellen Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den historischen Kontext und die aktuelle Debatte um die Ablösung der Staatsleistungen dar. Sie erläutert den Ursprung der Zahlungen im 19. Jahrhundert und die verfassungsrechtlichen Verpflichtungen zur Ablösung.
- Ein neuer Wind weht durch Europa: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung im 19. Jahrhundert, insbesondere die Auswirkungen der Aufklärung und die Französische Revolution. Es zeigt, wie die deutschen Staaten durch die Napoleonischen Kriege und den Frieden von Lunéville zu grundlegenden Veränderungen gezwungen wurden.
- Der Frieden von Lunéville 1801 und der Reichsdeputationshauptschluss von 1803: Dieses Kapitel untersucht die Folgen des Friedens von Lunéville und die Auswirkungen des Reichsdeputationshauptschlusses von 1803 auf die Kirchen. Es erläutert, wie die Säkularisierung zu Einbußen bei den Kircheneinnahmen führte und wie die Staatsleistungen als Entschädigung entstanden sind.
- Die Rechtsgrundlagen und der Verfassungsauftrag für die Ablösung der Staatsleistungen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Rechtsgrundlagen und dem Verfassungsauftrag für die Ablösung der Staatsleistungen. Es untersucht Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung und seine Bedeutung für die heutige Debatte.
- Die Kompetenzen des Bundes und der Länder bezüglich der Staatsleistungen: Dieses Kapitel beleuchtet die Kompetenzen des Bundes und der Länder in Bezug auf die Staatsleistungen. Es analysiert die aktuellen Gesetzesentwürfe und die damit verbundenen finanziellen Herausforderungen für die Länder.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themengebiete dieser Arbeit sind: Staatsleistungen, Säkularisation, Reichsdeputationshauptschluss, Weimarer Reichsverfassung, Artikel 138, Artikel 140 GG, Rechtsgrundlagen, Verfassungsauftrag, Kompetenzen, Bund, Länder, Finanzielle Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Staatsleistungen an die Kirchen?
Staatsleistungen sind regelmäßige Zahlungen der Bundesländer an die christlichen Kirchen als Entschädigung für Enteignungen im 19. Jahrhundert.
Was war der Reichsdeputationshauptschluss von 1803?
Dies war ein Gesetz, das die Säkularisation kirchlicher Besitztümer in Deutschland regelte und somit die Grundlage für die heutigen Entschädigungsansprüche der Kirchen legte.
Warum verlangt das Grundgesetz die Ablösung der Staatsleistungen?
Über Artikel 140 GG gilt Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung fort, der den Staat verpflichtet, diese dauerhaften Zahlungen durch eine Einmalzahlung oder ähnliches zu beenden.
Wer ist für die Ablösung der Staatsleistungen zuständig?
Der Bund muss ein Grundsätzegesetz erlassen, während die tatsächliche finanzielle Abwicklung und Verhandlung Sache der einzelnen Bundesländer ist.
Warum wurde die Ablösung nach über 100 Jahren noch nicht vollzogen?
Die hohen finanziellen Belastungen für die Länderhaushalte und die komplexen Verhandlungen über die Höhe der Entschädigungssummen haben den Prozess bisher verzögert.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2019, Staat und Religion. Rechtsgrundlagen und Verfassungsauftrag für die Ablösung der Staatsleistungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1134896