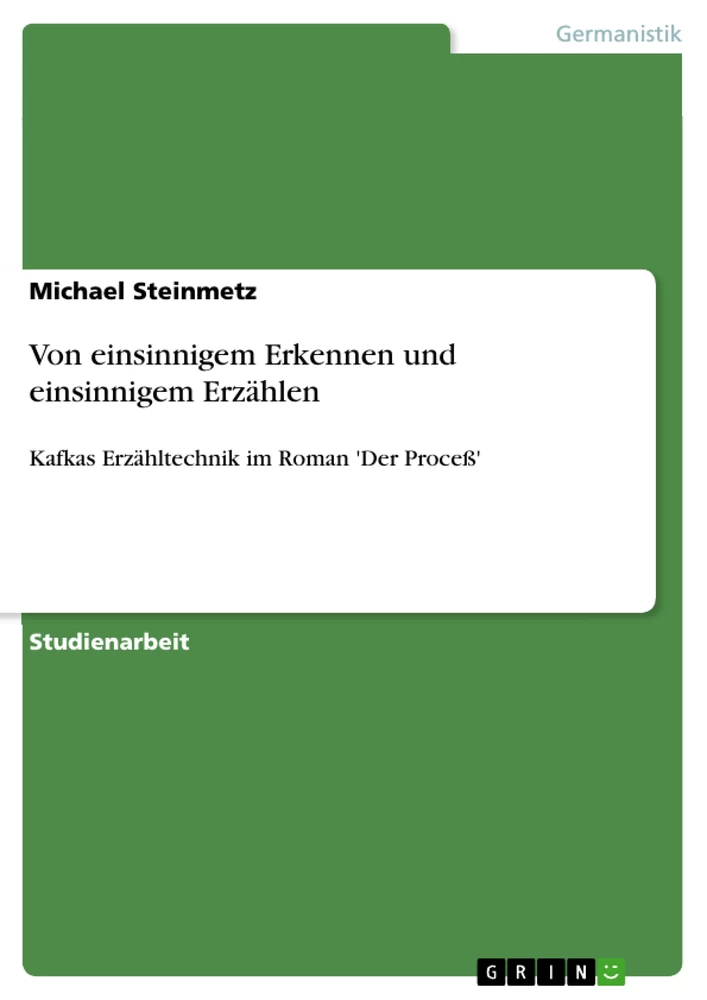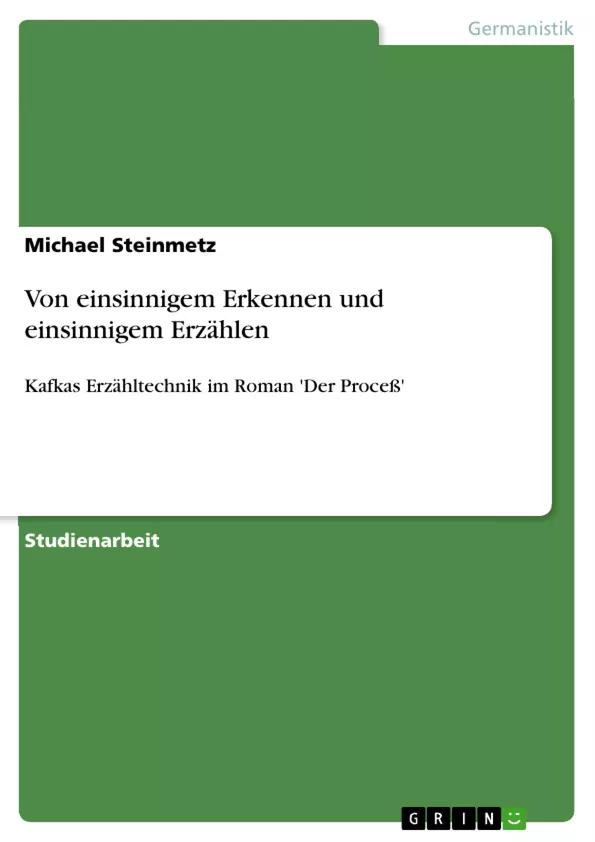Ein rätselhaftes Gericht macht einem rätselhaften Prokuristen angesichts dessen rätselhafter Schuld einen rätselhaften Prozess, und niemand wundert sich – ‚absurd’, möchte man meinen, korrigiert sich und bringt es auf den Terminus ‚grotesk’, auch nicht, vielleicht ‚auf groteske Weise absurd’, besser, wenngleich nicht treffend. Man merkt, welchem Bedürfnis der Neologismus ‚kafkaesk’ gerecht wird – dieser Terminus vermag nämlich, einen beklemmenden, geheimnisvollen und die Logik der Alltagswelt transzendierenden Sachverhalt zu titulieren, ohne das diesem Sachverhalt Eigentümliche und das für Kafkas Erzählungen typisch Rätselhafte durch althergebrachte Begrifflichkeiten zu verschleiern.
Doch wieso gibt Kafka des Rätsels Lösung so ungern preis, wieso lässt Kafka seine Rezipienten stets so hilflos zurück, ja wieso schreibt Kafka so kafkaesk? Einen möglichen Erklärungsansatz liefert der Verweis auf den für Kafka vielleicht erkenntnistheoretisch notwendigen erzähltechnischen Perspektivenmonismus, welcher den Schritt aus einem bewusstseinsimmanenten Standpunkt in den Raum einer objektiven Realität – für Erzähler, Figur und Rezipienten gleichermaßen – schlichtweg verweigert.
Durch Friedrich Beißner wurde Kafkas Œuvre erstmals in extenso erzähltheoretisch durchleuchtet – Beißner gab entscheidende und folgenreiche Aufschlüsse über Kafkas spezifische Erzähltechnik, welche man fortan mit dem von Beißner etablierten Begriff der Einsinnigkeit zu fassen versuchte. Was diese Einsinnigkeit zu bedeuten hat und ob das einsinnige Erzählen von Kafka tatsächlich derart rigoros, wie von Beißner behauptet, beibehalten wird, soll exemplarisch am Roman Der Proceß untersucht werden. Genettes verdienstvolle Theorie der Erzählung soll das dafür notwendige Instrumentarium bieten. Die Frage des ersten Teils dieser Untersuchung lautet demgemäß: ‚Ob und inwiefern lässt sich die für Kafkas Werk von Beißner propagierte spezifische Einsinnigkeit des Erzählens am Roman Der Proceß anhand Genettes Erzähltheorie nachweisen?’
Darauf basierend soll die Frage nach der Funktion dieses Erzählens gestellt werden. ‚Inwiefern lässt sich Kafkas Erzähltechnik als Indikator für ein erkenntnistheoretisches Problemfeld oder auch als Symptom für ein geschichts- oder gesellschaftsspezifisches Krankheitsbild verstehen?’, lautet die Fragestellung für den zweiten Teil dieser Untersuchung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kafkas Erzählmodus im Roman Der Proceß
- Einsinnigkeit
- Brüche in der Einsinnigkeit
- Änderungen der Fokalisierung
- Ordnung und Dauer
- Funktion der Brüche in der Einsinnigkeit
- Gründe für den einsinnigen Erzählmodus
- Einsinnigkeit der Erkenntnis
- Entfremdung
- Ein gewagtes Wort zum Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Erzähltechnik Franz Kafkas am Beispiel seines Romans "Der Proceß". Ziel ist es, die von Friedrich Beißner beschriebene "Einsinnigkeit" des Erzählens in Kafkas Werk anhand der Erzähltheorie Gérard Genettes zu untersuchen. Dabei werden die spezifischen Merkmale der Einsinnigkeit, ihre Funktion im Roman und ihre Bedeutung im Kontext der modernen Romantheorie beleuchtet.
- Kafkas spezifische Erzähltechnik, die als "Einsinnigkeit" bezeichnet wird
- Die Funktion der Einsinnigkeit im Roman "Der Proceß"
- Die Bedeutung der Einsinnigkeit im Kontext der modernen Romantheorie
- Die Rolle der Fokalisierung und der Erzählstimme in Kafkas Werk
- Die Frage nach der Erkenntnis und der Entfremdung in Kafkas Erzählungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den methodischen Rahmen der Arbeit dar. Sie beleuchtet die Besonderheiten von Kafkas Erzähltechnik und die Relevanz des Begriffs "kafkaesk".
Das zweite Kapitel analysiert Kafkas Erzählmodus im Roman "Der Proceß". Es wird die von Beißner beschriebene "Einsinnigkeit" anhand der Erzähltheorie Genettes untersucht. Dabei werden die Merkmale der Einsinnigkeit, die Brüche in der Einsinnigkeit und die Funktion dieser Brüche im Roman beleuchtet.
Das dritte Kapitel widmet sich den Gründen für den einsinnigen Erzählmodus in Kafkas Werk. Es werden die Einsinnigkeit der Erkenntnis und die Entfremdung als zentrale Elemente von Kafkas Erzähltechnik diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Erzähltechnik Franz Kafkas, die Einsinnigkeit, die Fokalisierung, die Erzählstimme, der Roman "Der Proceß", die Erkenntnis, die Entfremdung und die moderne Romantheorie. Die Arbeit analysiert Kafkas spezifische Erzählweise und ihre Bedeutung im Kontext der literarischen Tradition.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Einsinnigkeit“ in Kafkas Erzählweise?
Der Begriff, geprägt von Friedrich Beißner, beschreibt die konsequente Bindung der Erzählperspektive an das Bewusstsein einer einzigen Figur, ohne objektive Einordnung durch einen auktorialen Erzähler.
Welche Funktion hat diese Erzähltechnik im Roman „Der Proceß“?
Sie erzeugt ein Gefühl der Beklemmung und Orientierungslosigkeit (kafkaesk), da der Leser nur so viel weiß wie die Hauptfigur Josef K. und keine „Lösung“ des Rätsels erhält.
Gibt es Brüche in der Einsinnigkeit bei Kafka?
Die Arbeit untersucht anhand von Gérard Genettes Theorie, ob es Stellen gibt, an denen die Perspektive wechselt oder Informationen gegeben werden, die über das Wissen der Figur hinausgehen.
Wie hängen Einsinnigkeit und Entfremdung zusammen?
Die einsinnige Perspektive spiegelt die Isolation und Entfremdung des Individuums in einer unverständlichen, bürokratischen Welt wider.
Was macht ein Werk „kafkaesk“?
Es bezeichnet Situationen, die unheimlich, absurd und rätselhaft sind und die gewohnte Logik der Alltagswelt transzendieren, oft geprägt von einer ausweglosen Bürokratie.
- Arbeit zitieren
- Michael Steinmetz (Autor:in), 2006, Von einsinnigem Erkennen und einsinnigem Erzählen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113516