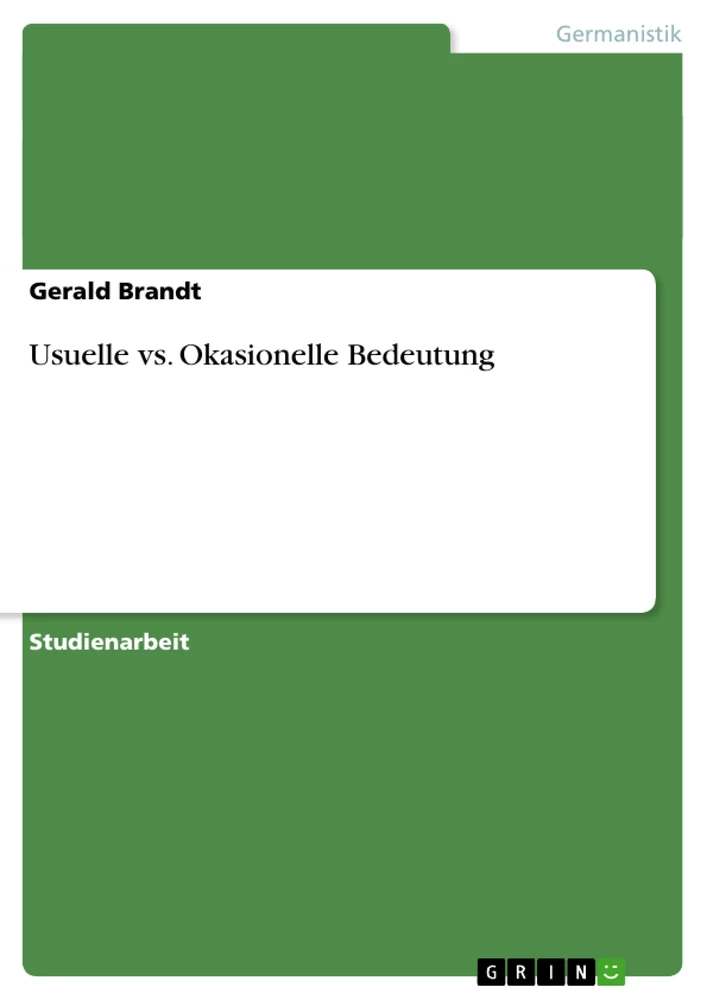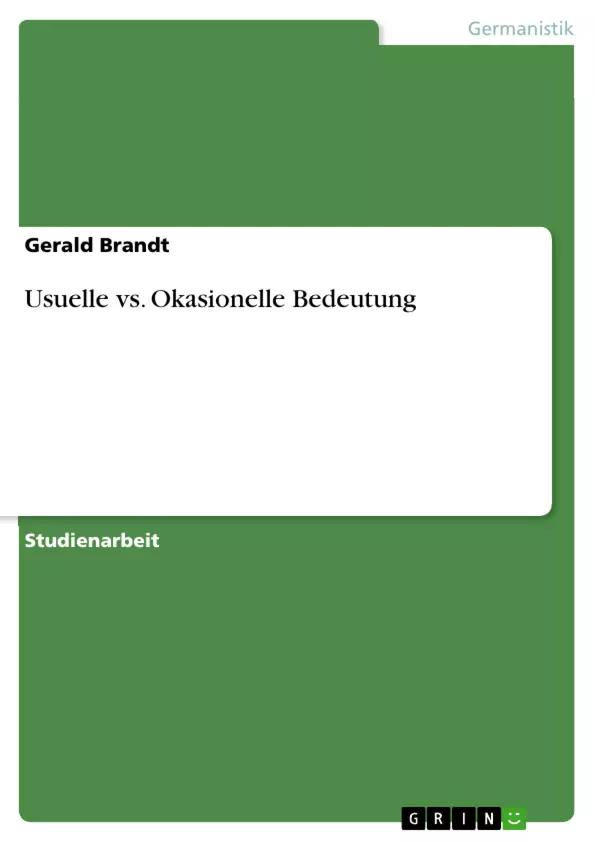In der vorliegenden Seminararbeit geht es primär um einen Vergleich verschiedener Ansätze
bei der Beschreibung von Wortbedeutungen. Dabei geht es ausschließlich um die beiden im
Titel genannten Dichotomien der Autoren Herrmann Paul und Wilhelm Schmidt. Gemeinsamkeiten
und Unterschiede in Ausgangshaltung, Vorgehensweise und Ergebnis sollen herausgearbeitet
werden, wobei zunächst jede Arbeit für sich beschrieben, und anschließend beide
einander gegenübergestellt werden sollen. Im Anhang möchte ich versuchen, die vorgestellten
Theorien am eigenen Beispiel in die Praxis umzusetzen. Zunächst hebt Herrmann Paul hervor, dass seine Untersuchungen sich besonders dem Bedeutungswandel
zuwenden, indem er diesen mit dem Lautwandel vergleicht und Parallelen zieht.
Er bekennt sich damit zu einer mehr oder minder diachronen Sichtweise der zu beschreibenden
Bedeutungsvariationen. Nicht zuletzt trägt der Abschnitt, in dem die Begriffe okkasionell
und usuell behandelt werden, den Titel Wandel der Wortbedeutung. Gleich auf der zweiten
Seite dieses Abschnittes - Seite 75, § 51 - gibt der Autor eine Definition der beiden Begriffe
an:
"Wir verstehen also unter usueller Bedeutung den gesamten Vorstellungsinhalt, der sich für
den Angehörigen einer Sprachgenossenschaft mit einem Worte verbindet, unter okkasioneller
Bedeutung denjenigen Vorstellungsinhalt, welchen der Redende, indem er das Wort ausspricht,
damit verbindet, und von welchem er erwartet, dass ihn auch der Hörende damit verbinde."
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Herrmann Paul: Usuelle und okkasionelle Bedeutung
- 2.1. Unterschiede und Definitionen
- 2.2. Die drei Hauptarten des Bedeutungswandels
- 2.2.2. Beschränkung auf einen Teil des Vorstellungsinhaltes
- 2.2.3. Übertragung auf das räumlich, zeitlich oder kausal mit dem Grundbegriff Verknüpfte
- 2.2.4. Ausnahmen von den drei Hauptarten
- 3. Wilhelm Schmidt: Lexikalische und aktuelle Bedeutung
- 3.1. Definitionen
- 3.2. Komponenten und Typen der Wortbedeutung
- 3.3. Kontextgebundenheit der aktuellen Bedeutung
- 3.4. Der verallgemeinernde Charakter des Wortes
- 4. Vergleiche
- 5. Umsetzung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit vergleicht die Ansätze von Herrmann Paul und Wilhelm Schmidt zur Beschreibung von Wortbedeutungen. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Ausgangshaltungen, Vorgehensweisen und Ergebnissen herauszuarbeiten. Zunächst werden die einzelnen Arbeiten beschrieben, bevor ein direkter Vergleich erfolgt. Die Arbeit schließt mit einem praktischen Beispiel zur Umsetzung der vorgestellten Theorien.
- Vergleich der Ansätze von Herrmann Paul und Wilhelm Schmidt zur Wortbedeutung
- Untersuchung der Dichotomien "usuell/okkasionell" und "lexikalisch/aktuell"
- Analyse von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den theoretischen Herangehensweisen
- Beschreibung des Bedeutungswandels nach Herrmann Paul
- Kontextgebundenheit und der verallgemeinernde Charakter von Wörtern nach Wilhelm Schmidt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit: einen Vergleich der Ansätze von Herrmann Paul und Wilhelm Schmidt zur Beschreibung von Wortbedeutungen. Der Schwerpunkt liegt auf den Dichotomien "usuell/okkasionell" und "lexikalisch/aktuell". Die Arbeit gliedert sich in die Beschreibung der einzelnen Ansätze und einen anschließenden Vergleich, ergänzt um ein praktisches Anwendungsbeispiel im Anhang.
2. Herrmann Paul: Usuelle und okkasionelle Bedeutung: Dieses Kapitel stellt Herrmann Pauls Theorie der usuellen und okkasionellen Bedeutung vor. Paul vergleicht den Bedeutungswandel mit dem Lautwandel und bevorzugt eine diachrone Perspektive. Er definiert die usuelle Bedeutung als den gesamten Vorstellungsinhalt, der mit einem Wort in einer Sprachgemeinschaft verbunden ist, während die okkasionelle Bedeutung der vom Sprecher intendierte und vom Hörer erwartete Vorstellungsinhalt im konkreten Kontext ist. Paul argumentiert, dass die okkasionelle Bedeutung einfach und konkret, die usuelle Bedeutung potentiell mehrfach und abstrakt ist. Die Mehrfachbedeutung entsteht seiner Ansicht nach durch Ableitungen von einer ursprünglichen Grundbedeutung. Die richtige Interpretation der okkasionellen Bedeutung wird durch gemeinsame Anschauung, Kontext und implizite Informationen im Wort selbst erleichtert.
3. Wilhelm Schmidt: Lexikalische und aktuelle Bedeutung: Dieses Kapitel präsentiert Wilhelm Schmidts Ansatz zur lexikalischen und aktuellen Bedeutung. Es fehlen im gegebenen Textauszug detaillierte Informationen zu Schmidts Theorie, um eine umfassende Zusammenfassung zu erstellen. Der Textauszug nennt lediglich die Unterkapitel, die seine Theorie beleuchten.
Schlüsselwörter
Wortbedeutung, usuell, okkasionell, lexikalisch, aktuell, Bedeutungswandel, Semantik, Herrmann Paul, Wilhelm Schmidt, Sprachwissenschaft, diachron, synchron, Kontext, Sprachgemeinschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Vergleich der Ansätze von Herrmann Paul und Wilhelm Schmidt zur Wortbedeutung
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit vergleicht die Ansätze von Herrmann Paul und Wilhelm Schmidt zur Beschreibung von Wortbedeutungen. Der Fokus liegt auf den Dichotomien "usuell/okkasionell" (Paul) und "lexikalisch/aktuell" (Schmidt). Die Arbeit beschreibt die jeweiligen Theorien, vergleicht sie und schließt mit einem praktischen Anwendungsbeispiel.
Welche Theorien werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Theorie der "usuellen" und "okkasionellen" Bedeutung nach Herrmann Paul mit der Theorie der "lexikalischen" und "aktuellen" Bedeutung nach Wilhelm Schmidt. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Ausgangshaltungen, Vorgehensweisen und Ergebnissen der beiden Ansätze herausgearbeitet.
Was versteht Herrmann Paul unter "usueller" und "okkasioneller" Bedeutung?
Für Paul ist die usuelle Bedeutung der gesamte Vorstellungsinhalt, der mit einem Wort in einer Sprachgemeinschaft verbunden ist. Die okkasionelle Bedeutung hingegen ist der vom Sprecher intendierte und vom Hörer erwartete Vorstellungsinhalt im konkreten Kontext. Paul sieht die okkasionelle Bedeutung als einfach und konkret, die usuelle Bedeutung als potentiell mehrfach und abstrakt, wobei die Mehrfachbedeutung aus Ableitungen einer ursprünglichen Grundbedeutung entsteht. Die Interpretation der okkasionellen Bedeutung wird durch Kontext und implizite Informationen unterstützt.
Welche Perspektive nimmt Herrmann Paul in seiner Theorie ein?
Herrmann Paul vergleicht den Bedeutungswandel mit dem Lautwandel und bevorzugt eine diachrone Perspektive.
Welche Aspekte von Wilhelm Schmidts Theorie werden behandelt?
Der zur Verfügung stehende Textauszug enthält nur begrenzte Informationen zu Schmidts Theorie. Es werden lediglich die Unterkapitel "Definitionen", "Komponenten und Typen der Wortbedeutung", "Kontextgebundenheit der aktuellen Bedeutung" und "Der verallgemeinernde Charakter des Wortes" erwähnt, ohne detaillierte Erklärungen.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu den Theorien von Herrmann Paul und Wilhelm Schmidt, einen Vergleich der Ansätze und eine praktische Umsetzung der vorgestellten Theorien (im Anhang).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Wortbedeutung, usuell, okkasionell, lexikalisch, aktuell, Bedeutungswandel, Semantik, Herrmann Paul, Wilhelm Schmidt, Sprachwissenschaft, diachron, synchron, Kontext, Sprachgemeinschaft.
Wo finde ich ein praktisches Beispiel zur Umsetzung der Theorien?
Ein praktisches Beispiel zur Umsetzung der vorgestellten Theorien befindet sich im Anhang der Seminararbeit (nicht im vorliegenden Auszug enthalten).
- Quote paper
- Gerald Brandt (Author), 1997, Usuelle vs. Okasionelle Bedeutung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11353