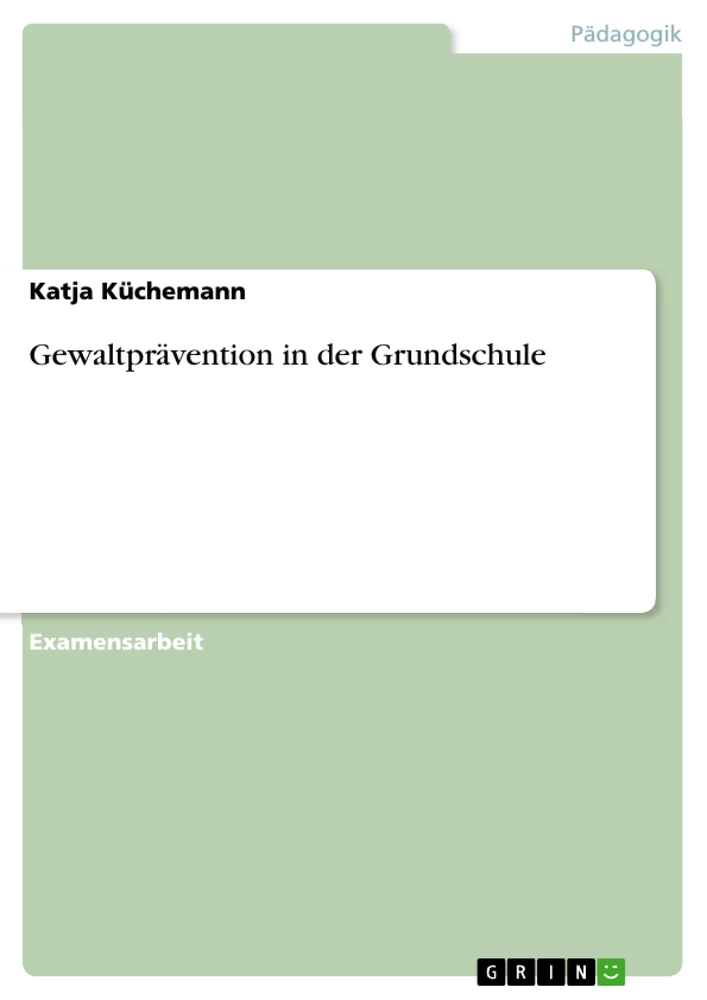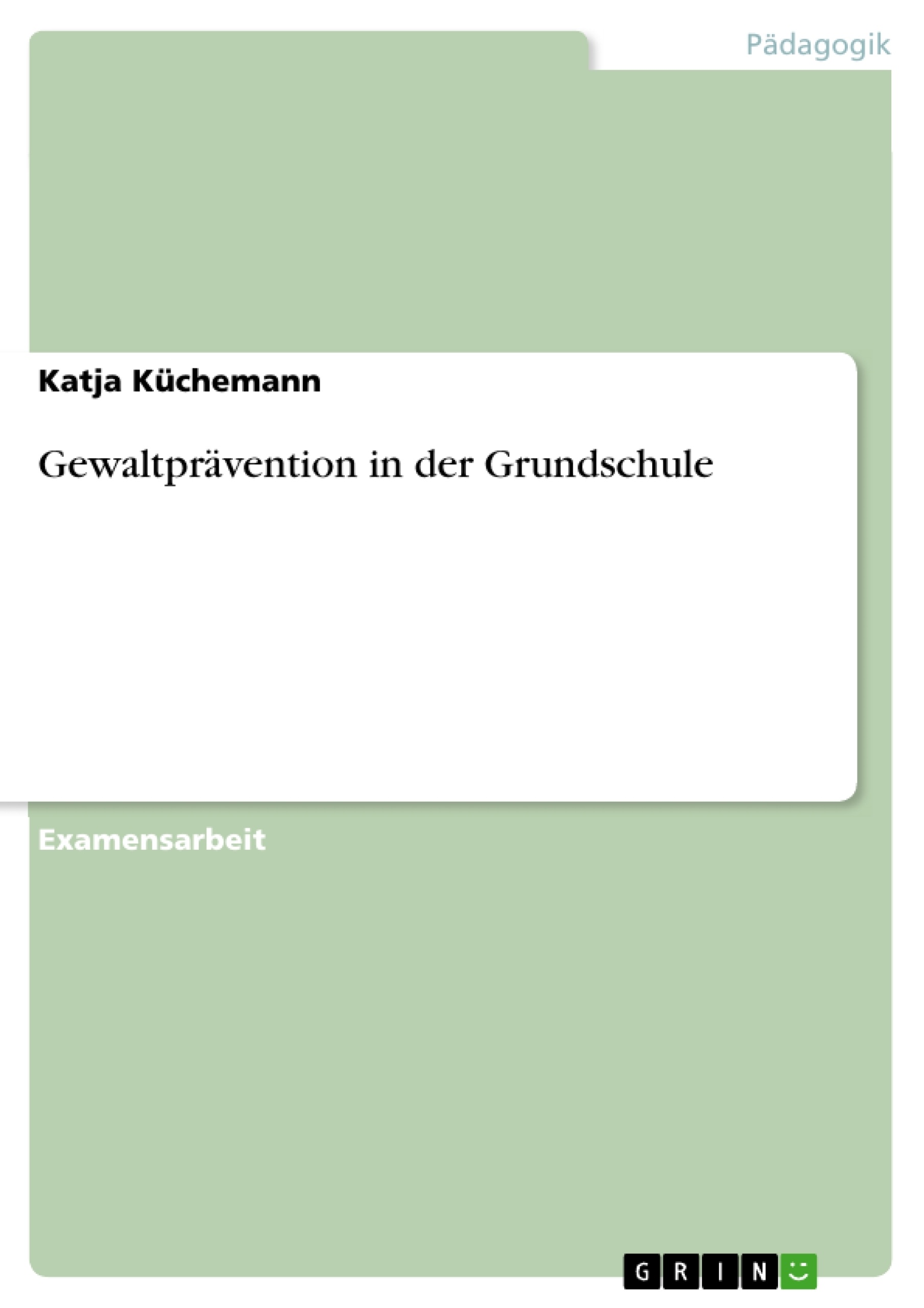Das Phänomen Gewalt in der Schule ist nichts Neues, sondern in den letzten Jahren immer stärker ins Blickfeld gesellschaftlichen, politischen und medialen Interesses geraten. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der die Menschen und vor allem die Medien sensibler auf Gewaltakte Jugendlicher und Kinder reagieren. „Die kulturelle Sensibilität hat sich gegenüber allen Formen von Gewalt erhöht." Diese Tatsache ist nicht nur negativ zu bewerten, ganz im Gegenteil, sie trägt dazu bei, dass die Pädagogen, Lehrerinnen und Lehrer sich mit diesem Problem auseinander setzen, und wenn nötig an ihren Schulen Präventionsarbeit leisten können.
„Gewalt unter Schulkindern ist zweifellos ein sehr altes Phänomen. Die Tatsache, daß einige Kinder häufig und systematisch von anderen Kindern gemobbt und angegriffen werden, wurde in Werken der Literatur beschrieben, und viele Erwachsene haben damit Erfahrung aus ihrer eigenen Schulzeit. In den letzten Jahren hat dieses Problem an Schärfe deutlich zugenommen.“ Der aktuelle Vorfall an der Berliner Rütli-Hauptschule im Stadtteil Neukölln macht deutlich, dass Gewalt an Schulen heutzutage präsenter und aktueller ist, als viele Menschen angenommen haben. Wenn es Pädagogen nicht mehr darum geht ihren Lehrplan zu erfüllen, sondern sie nur noch froh sind, mit dem Leben aus dem Klassenzimmer zu kommen und ihre Schüler als unbeschulbar deklariert werden, so zeigt dies deutlich, wie schlimm die Lage wirklich ist.
Der Hilferuf der Lehrer der Rütli-Schule an die Regierung „Das Verhalten im Unterricht ist geprägt durch totale Ablehnung und menschenverachtendes Auftreten. (…) Der Intensivtäter wird zum Vorbild! (…) Wir sind ratlos.“, kommt zu spät. Die Lehrer sind nicht mehr „Herr“ der Lage. Die Ursache für diese gewalttätigen Vorkommnisse liegt im Umfeld der Schule. Der hohe Ausländeranteil (ca. 83% der Schüler sind nicht deutscher Herkunft) und fehlende Integration sowie fehlende Zukunftsperspektiven fördern Aggressionen und Gewalt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Einordnung in die Grundschulpädagogik
- 2.1. Sicherheits- und Gewaltpräventionsmaßnahmen in Schulen
- 2.1.1. Verhütung von Gewalt und Maßnahmen bei einem akuten Gewaltvorfall
- 2.1. Sicherheits- und Gewaltpräventionsmaßnahmen in Schulen
- 3. Begriffsbestimmung
- 3.1. Aggression
- 3.2. Gewalt
- 4. Erscheinungsformen von Gewalt
- 4.1. Personale Gewalt
- 4.1.1. Physische Gewalt
- 4.1.2. Psychische Gewalt
- 4.1.3. Sexuelle Gewalt
- 4.1.4. Frauenfeindliche und fremdenfeindliche bzw. rassistische Gewalt
- 4.2. Strukturelle Gewalt
- 4.1. Personale Gewalt
- 5. Gewalt an Schulen
- 5.1. Täter-Opfer-Typologien im schulischen Kontext
- 5.1.1. Was charakterisiert einen typischen Gewalttäter?
- 5.1.1.1. Die Entstehungsbedingungen von Gewalttäterschaft
- 5.1.1.2. Lehrer und Erzieher als Täter?
- 5.1.2. Was charakterisiert ein typisches Gewaltopfer?
- 5.1.1. Was charakterisiert einen typischen Gewalttäter?
- 5.2. Erscheinungsformen der Gewalt an (Grund-)Schulen
- 5.2.1. Vandalismus
- 5.2.1.1. Ursachen für Vandalismus
- 5.2.2. Gewalt zwischen Schülern
- 5.2.2.1. Körperliche Gewalt unter Schülern
- 5.2.2.2. Verbale Gewalt unter Schülern
- 5.2.2.3. Weitere Formen der Gewalt unter Schülern
- 5.2.2.4. Ursachen für Gewalt zwischen Schülern
- 5.2.3. Gewalt gegen Lehrer
- 5.2.4. Gewalt von Lehrern gegen Schüler
- 5.2.1. Vandalismus
- 5.1. Täter-Opfer-Typologien im schulischen Kontext
- 6. Gewalt in der Schule – importiert oder selbst produziert?
- 6.1. Gewaltförmiges Verhalten von Schüler(innen) im Kontext außerschulischer Sozialisation
- 6.1.1. Familiensituation und elterliche Erziehung
- 6.1.2. Die Gruppe der Gleichaltrigen
- 6.1.3. Geschlechterspezifische Unterschiede
- 6.1.4. Medienkonsum
- 6.2. Gewaltförmiges Verhalten von Schüler(innen) im sozial-ökologischen Kontext der Schule
- 6.2.1. Schulgröße
- 6.2.1.1. Klassenstärke
- 6.2.2. Schullage
- 6.2.3. Lernkultur
- 6.2.4. Sozialklima
- 6.2.5. Lehrer
- 6.2.5.1. Lehrerpersönlichkeit
- 6.2.5.2. Lehrervorbild
- 6.2.6. Stigmatisierung und „soziale Etikettierung“ von Schülern
- 6.2.1. Schulgröße
- 6.3. Zusammenfassung
- 6.1. Gewaltförmiges Verhalten von Schüler(innen) im Kontext außerschulischer Sozialisation
- 7. Empirische Befunde
- 7.1. Vorgehensweise
- 7.2. Die Grundschulen
- 7.3. Unterschiede bezüglich verschiedener Bezugsfelder
- 7.3.1. Formen der Gewaltanwendung in Grundschulen
- 7.3.1.1. Verbale Gewalt
- 7.3.1.2. Täter und Opfer
- 7.3.2. Stadt-Land-Vergleich
- 7.3.3. Gewalt gegenüber Lehrern
- 7.3.4. Persönliche Beteiligung bei Gewalttaten
- 7.3.5. Allgemeine Hilfsbereitschaft bei Gewalttaten in der Schule und auf dem Schulweg
- 7.3.6. Intervention der Schule bei Gewaltkonflikten
- 7.3.1. Formen der Gewaltanwendung in Grundschulen
- 7.4. Hat die Gewalt im Zeitverlauf zugenommen?
- 7.4.1. Situation an den untersuchten Grundschulen
- 7.4.2. Änderung der Form und Häufigkeit von Gewalt mit steigendem Alter
- 7.4.3. Opfer von Gewalt als potentielle Täter
- 7.5. Fazit
- 8. Möglichkeiten der Gewaltprävention und -intervention im Schulalltag
- 8.1. Aspekte einer gewaltmindernden Pädagogik
- 8.2. Präventive Maßnahmen im schulischen Bereich
- 8.2.1. Übergreifende Ebene
- 8.2.1.1. Pädagogische Maßnahmen zum Umgang mit Gewalttätern und ihren Taten
- 8.2.1.2. Befreien aus der Opferrolle - Erkennen, schützen, stärken
- 8.2.1.3. Entwicklung und Förderung der sozialen Kompetenz
- 8.2.1.3.1. Selbstkonzept - Selbstwertgefühl
- 8.2.1.3.2. Persönlichkeit stärken auch bei Lehrern
- 8.2.1.3.3. Miteinander reden – Einander verstehen
- 8.2.2. Schulebene
- 8.2.2.1. Einführung von Regeln
- 8.2.2.1.1. Schulordnung
- 8.2.2.2. Raum geben - Schulleben ermöglichen
- 8.2.2.3. Entwicklung der Lernkultur
- 8.2.2.4. Entwicklung des Sozialklimas
- 8.2.2.5. Sichere Gestaltung des Schulweges
- 8.2.2.5.1. Buslotsen
- 8.2.2.6. Kooperation mit außerschulischen Institutionen und Elternhaus
- 8.2.2.6.1. Frustration abbauen - Regeln achten - Fairness üben in Sport und Spiel
- 8.2.2.1. Einführung von Regeln
- 8.2.3. Klassenebene
- 8.2.3.1. Klassenregeln gegen Gewalt
- 8.2.3.2. Rollenspiele
- 8.2.3.3. Lob und Strafe
- 8.2.3.4. Regelmäßige Klassengespräche
- 8.2.3.4.1. Interagieren - Identität fördern
- 8.2.3.5. Kooperatives Lernen
- 8.2.3.6. Medienerziehung gegen Mediengewalt
- 8.2.4. Individuelle Ebene
- 8.2.1. Übergreifende Ebene
- 9. Gewaltprävention in der Grundschule
- 9.1. Gewaltfreie Konfliktbewältigung in der Grundschule
- 9.1.1. Begriffsbestimmung
- 9.1.2. Schüler-Schüler-Konflikte
- 9.1.3. Lehrer-Schüler-Konflikte
- 9.1.4. Funktion von Konflikten
- 9.1.5. Konfliktverlauf
- 9.1.6. Methoden der Konfliktprävention und -bearbeitung
- 9.1.7. Gewaltfreie Konfliktaustragung nach Jamie Walker
- 9.2. Präventionsprogramme für jüngere Schüler
- 9.2.1. FAUSTLOS
- 9.2.1.1. Die drei Einheiten von Faustlos
- 9.2.1.2. Das Besondere an Faustlos
- 9.2.2. Training mit aggressiven Kindern nach Petermann/Petermann
- 9.2.2.1. Zielsetzung
- 9.2.2.2. Diagnostik
- 9.2.2.3. Grundkonzeption des Trainings
- 9.2.2.3.1. Therapieziele
- 9.2.2.4. Aufbau des therapeutischen Vorgehens
- 9.2.3. Schulumfassende Maßnahmen nach Dan Olweus
- 9.2.3.1. Zielsetzung und Grundprinzipien
- 9.2.3.2. Wichtige Erkenntnisse
- 9.2.3.3. Konkrete Vorstellungen des Interventionsprogramms
- 9.2.1. FAUSTLOS
- 9.3. Weitere präventive Maßnahmen
- 9.3.1. Programme für alle Schüler
- 9.3.1.1. Streit-Schlichter-Programm (Peer-Meditation)
- 9.3.1.2. Sozialtraining in der Schule
- 9.3.1.3. Coolness Training
- 9.3.2. Lehrerprogramme
- 9.3.2.1. Konstanzer Trainingsmodell (KTM)
- 9.3.2.2. Schulinterne Lehrerfortbildung zur Gewaltprävention (SchiLF)
- 9.3.1. Programme für alle Schüler
- 9.1. Gewaltfreie Konfliktbewältigung in der Grundschule
- 10. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Gewaltprävention in der Grundschule. Ziel ist es, verschiedene Formen von Gewalt im schulischen Kontext zu beleuchten und geeignete präventive und interventive Maßnahmen aufzuzeigen.
- Formen von Gewalt an Grundschulen
- Ursachen von Gewalt im schulischen und außerschulischen Umfeld
- Täter-Opfer-Dynamiken
- Präventionsprogramme und ihre Wirksamkeit
- Gewaltfreie Konfliktlösung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Gewaltprävention an Grundschulen ein und umreißt die Ziele und den Aufbau der Arbeit. Sie hebt die Bedeutung des Themas für die kindliche Entwicklung und das Schulklima hervor.
2. Einordnung in die Grundschulpädagogik: Dieses Kapitel ordnet das Thema Gewaltprävention in den Kontext der Grundschulpädagogik ein. Es beschreibt Sicherheits- und Gewaltpräventionsmaßnahmen in Schulen und deren Bedeutung für ein positives Lernumfeld. Der Fokus liegt auf proaktiven Maßnahmen zur Gewaltverhütung und dem Vorgehen bei akuten Gewaltvorfällen.
3. Begriffsbestimmung: Hier werden die zentralen Begriffe Aggression und Gewalt präzise definiert und voneinander abgegrenzt. Die Abgrenzung ist wichtig, um im weiteren Verlauf der Arbeit eine einheitliche Terminologie zu gewährleisten und Missverständnisse zu vermeiden. Es wird auf die unterschiedlichen Facetten und Ausprägungen von Aggression und Gewalt eingegangen.
4. Erscheinungsformen von Gewalt: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Erscheinungsformen von Gewalt, unterteilt in personale und strukturelle Gewalt. Personale Gewalt umfasst physische, psychische, sexuelle, frauenfeindliche, fremdenfeindliche und rassistische Gewalt. Strukturelle Gewalt wird als indirekte Form von Gewalt definiert und im Kontext des Schulsystems beleuchtet.
5. Gewalt an Schulen: Kapitel 5 konzentriert sich auf Gewalt an Schulen, analysiert Täter-Opfer-Typologien und beschreibt verschiedene Erscheinungsformen von Gewalt im schulischen Kontext, wie Vandalismus und Gewalt zwischen Schülern, gegen Lehrer und von Lehrern gegen Schüler. Es wird auf die komplexen Ursachen und Zusammenhänge eingegangen.
6. Gewalt in der Schule – importiert oder selbst produziert?: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen von Gewalt an Schulen. Es untersucht den Einfluss außerschulischer Faktoren wie Familiensituation, Gleichaltrige, geschlechtsspezifische Unterschiede und Medienkonsum sowie inner-schulischer Faktoren wie Schulgröße, Schulklima und Lehrerverhalten. Die Zusammenfassung des Kapitels integriert die gewonnenen Erkenntnisse über die komplexen Ursachen von Gewalt an Schulen.
7. Empirische Befunde: In diesem Kapitel werden empirische Befunde zu Gewalt an Grundschulen präsentiert. Die Vorgehensweise der Untersuchung wird erläutert und die Ergebnisse zu verschiedenen Aspekten der Gewalt an Grundschulen, wie Formen der Gewalt, Täter-Opfer-Verhältnisse, Stadt-Land-Vergleiche und die Intervention der Schulen, detailliert dargestellt und analysiert. Es wird auch der Frage nach der Veränderung der Gewalt im Zeitverlauf nachgegangen.
8. Möglichkeiten der Gewaltprävention und -intervention im Schulalltag: Kapitel 8 befasst sich mit Möglichkeiten der Gewaltprävention und -intervention im Schulalltag. Es werden verschiedene Ansätze auf übergreifender, Schulebene, Klassenebene und individueller Ebene vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt auf einer gewaltmindernden Pädagogik, präventiven Maßnahmen und der Förderung sozialer Kompetenzen. Es werden konkrete Beispiele und Maßnahmen zur Konfliktlösung und Gewaltprävention detailliert erläutert.
9. Gewaltprävention in der Grundschule: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Gewaltprävention speziell in der Grundschule. Es behandelt die gewaltfreie Konfliktbewältigung und stellt verschiedene Präventionsprogramme wie FAUSTLOS, das Training mit aggressiven Kindern nach Petermann/Petermann und die schulumfassenden Maßnahmen nach Dan Olweus vor. Es wird auf die jeweiligen Zielsetzungen, Methoden und den Aufbau der Programme eingegangen.
Schlüsselwörter
Gewaltprävention, Grundschule, Aggression, Gewalt, Täter, Opfer, Präventionsprogramme, Konfliktlösung, Sozialkompetenz, Schulentwicklung, Schulklima, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Gewaltprävention in der Grundschule
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht umfassend das Thema Gewaltprävention an Grundschulen. Sie beinhaltet eine Einleitung, eine Einordnung in die Grundschulpädagogik, Begriffsbestimmungen von Aggression und Gewalt, eine Beschreibung verschiedener Erscheinungsformen von Gewalt, eine Analyse von Gewalt an Schulen inklusive Täter-Opfer-Dynamiken, eine Untersuchung der Ursachen von Gewalt (außerschulische und inner-schulische Faktoren), die Präsentation empirischer Befunde zu Gewalt an Grundschulen, die Darstellung von Möglichkeiten der Gewaltprävention und -intervention (auf verschiedenen Ebenen), eine detaillierte Betrachtung von Gewaltpräventionsprogrammen für die Grundschule und abschließend ein Resümee.
Welche Arten von Gewalt werden behandelt?
Die Arbeit unterscheidet zwischen personaler und struktureller Gewalt. Personale Gewalt umfasst physische, psychische, sexuelle, frauenfeindliche, fremdenfeindliche und rassistische Gewalt. Strukturelle Gewalt wird als indirekte Form von Gewalt beschrieben. Im schulischen Kontext werden Gewalt zwischen Schülern, Gewalt gegen Lehrer, Gewalt von Lehrern gegen Schüler und Vandalismus betrachtet.
Welche Ursachen für Gewalt an Schulen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht sowohl außerschulische als auch inner-schulische Ursachen. Außerschulische Faktoren umfassen Familiensituation, elterliche Erziehung, den Einfluss der Peergroup, geschlechtsspezifische Unterschiede und Medienkonsum. Inner-schulische Faktoren sind Schulgröße (inkl. Klassenstärke), Schullage, Lernkultur, Sozialklima, Lehrerpersönlichkeit, Lehrervorbild und die Stigmatisierung von Schülern.
Welche empirischen Befunde werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert empirische Befunde zu verschiedenen Aspekten von Gewalt an Grundschulen. Dies beinhaltet die Formen der Gewaltanwendung, Täter-Opfer-Verhältnisse, Stadt-Land-Vergleiche, Gewalt gegenüber Lehrern, die persönliche Beteiligung an Gewalttaten, die Hilfsbereitschaft bei Gewalttaten und die Intervention der Schule bei Gewaltkonflikten. Weiterhin wird untersucht, ob die Gewalt im Zeitverlauf zugenommen hat und ob Opfer von Gewalt potentielle Täter sind.
Welche Präventions- und Interventionsmaßnahmen werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Ansätze zur Gewaltprävention und -intervention auf übergreifender, Schulebene, Klassenebene und individueller Ebene. Es werden Maßnahmen zur Förderung sozialer Kompetenzen, konkrete Beispiele für gewaltmindernde Pädagogik und präventive Maßnahmen detailliert erläutert. Konkrete Programme wie FAUSTLOS, das Training mit aggressiven Kindern nach Petermann/Petermann und das Interventionsprogramm nach Dan Olweus werden vorgestellt und analysiert. Weitere Maßnahmen wie Streit-Schlichter-Programme, Sozialtraining und Coolness-Training werden ebenfalls behandelt.
Welche Programme zur Gewaltprävention in der Grundschule werden im Detail beschrieben?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Programme FAUSTLOS, das Training mit aggressiven Kindern nach Petermann/Petermann und die schulumfassenden Maßnahmen nach Dan Olweus. Für jedes Programm werden die Zielsetzungen, Methoden und der Aufbau erläutert. Zusätzlich werden weitere präventive Maßnahmen wie Streit-Schlichter-Programme, Sozialtraining, Coolness-Training und Lehrerprogramme (Konstanzer Trainingsmodell, SchiLF) vorgestellt.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist strukturiert in Kapitel, die von der Einleitung über die Begriffsbestimmung und die Analyse verschiedener Gewaltformen bis hin zu den Möglichkeiten der Prävention und Intervention und konkreten Präventionsprogrammen reichen. Jedes Kapitel wird zusammengefasst, und Schlüsselwörter werden am Ende aufgeführt. Ein Inhaltsverzeichnis ermöglicht eine einfache Navigation.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit dem Thema Gewaltprävention an Grundschulen auseinandersetzen, insbesondere für Pädagogen, Lehrer, Erzieher, Schulpsychologen, Eltern und Wissenschaftler im Bereich der Pädagogik und Sozialwissenschaften.
- Citation du texte
- Katja Küchemann (Auteur), 2006, Gewaltprävention in der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113555