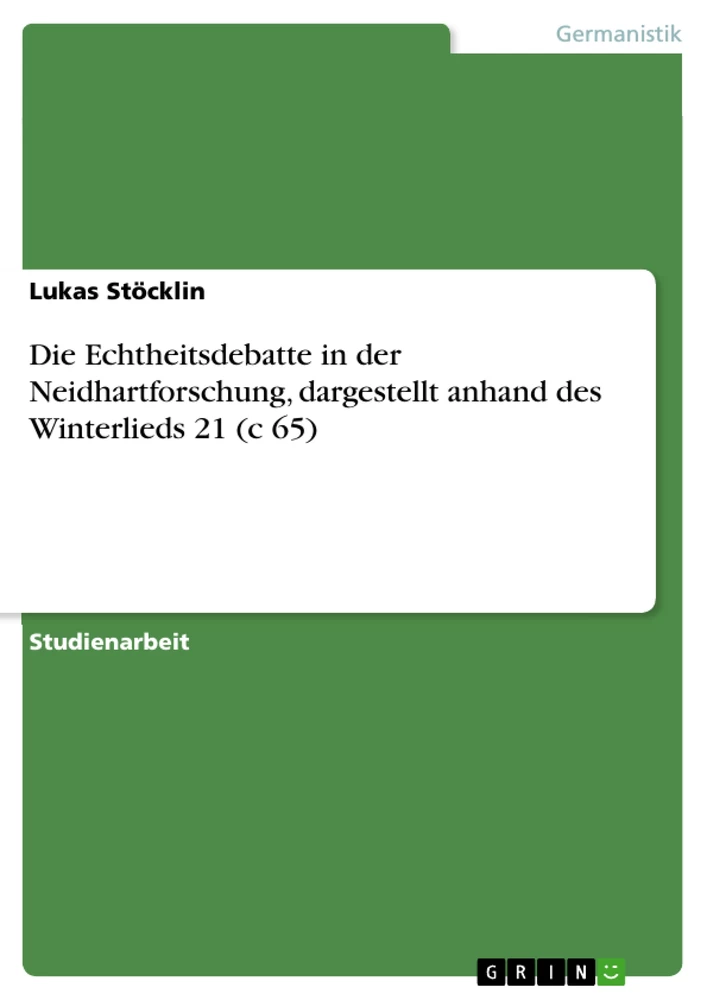Thema der vorliegenden Arbeit ist eine der ältesten und wohl auch heftigsten Debatte der gesamten Neidhartforschung. Es ist die Diskussion über die ‚Echtheit’ oder ‚Unechtheit’ einiger Lieder, die uns unter dem Namen Neidhart überliefert sind. In der ersten kritischen Neidhart-Ausgabe (1858) hat Moriz Haupt nur 66 (29 Sommer-, 37 Winterlieder) von insgesamt etwa 150 Liedern als ‚echt’ eingestuft. Um die „Quellen auszuschöpfen“ publizierte Haupt einen kleinen Teil der als ‚unecht’ ausgesonderten Lieder als Anhang zu seiner Vorrede. Ein beachtlicher Teil der überlieferten Lieder entging indes der kritischen Edition. Einige waren so lange Zeit nur in Friedrich von der Hagens „Minnesinger“-Ausgabe greifbar, andere wiederum wurden erst um einiges später publiziert.
Indem Haupt „die scheidung des echten und des unechten“ zu einer seiner Hauptaufgaben machte, legte er den Grundstein einer lange anhaltenden Debatte. Standen zunächst einmal Haupts Echtheitsentscheidungen an sich zur Diskussion , entfaltete sich im Lauf der Zeit eine lebhafte Grundsatzdebatte darüber, ob eine Trennung zwischen ‚echt’ und ‚unecht’ überhaupt möglich sei. Ziel dieser Arbeit ist es, diese Debatte, die in der neuen Salzburger Neidhart-Ausgabe zu einem vorläufigen Höhepunkt, ja vielleicht sogar zu ihrem Abschluss gelangt ist, in ihren Grundzügen nachzuvollziehen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Debatte anhand eines bestimmten Liedes nachgezeichnet. Zu diesem Zweck wurde das Winterlied 21 ausgewählt, da sich an seiner Editionsgeschichte die grundsätzlichen Fragen der Debatte sowie der aktuelle Stand der Forschung gut zeigen lassen. Moriz Haupt, zweifellos eine Autorität in der Neidhartforschung, nahm das Lied in den Kanon der ‚echten’ Lieder auf.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Winterlied 21 - Kurzinterpretation
- ,Echt' oder,unecht'? – Moriz Haupt und Edmund Wießner
- Jenseits von echt und unecht – Die Salzburger Neidhart-Ausgabe
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Echtheitsdebatte in der Neidhartforschung, die sich um die Frage dreht, welche Lieder tatsächlich von Neidhart stammen. Die Arbeit analysiert die Debatte anhand des Winterlieds 21, das von verschiedenen Forschern unterschiedlich bewertet wurde. Ziel ist es, die Argumentationslinien der Debatte nachzuvollziehen und den aktuellen Stand der Forschung darzustellen.
- Die Echtheitsdebatte in der Neidhartforschung
- Die Editionsgeschichte des Winterlieds 21
- Die Argumentation von Moriz Haupt und Edmund Wießner
- Der aktuelle Stand der Debatte in der Salzburger Neidhart-Ausgabe
- Die Bedeutung der Editionsgeschichte für die Interpretation von Neidharts Liedern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Echtheitsdebatte in der Neidhartforschung vor und erläutert die Bedeutung des Winterlieds 21 für die Debatte. Der Hauptteil der Arbeit gliedert sich in drei Abschnitte. Im ersten Abschnitt wird das Winterlied 21 kurz interpretiert. Der zweite Abschnitt beleuchtet die Argumentation von Moriz Haupt und Edmund Wießner, die das Lied unterschiedlich beurteilten. Der dritte Abschnitt analysiert die Editionsprinzipien der Salzburger Neidhart-Ausgabe und zeigt, wie die Echtheitsdebatte sich in den letzten Jahren entwickelt hat.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Echtheitsdebatte, die Neidhartforschung, das Winterlied 21, Moriz Haupt, Edmund Wießner, die Salzburger Neidhart-Ausgabe, Editionsgeschichte, Interpretation, Liedanalyse, mittelalterliche Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die „Echtheitsdebatte“ in der Neidhartforschung?
Es ist die Diskussion darüber, welche der über 150 überlieferten Lieder tatsächlich vom Dichter Neidhart stammen und welche von Nachahmern verfasst wurden.
Wer legte den Grundstein für diese Debatte?
Moriz Haupt legte 1858 mit seiner kritischen Ausgabe, in der er nur 66 Lieder als „echt“ einstufte, den Grundstein.
An welchem Beispiel wird die Debatte in der Arbeit verdeutlicht?
Die Debatte wird exemplarisch anhand des Winterlieds 21 (c 65) nachgezeichnet.
Wie beurteilten Haupt und Wießner das Winterlied 21?
Haupt nahm es in den Kanon der echten Lieder auf, während spätere Forscher wie Wießner andere Kriterien anlegten.
Was ist das Besondere an der Salzburger Neidhart-Ausgabe?
Sie stellt einen vorläufigen Höhepunkt der Debatte dar und verfolgt Ansätze jenseits der strikten Trennung von „echt“ und „unecht“.
- Arbeit zitieren
- Lukas Stöcklin (Autor:in), 2008, Die Echtheitsdebatte in der Neidhartforschung, dargestellt anhand des Winterlieds 21 (c 65), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113587