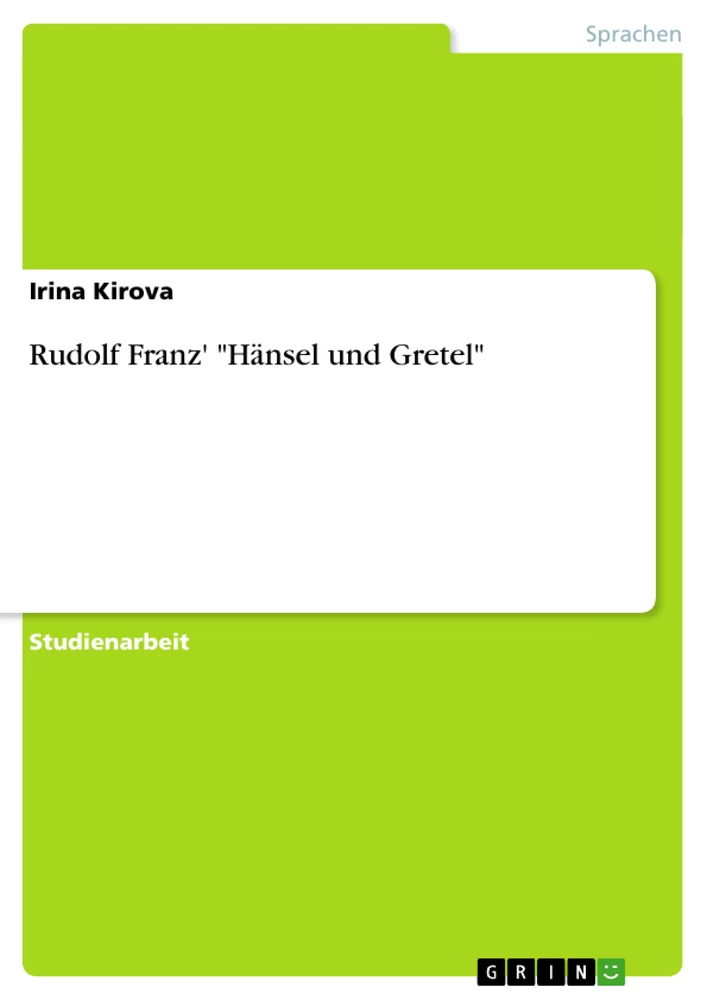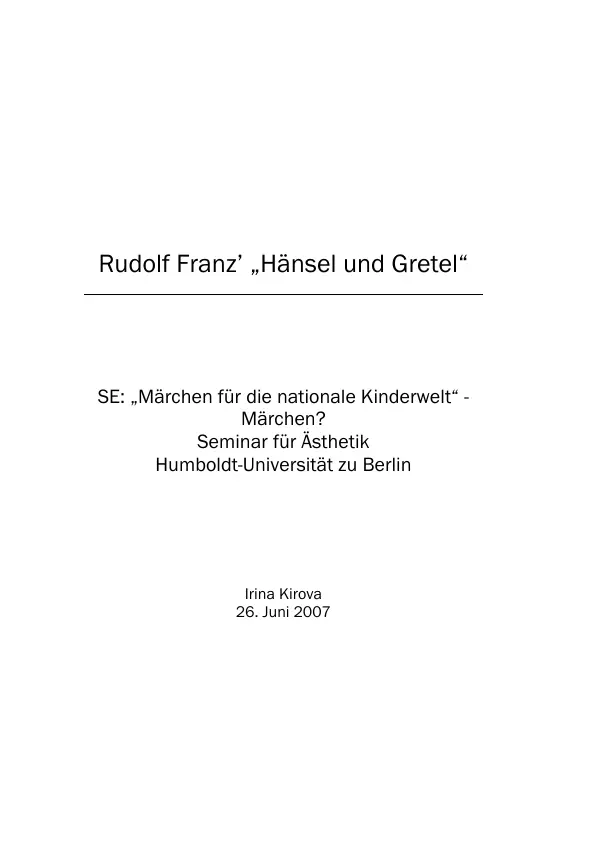Inhaltsverzeichnis
I Betrachtung des Originalmärchens 3
II Rudolf Franz’ „Hänsel und Gretel“ 4
II a Charakterisierung der Familie und Lebenssituation 4
II b Rudolf Franz’ Kritik bezüglich des Widerstandes
gegen die Obrigkeit, Parteizugehörigkeit und Blasphemie 7
III Gattung Märchen als Medium: Franz’ Kritikäußerung - Die
gattungsspezifische Interpretation 8
IV Fazit 9
IV a Zusammenfassung, Deutungsansätze 9
IV b Fragen 10
V Bibliographie 11
Inhaltsverzeichnis
I Betrachtung des Originalmärchens
II Rudolf Franz’ „Hänsel und Gretel“
II a Charakterisierung der Familie und Lebenssituation
II b Rudolf Franz’ Kritik bezüglich des Widerstandes gegen die Obrigkeit, Parteizugehörigkeit und Blasphemie
III Gattung Märchen als Medium: Franz’ Kritikäußerung - Die gattungsspezifische Interpretation
IV Fazit
IV a Zusammenfassung, Deutungsansätze
IV b Fragen
V Bibliographie
Rudolf Franz’ „Hänsel und Gretel“
„Ü ber Gott lässt sich nicht ungestraft spotten. Eine Stimme ertönte innen: ,Knusper, knusper, kneischen! Wer knuspert an meinem Häuschen? ’ Die verlogenen Kinder antworteten frech: ,Der Wind, der Wind, das himmlische Kind! “’
I Betrachtung des Originalmärchens
I Betrachtung des Originalmärchens
- Hänsel und Gretel sind die Kinder eines armen Holzfällers, der mit seiner zweiten Frau im Wald lebt
-als die Not zu groß wird, überredet die Stiefmutter ihren Mann, die beiden Kinder nach der Arbeit im Wald zurück zu lassen; der Holzfäller führt die beiden am nächsten Tag in den Wald, Hänsel hat die Eltern belauscht, und er und Gretel legen eine Spur aus kleinen weißen Steinen
-der zweite Versuch gelingt, weil Hänsel und Gretel nur eine Scheibe Brot dabei haben, legen sich eine Spur aus Krümeln, doch die wird von Vögeln gefressen
-die Kinder finden nicht nach Hause und verirren sich
-sie finden ein Häuschen aus Brot, Kuchen und Zucker; die hungrigen Kinder brechen sich ein paar Stückchen ab
-jedoch lebt darin eine Hexe, die die beiden ins Haus lockt. Sie ruft: „ Knusper knusper Knäuschen, wer knuspert an mei'm Häuschen? “ - „ Der Wind, der Wind, das himmlische Kind “, antworten die Kinder
-Gretel wird zur Dienstmagd und Hänsel in einem Käfig gehalten und gemästet
-Hänsel soll fett werden, was die Hexe täglich überprüft; aber Hänsel streckt ihr nur immer einen kleinen Knochen entgegen
-im Glauben der Junge werde nicht dicker, verliert die Hexe die Geduld und will ihn sofort braten
-Gretel soll in den Ofen gucken, um zu sehen, ob der schon heiß genug ist, aber sie behauptet zu klein zu sein, sodass die Hexe selbst nachsehen muss, woraufhin Gretel sie hineinstößt
-die Kinder nehmen alles Wertvolle aus dem Hexenhaus mit und finden den Weg zurück nach hause; die Stiefmutter ist inzwischen gestorben
-und die Familie lebte bis an ihr Lebens Ende, da sie nun genug zu essen hatte
- Motiv des Stiefmuttermärchens; dabei sind die Rabenmutter und die Hexe oft dieselbe Person darstellen (sie sterben auch gleichzeitig)
- in der Urfassung der Brüder Grimm, ist es noch die eigene Mutter, was dem Märchen eine eher sozialkritische Bedeutung gibt. Die Kinder werden ausgesetzt, weil die Familie verhungert.
II Rudolf Franz' Hänsel und Gretel
II a Charakterisierung der Familie und Lebenssituation
- Familie ist unzufrieden und undankbar; sie könne sich alle zwei Tage satt essen und ist doch nicht glücklich, weil sie im Verband organisiert ist
- Sie müssen halt die „gefräßigen“ Bebel, Singer, Luxenburg „mästen“, und sie werden nicht einmal fett
- Zwei Kinder: Hänsel und Gretel, die gewöhnlichen Namen deuten schon an, wie gewöhnlich die Kinder sind
- Die Eltern haben nichts für sich selbst, sodass der Vater die Mutter aufhetzt; Mutter hat Idee, die Kinder auszusetzen
- Kinder sind heuchlerisch und verlogen; Beispiel: sie tun nur so, als ob sie schlafen
- Gretel „flennt“; Hänsel stiehlt die schönsten Steine aus dem Nachbargarten, verheimlicht Dinge wie er es vom Vater gelernt hat = beide sind schön „frühverdorben“
- Vater belügt Kinder und setzt sie im Wald aus Sie widersetzen sich, ignorieren Obrigkeiten Kinder sind faul, sie schlafen bis Mittag
- Kinder sind unartig und „ungeraten“; die gestohlenen Steine verhalfen ihnen, den Weg zurück nach hause zu finden
- der erste Versuch, die Kinder auszusetzen scheitert, sodass die Mutter beim zweiten Mal „heimtückisch“ die Tür verschließt, damit Hänsel nicht wieder Steine stehlen kann
- der „dumme“ Junge hinterlegt diesmal Brotkrumen, die von Vögeln gefressen; Kinder aus gutem Hause hätten das Brot ohnehin für sich behalten („töricht gehandelt“)
- Kinder heulten und schliefen hungrig im Wald ein („wie richtige Strolche“)
- am nächsten Tag stahlen sie Beeren, um sich damit vollzufressen die gierigen Kinder trafen auf ein Häuschen aus Brot, Kandis und Eierkuchen und aßen selbstverständlich ganz unbescheiden vom Eierkuchendach und den Kandisfenstern
- als eine Stimme fragte, wer dort sei, antworteten die Kinder „verlogen“, es sei der Wind und aßen weiter („weil sie als richtige Sozialdemokratenkinder eben nie genug kriegen konnten“)
- als eine alte Dame aus dem Haus kommt, erschrecken sie feige und erfüllt von schlechtem Gewissen („wie solche Kinder sind“)
- die Dame lud sie ein, tischte ihnen gute Sachen auf, und nachdem sie sich für einen kurzen Moment genierten, stopften sie sich die Bäuche voll, ohne sich auch nur zu bedanken
- die Dame bot ihnen zwei Betten an, obwohl eins vollkommen ausreichend gewesen wäre
- im Häuschen: Gretel musste Hausarbeiten verrichten, und die Dame machte vom Züchtigungsrecht gebrauch, wie es ihr zustand, doch die ungeratenen Kinder weinten und schrien nur
- Gretel schmiedete einen grausamen Plan: die alte Dame, die nur Brot backen wollte, und Gretel darum bat, in den Ofen zu schauen, ob das Brot schon braun sei, musste selber in den Ofen, da Gretel sich dumm stellte („vielleicht war sie’s auch wirklich“); „schändlich“ schob Gretel sie in den Ofen und schlug die Eisentür hinter ihr zu und befreite den Bruder
- die verdorbenen Kinder freuten sich über ihre Taten, klatschten in die Hände und tanzten = die Frucht sozialdemokratischer Kindererziehung Kinder durchsuchten das Haus auf Wertgegenstände und nahmen mit, was sie finden konnten:
[…] sie durchsuchten auch noch das Haus von oben bis unten und stahlen, was sie kriegen konnten: einen Strumpf mit Goldstücken, ein Sparkassenbuch über hunderttausend Mark und den ganzen wertvollen Schmuck der alten Dame. Dann stieg Hänsel auf das Dach, hielt Umschau und merkte sich die Richtung, in der sie gehen mussten, um aus dem Walde zu kommen. Wahrscheinlich war das aber nur ein Vorwand und er wollte in Wirklichkeit nachsehen, ob nicht unter den Eierkuchendachziegeln noch mehr Geld versteckt wäre.1
- sie fanden zurück nach hause, als die Eltern gerade des Kindesmordes wegen abgeführt werden
- die Kinder belogen den Gendarmen, sie hätten sich nur verirrt und die Familie lebte glücklich, freute sich über die Beute und spendete auch noch einen Großteil der Partei:
Mit einem Teil des gestohlen Geldes, das sie einfach unterschlugen, unterstützten sie die sozialdemokratische Parteikasse […] Dann kauften sie sich das Schloss Bebels am Züricher See und lebten herrlich und in Freuden. So machen es die Sozialdemokraten, um reich zu werden.2
II b Rudolf Franz’ Kritik bezüglich des Widerstandes gegen die Obrigkeit, Parteizugehörigkeit und Blasphemie
Widerstand gegen die Obrigkeit
- sie machen ein Feuer im Wald
- Eltern haben Angst vor der Polizei, schon allein wegen der Partei
- Gestohlene Kieselsteine helfen ihnen; das Verbrechen macht sich für sie bezahlt
- Kinder stehlen Erd- und Waldbeeren ohne Erlaubnisschein zum Pflücken
- die verdorbenen Kinder konnten nur mit Androhung der Polizei zur Ruhe gebracht werden
- Gretel ermordet die fromme alte Dame und macht sich der Gefangenenbefreiung schuldig
- die Kinder belügen den Gendarmen
Parteizugehörigkeit
- Eltern sind im Verband der Land-, Wald-, und Weinbergarbeiter organisiert
- zahlen gewaltigen Beitrag von 50 Mark in die sozialdemokratische Kasse
- spenden das Geld der alten Dame an die Parteikasse
Blasphemie
- Kieselsteine zerstören Gottes schönes Werk
- Gottloser Vater verteilt sonntags zur Kirchzeit Flugblätter
- „Holzfrevel“; sie stehlen Reisig und entzünden Feuer
- Hänsel zerbröselt das Brot („die schöne Gottesgabe“)
- im Haus der frommen alten Dame, schlafen die Kinder ein, ohne zu beten; um sie zu bestrafen, sperrte die Dame die Kinder am nächsten morgen ein
III Gattung Märchen als Medium: Franz’ Kritikäußerung - Die gattungsspezifische Interpretation
- das Märchen ist eben nie irgendein Märchen, es ist immer ein ganz bestimmtes Märchen, dessen Geschichte jeder zu kennen glaubt
- Märchen erscheinen zeitlos populär: die fantastische Verkleidung der Lebensweltlichkeit ermöglicht dem Autoren gerade auch unangenehme Themen wie Tod, Missbrauch, Pubertäts- und Adoleszenzkrisen, politische Missstände in scheinbar unverfänglicher Gattung zu vermitteln
- Schutzmauer um den Leser: alles Menschliche kommt in der
Märchensprache und im Bereich des Wunderbaren unter, so dass der Leser zunächst eine beruhigende Mauer um sich aufbauen kann, in dem Glauben, das diese Dinge nichts mit ihm persönlich zu tun hätten Natürlich haben sie viel mit der Lebenswelt des Lesers zu tun. Und die Universalität des bestimmten Artikels (als Kontrapunkt zur Singularität) macht anthroposophische Grundmuster und -ängste deutlich:
- personale Universalität: Geschichten in Märchen können theoretisch jedem widerfahren
-lokale Universalität: das Dorf, der Fluss, das Häuschen im Wald...
-temporale Universalität: "Es war einmal..."
- Rudolf Franz rückt allerdings von einer absoluten Märchenwelt ab; durch konkrete Hinweise auf damals aktuelle politische Gegebenheiten zieht er den Leser in seine eigene Realität, in der er sich mit den konkreten, vom Autor aufgezeigten, Problemen befassen muss = jeder Leser ist also zwangsläufig genötigt, eine Identifikation mit einem oder mehrerer der Märchenprotagonisten vorzunehmen, wodurch er auch gleichermaßen empfänglich für die Kritik ist
IV Fazit
IV a Zusammenfassung, Deutungsansätze
- Rudolf Franz unternimmt hier eine Satire eines berühmten Volksmärchens; kein Kunstmärchen, da:
- kein fixierter Ort
-keine künstlerische Sprache
-keine mehrdimensionalen Charaktere
-kein komplexes Weltbild
- Merkmale des typischen Märchens sind:
- Held muss eine Aufgabe lösen
-magische Requisiten
-Zahlen-/Natursymbolik
-Bezug zu Mythen/Transzendenz
-symbolträchtiges Verhalten und dadurch Bewältigen alltäglicher Probleme
- Rudolf Franz unternimmt eine Abkehr vom klassischen Volksmärchen der Gebrüder Grimm, die vor allem bei Kindern beliebt sind:
Mehr und mehr hat sich in den Herzen unserer vaterländisch gesinnten Jugend ein Abscheu gegen jene Sorte von Märchen eingenistet, die z.B. vor langen Jahren von den sozialdemokratischen ‚Historikern’ Jakob und Wilhelm Grimm herausgegeben worden sind und zahllose Bearbeitungen erfahren haben, ohne dass sich ein Herausgeber bemüßigt gesehen hätte, der gehässigen Manier, in der die ‚Genossen’ Grimm die Dinge durch ihre rote Parteibrille betrachtet haben, zu Leibe zu gehen und die maßlos verhetzenden
Verleumdungen dieser roten Brüder gebührend
zurückzuweisen. Alles Hohe und Heilige wird da in den Staub gezerrt. Monarchie, Besitz, Religion - nichts wird verschont.3
- Märchen enden prinzipiell gut; das Gute siegt stets über das Böse
- untypischerweise siegt hier das Böse über das Gute, die fromme alte Dame, die es nur gut meinte, verbrennt qualvoll
- all die Bösartigkeiten machen sich bezahlt und bleiben ungestraft
IV b Fragen
Wieso arbeitet Franz mit Klischees?
Ist seine Kritik daher nicht umso angreifbarer?
Ist Franz’ Kritik nicht so überdeutlich, dass sie als Farce einer solchen gedeutet werden könnte?
Und bezweckt sie nicht vielleicht sogar, jegliche Kritik ins Lächerliche zu ziehen?
V Bibliographie
Eisbrenner, Astrid. Das Erscheinen des Schönen . Goethes Ästhetik des Lebendigen, Diss. Marburg 2002.
Franz, Rudolf. Die schönsten Märchen für die nationale Kinderwelt. München 1910.
Neuhaus, Stefan. Märchen. Tübingen 2005.
Lüthi, Max. Märchen. Stuttgart 1996.
[...]
1 Franz, Rudolf. Die schönsten Märchen für die nationale Kinderwelt. 41
2 Franz. 41
Häufig gestellte Fragen zu Rudolf Franz’ „Hänsel und Gretel“
Worum geht es im Originalmärchen von Hänsel und Gretel?
Das Originalmärchen handelt von den Kindern eines armen Holzfällers, Hänsel und Gretel, die von ihrer Stiefmutter im Wald ausgesetzt werden. Sie verirren sich, finden ein Knusperhäuschen, das von einer Hexe bewohnt wird. Die Hexe sperrt Hänsel ein und will ihn mästen, während Gretel als Dienstmagd arbeiten muss. Schließlich überlistet Gretel die Hexe und stößt sie in den Ofen. Die Kinder nehmen Wertgegenstände aus dem Haus der Hexe mit und finden zurück nach Hause, wo die Stiefmutter inzwischen gestorben ist. Die Familie lebt von da an in Wohlstand.
Wie charakterisiert Rudolf Franz die Familie in seiner Version von Hänsel und Gretel?
Franz stellt die Familie als unzufrieden, undankbar und im Verband organisiert dar. Die Kinder, Hänsel und Gretel, werden als gewöhnlich, heuchlerisch, verlogen und frühverdorben beschrieben. Die Eltern hetzen sich gegenseitig auf und setzen die Kinder im Wald aus.
Welche Kritik übt Rudolf Franz in seiner Version des Märchens?
Franz kritisiert Widerstand gegen die Obrigkeit, Parteizugehörigkeit (insbesondere Sozialdemokratie) und Blasphemie. Die Kinder werden als unartig dargestellt, die Eltern als Parteimitglieder, die Gottlose Taten vollbringen. Sie begehen Verbrechen, belügen die Polizei und spenden das gestohlene Geld an die sozialdemokratische Parteikasse.
Wie unterscheidet sich Rudolf Franz’ „Hänsel und Gretel“ vom Originalmärchen?
Franz’ Version weicht von der klassischen Darstellung ab, indem sie aktuelle politische Gegebenheiten einbezieht und eine kritische Sichtweise auf die Sozialdemokratie und den Widerstand gegen Autoritäten vermittelt. Während das Originalmärchen gut endet und das Gute über das Böse siegt, siegt in Franz’ Version das Böse und die Taten der Kinder bleiben ungestraft.
Welche Gattungsmerkmale weist Rudolf Franz’ Version auf?
Franz’ Version wird als Satire eines Volksmärchens beschrieben, aber nicht als Kunstmärchen. Sie weist zwar Merkmale eines typischen Märchens auf, wie z.B. die Aufgabe, die der Held lösen muss, magische Requisiten und Symbolik, entfernt sich aber von der idealisierten Darstellung der Gebrüder Grimm und kritisiert soziale und politische Missstände.
Welche Fragen werden am Ende des Textes aufgeworfen?
Am Ende des Textes werden Fragen aufgeworfen, die die Kritik von Franz hinterfragen: Wieso arbeitet Franz mit Klischees? Ist seine Kritik daher nicht umso angreifbarer? Ist Franz’ Kritik nicht so überdeutlich, dass sie als Farce einer solchen gedeutet werden könnte? Und bezweckt sie nicht vielleicht sogar, jegliche Kritik ins Lächerliche zu ziehen?
- Citar trabajo
- Irina Kirova (Autor), 2007, Rudolf Franz' "Hänsel und Gretel", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113608