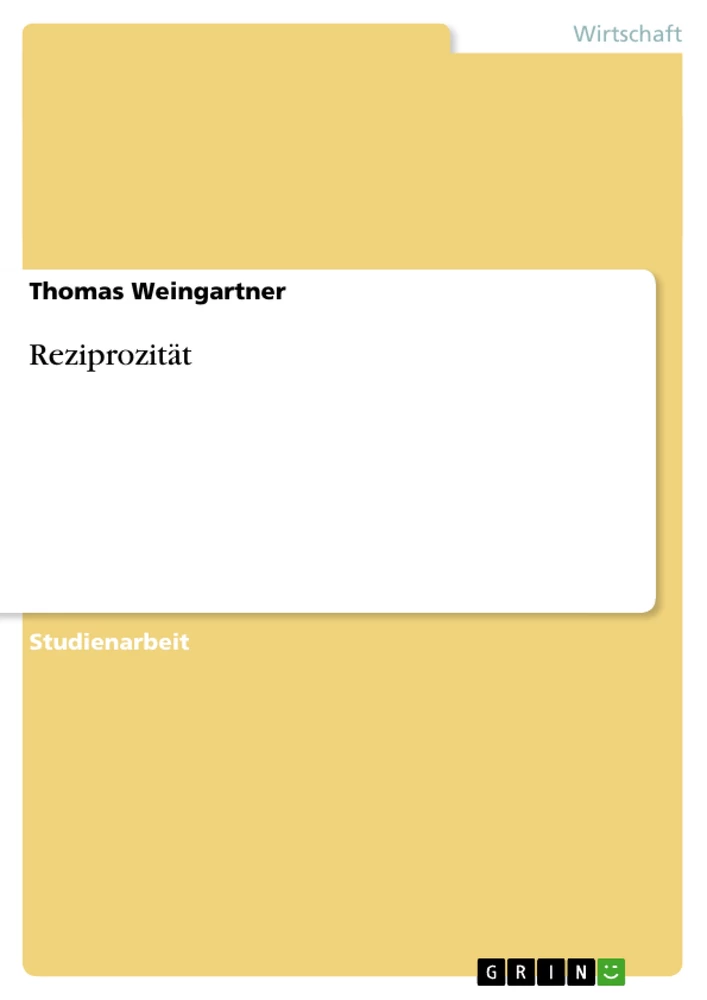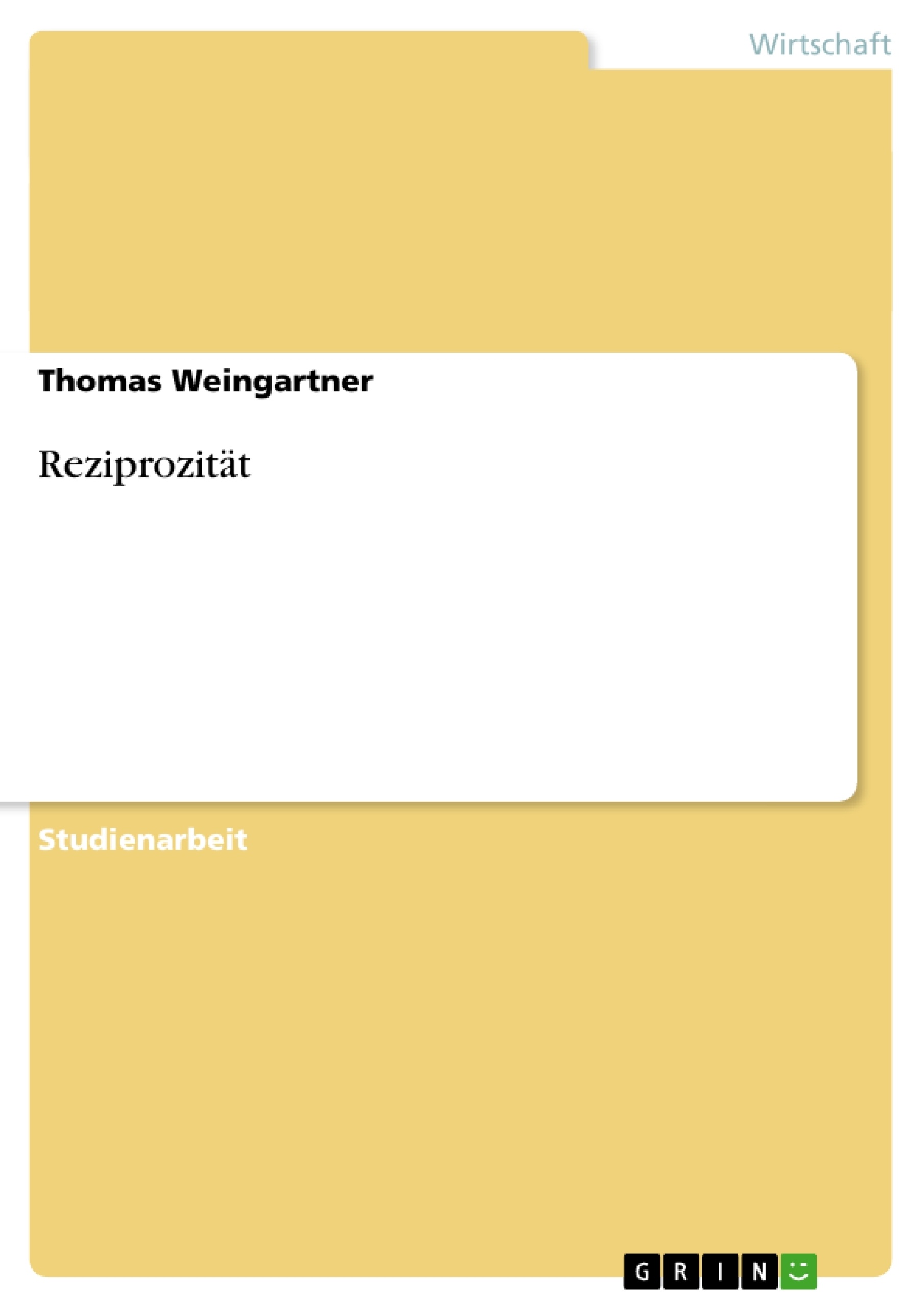Wirtschaft scheint logisch. Das Studium eines Ökonoms besteht größtenteils darin, sich mit
technischen Fertigkeiten und Werkzeugen auszustatten, um schließlich auf dem effizientesten Weg
zum Gleichgewicht zu gelangen. Nutzenmaximierung, Rationalität, die optimale Menge,
Erstausstattungen und Allokationen sind Fachbegriffe, die uns bereits aus dem Grundstudium
geläufig sind. Besonders das Nutzenmaximierungsverhalten homogener Agenten war und ist ein
Steckenpferd der ökonomischen Sicht, das sich aufgrund erfolgreicher Vorhersagemöglichkeiten bis
heute durchgesetzt hat. Jedoch können nur zutreffende Ergebnisse aus standardisierten Modellen
auf vollständigen Märkten gefolgert werden1.
Diese oft zwanghaft erscheinende, von der Realität entfremdete Kallibrierung von Modellen fiel
Adam Smith bereits im Jahre 1759 auf. Smith, nicht nur Ökonom, sondern auch bedeutender
Moralphilosoph, wies darauf hin, dass sich der Nutzen eines Individuums nicht nur durch
Abbildung seiner eigenen Präferenzen darstellen ließe. Vielmehr strich er heraus, dass das
Wohlbefinden von sozialer Interaktion abhängt und somit erheblichen Einfluss auf dessen
wirtschaftliches Handeln hat. Die Sympathie mit den Mitmenschen unterstellte er als Grundlage der
Moral und als Triebfeder menschlichen Handelns.2
Das Auftreten von Phänomenen wie unvollständigen Märkten, Finanzmarkträtseln wie dem
Risikoprämienrätsel oder einfachen Allokationsproblemen zeugen von der Tatsache, dass
ökonomische Grundmodelle an ihre Grenzen stoßen. Um auch weiche Faktoren, wie beispielsweise
Heterogenität, in Nutzentheorien berücksichtigen zu können, ist es nötig, psychologische und
moralische Konzepte zu verstehen und in wirtschaftliche Denkstrukturen aufzunehmen und
umzusetzen. Seit den 80er Jahren hat dieser Sinneswandel in der Ökonomie Einzug erhalten, so
dass sozialpsychologische Ansätze wie Fairness und Reziprozität mehr und mehr in wirtschaftliche
Modelle eingebettet werden.
Diese Arbeit soll das Konzept der Reziprozität, also das gegenseitige Austauschen von
Gefälligkeiten, aus dem sozialpsychologischen Blickwinkel beleuchten, von anderen
psychologischen Verhaltensweisen abgrenzen und schließlich ökonomische Implikationen dieser
Grundmoral andeuten. Als Rahmen dient hier der Artikel „The Norm of Reciprocity: A Preliminary
Statement“ von Alvin W. Gouldner.
Nach Vermittlung der Norm aus sozialpsychologischer Sicht wird anhand von Experimenten die
Nutzbarmachung des Prinzips veranschaulicht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ursprung
- 3. Definition
- 4. Reziprozität und Funktionalismus
- 5. Reziprozität beeinflussende Faktoren
- 6. Ein Extremfall: Das Ausbeutungsproblem
- 7. Malinowskis Reziprozität
- 8. Reziprozität als Teil einer Kultur
- 9. Egoismus und soziale Interaktion
- 10. Reziprozität als Startmechanismus eines sozialen Systems
- 11. Nutzbarmachung des Prinzips
- i. Effects of a Favor and Liking on Compliance
- ii. Die "Door-in-the-Face" Technik
- iii. Die “That's-not-all” Technik
- 12. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konzept der Reziprozität aus sozialpsychologischer Perspektive. Sie grenzt Reziprozität von anderen psychologischen Verhaltensweisen ab und deutet ökonomische Implikationen dieser Grundmoral an. Der Artikel „The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement“ von Alvin W. Gouldner dient als Rahmen. Die Arbeit beleuchtet den Ursprung und die Definition von Reziprozität, betrachtet den funktionalistischen Ansatz und untersucht schließlich die praktische Anwendung des Prinzips anhand von Experimenten.
- Der Ursprung und die historische Entwicklung des Reziprozitätsprinzips.
- Die Abgrenzung von Reziprozität zu anderen Austauschformen (z.B. rein ökonomische Transaktionen).
- Die Rolle der Reziprozität im Funktionalismus und die kritische Auseinandersetzung mit dem "Survival"-Konzept.
- Die ökonomischen Implikationen von Reziprozität und deren Bedeutung für ökonomische Modelle.
- Die praktische Anwendung des Prinzips der Reziprozität anhand empirischer Beispiele.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Diskrepanz zwischen der vereinfachten Nutzenmaximierungslogik in der traditionellen Ökonomie und der Realität komplexer sozialer Interaktionen dar. Sie hebt die Bedeutung sozialer Faktoren, insbesondere der Sympathie und des Einflusses auf das wirtschaftliche Handeln, hervor und führt in die Thematik der Reziprozität als wichtiger Bestandteil sozialpsychologischer und ökonomischer Modelle ein. Die Arbeit wird als Auseinandersetzung mit dem Konzept der Reziprozität im Kontext der sozialpsychologischen Forschung angekündigt.
2. Ursprung: Dieses Kapitel verfolgt den Ursprung des Begriffs „Reziprozität“ bis in die Antike zurück. Es werden Beispiele aus der griechischen Polis und dem römischen Reich angeführt, um zu zeigen, dass das Prinzip des gegenseitigen Austauschs von Leistungen und Gefälligkeiten bereits seit langem ein integraler Bestandteil menschlicher Gesellschaften ist. Die Kapitel zeigt auf, dass die Reziprozität bereits in den frühen Kulturen eine zentrale Rolle spielte und durch religiöse Einflüsse und soziale Normen geprägt wurde. Die Übertragbarkeit dieses Konzepts auf die moderne Zeit wird als zentrale Fragestellung formuliert.
3. Definition: Dieses Kapitel liefert eine präzise Definition von Reziprozität als gegenseitigen Austausch von Gefälligkeiten, wobei die Quantität und der zeitliche Rahmen der Leistungen unbestimmt bleiben können. Es unterscheidet Reziprozität von rein ökonomischen Transaktionen, indem es die Unsicherheit als entscheidendes Merkmal hervorhebt, welche durch soziale und moralische Beziehungen zwischen den Akteuren geprägt ist. Die Rolle der Sozialpsychologie bei der Analyse dieser Interaktionen wird hervorgehoben.
4. Reziprozität und Funktionalismus: Dieses Kapitel erörtert den funktionalistischen Ansatz in der Soziologie und Ethnologie und seine Anwendung auf das Verständnis von Reziprozität. Es diskutiert den Konflikt zwischen dem funktionalistischen Ansatz und dem „Survival“-Konzept, wobei gezeigt wird, dass Reziprozität als integraler Bestandteil funktionaler Theorien unerlässlich ist, um die Existenz von nicht-funktionalen Handlungsmustern zu erklären.
Häufig gestellte Fragen zum Text über Reziprozität
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text behandelt das Konzept der Reziprozität aus sozialpsychologischer Perspektive. Er untersucht den Ursprung und die Definition von Reziprozität, betrachtet den funktionalistischen Ansatz und analysiert die praktische Anwendung des Prinzips anhand von Experimenten. Der Artikel "The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement" von Alvin W. Gouldner dient als theoretischer Rahmen.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter: den Ursprung und die historische Entwicklung des Reziprozitätsprinzips; die Abgrenzung von Reziprozität zu anderen Austauschformen (z.B. rein ökonomische Transaktionen); die Rolle der Reziprozität im Funktionalismus und die kritische Auseinandersetzung mit dem "Survival"-Konzept; die ökonomischen Implikationen von Reziprozität und deren Bedeutung für ökonomische Modelle; sowie die praktische Anwendung des Prinzips der Reziprozität anhand empirischer Beispiele (wie "Door-in-the-Face" und "That's-not-all" Techniken).
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung und endend mit einem Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Reziprozität. Der Text enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte sowie Kapitelzusammenfassungen.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Der Text umfasst Kapitel zu Einleitung, Ursprung, Definition, Reziprozität und Funktionalismus, Faktoren, die Reziprozität beeinflussen, einem Extremfall (Ausbeutung), Malinowskis Reziprozität, Reziprozität als Teil einer Kultur, Egoismus und sozialer Interaktion, Reziprozität als Startmechanismus eines sozialen Systems, praktischer Anwendung des Prinzips (mit Unterkapiteln zu "Effects of a Favor and Liking on Compliance", "Door-in-the-Face" Technik und "That's-not-all" Technik) und einem Fazit.
Welche konkreten Beispiele für die Anwendung des Reziprozitätsprinzips werden genannt?
Der Text erwähnt und erklärt die "Door-in-the-Face" und die "That's-not-all" Technik als Beispiele für die praktische Anwendung des Reziprozitätsprinzips. Diese Techniken werden im Detail erläutert und als empirische Belege für die Wirksamkeit des Prinzips angeführt.
Wie unterscheidet sich Reziprozität von rein ökonomischen Transaktionen?
Der Text hebt hervor, dass sich Reziprozität von rein ökonomischen Transaktionen durch die Unsicherheit und die sozialen und moralischen Beziehungen zwischen den Akteuren unterscheidet. Bei Reziprozität ist die Quantität und der zeitliche Rahmen der Leistungen nicht unbedingt festgelegt, im Gegensatz zu den klar definierten Austauschbeziehungen in ökonomischen Modellen.
Welche Rolle spielt der Funktionalismus im Text?
Der Text diskutiert den funktionalistischen Ansatz in der Soziologie und Ethnologie und seine Anwendung auf das Verständnis von Reziprozität. Es wird ein Konflikt zwischen dem funktionalistischen Ansatz und dem "Survival"-Konzept erörtert, wobei gezeigt wird, dass Reziprozität für funktionale Theorien essentiell ist, um das Vorhandensein nicht-funktionaler Handlungsmuster zu erklären.
- Citation du texte
- Thomas Weingartner (Auteur), 2006, Reziprozität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113655