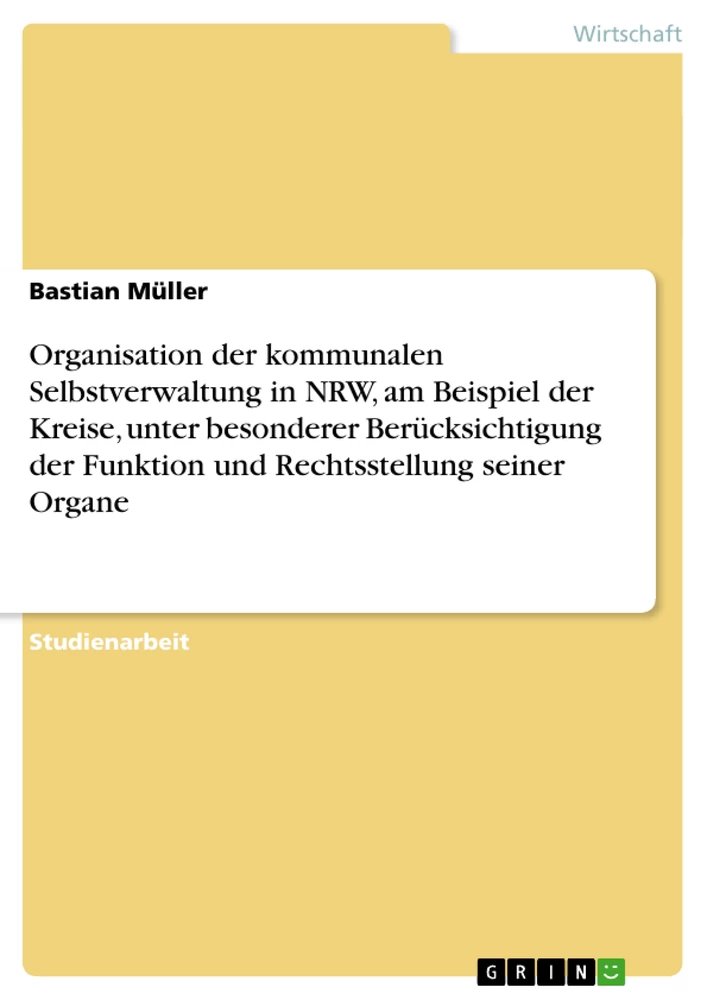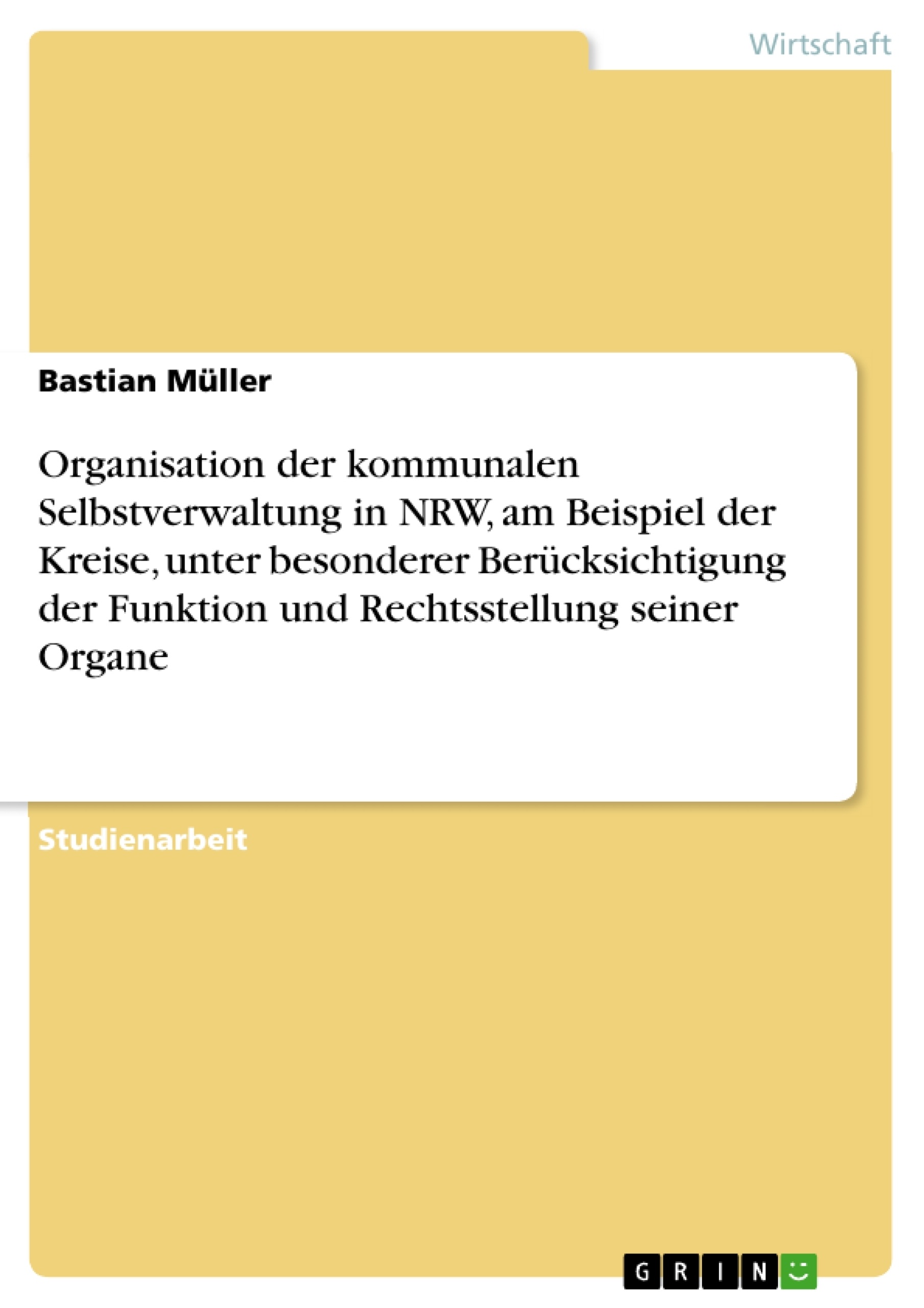Will man sich in einem ersten Schritt der Frage nach der rechtlichen Relevanz und Einordnung des Begriffes der „kommunalen Selbstverwaltung“ nähern, so scheint es sinnvoll der rechtlichen Entwicklung in der Bundesrepublik nach dem zweiten Weltkrieg sein Augenmerk zu widmen.1 Nach dem Krieg wurde Deutschland rechtlich als demokratischer, sozialer und föderaler Bundesstaat2 neu aufgebaut3. Dieser Neuaufbau fand und findet seine entsprechenden gesetzlichen Regelungen in der bundesrepublikanischen Verfassung – dem Grundgesetz. Beim Studium des Grundgesetzes (GG) ist zu erkennen, dass mit dem Artikel 28 GG eine Basis gefunden werden kann, um, wie oben erwähnt, sich dem Terminus der kommunalen Selbstverwaltung zu nähern. Dem Artikel 28 GG ist nämlich zu entnehmen, dass den Gemeinden und Kreisen4 das Recht zusteht, ihre Aufgaben im Rahmen der Gesetze eigenverantwortlich und eigenständig (also selbstverwaltend) zu erfüllen.5 Dem Art. 28 GG entsprechend, ergibt sich demnach eine Selbstverwaltungsgarantie für die Gemeinden und Gemeindeverbände. Weiterhin ist dem Art. 28 GG im Abs. 1 Satz 2 zu entnehmen, dass in (Ländern)6, Kreisen und Gemeinden das Volk eine aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgehende Vertretung haben muss. Hieraus ergibt sich demnach auch auf Gemeinde- und Kreisebene der Grundsatz der repräsentativen Demokratie. Während die Homogenitätsklausel7 und die Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 GG zwar einheitliche Grundlagen für das gesamte Bundesgebiet vorgeben, geht das heute in der Bundesrepublik Deutschland geltende Kommunalrecht jedoch auf Landesgesetze zurück, die in der Zeit zwischen 19468 und 1958 erlassen worden sind.9 Dies findet seine Begründung ebenfalls im GG, denn gemäß der Art. 70 und Art. 73 – 75 GG kommt den Ländern im Bereich des Kommunalrechts die ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeit zu.10 Auf Grund dieser Regelungen im GG kam und kommt es – unterhalb der harmonisierenden Vorgaben des GG – zu differenten Entwicklungen in den Kommunalverfassungen der Länder. Wenn auch an verschiedener Stelle in der Literatur dieser Umstand u.a. als eine „landesrechtliche Betonierung der Zersplitterung“11 bedauert wird, spiegelt sich in diesem Umstand aber auch die durch den Gesetzgeber gewollte Föderalstruktur wider. Das aus dem Art. 28 GG abzuleitende Recht der Gemeinden und Kreise auf Selbstverwaltung innerhalb ihrer Kommune12, [...]
Inhaltsverzeichnis
- Inhalt
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Problemfeld
- Verfassungsrechtliche Garantien und Rechtsgrundlagen
- Bundes- und Landesrecht (Verfassungsrechtliche Garantien)
- Allgemeine Rechtsvorschriften und kommunales Eigenrecht
- Ergänzende Rechtsvorschriften
- Exkurs: Gebietskörperschaft
- Staatsprinzipien und Verwaltung
- Verwaltungsstruktur
- Aufbau der (kommunalen) Verwaltung NRW
- Der Aufgabenbereich der Kreise innerhalb der Selbstverwaltung
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben der Kreise
- Übergemeindliche Aufgaben
- Ausgleichende Aufgaben
- Ergänzende Aufgaben
- Abgrenzungsregeln und Problematiken
- Die innere Verfassung der Kreise
- Der Kreistag
- Rechtsstellung des Kreistages
- Verfahrensrechtliche Grundlagen der Willensbildung
- Einladung und Tagesordnung
- Eröffnung und Beschlussfähigkeit
- Leitung und Hausrecht
- Niederschrift und Öffentlichkeit
- Wahlen und Beschlüsse
- Ausschüsse
- Der Kreisausschuss
- Der Landrat
- Fazit
- Schlussbemerkung
- Literaturverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Organisation der kommunalen Selbstverwaltung in Nordrhein-Westfalen, insbesondere mit den Kreisen. Der Fokus liegt auf der Funktion und Rechtsstellung der Organe der Kreise, dem Kreistag, dem Kreisausschuss und dem Landrat. Die Arbeit analysiert die verfassungsrechtlichen Grundlagen, die Rechtsvorschriften und die Organisationsstruktur der Kreise. Dabei wird untersucht, welche Aufgaben den Kreisen im Rahmen der Selbstverwaltung übertragen sind und wie diese durch die jeweiligen Organe wahrgenommen werden.
- Verfassungsrechtliche Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung
- Rechtsstellung und Aufgaben der Kreisorgane (Kreistag, Kreisausschuss, Landrat)
- Organisation und Funktionsweise der Kreisverwaltung
- Abgrenzung der Aufgabenbereiche zwischen den Kreisen und anderen Gebietskörperschaften
- Aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen in der Kreisverwaltung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Problemfeld der Organisation der kommunalen Selbstverwaltung in NRW ein und skizziert die Fragestellung der Arbeit. Das zweite Kapitel beleuchtet die verfassungsrechtlichen Garantien und Rechtsgrundlagen, die der kommunalen Selbstverwaltung zugrunde liegen. Es werden dabei sowohl Bundes- und Landesrecht als auch allgemeine Rechtsvorschriften und kommunales Eigenrecht betrachtet. Der Exkurs im dritten Kapitel widmet sich dem Begriff der Gebietskörperschaft. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den Staatsprinzipien und der Verwaltungsstruktur in NRW. Es wird der Aufbau der (kommunalen) Verwaltung in NRW dargestellt. Das fünfte Kapitel untersucht den Aufgabenbereich der Kreise innerhalb der Selbstverwaltung. Dabei werden freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben, wie übergemeindliche, ausgleichende und ergänzende Aufgaben, sowie Abgrenzungsregeln und Problematiken beleuchtet. Das sechste Kapitel widmet sich der inneren Verfassung der Kreise, wobei die Rechtsstellung und die Verfahrensrechtlichen Grundlagen der Willensbildung des Kreistages, die Aufgaben des Kreisausschusses und die Rolle des Landrats im Einzelnen dargestellt werden. Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Kommunale Selbstverwaltung, Kreisordnung NRW, Kreistag, Kreisausschuss, Landrat, Rechtsstellung, Aufgabenbereiche, Verwaltungsstruktur, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben, Abgrenzungsregeln, Staatsprinzipien.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die rechtliche Basis der kommunalen Selbstverwaltung?
Die Basis bildet Artikel 28 des Grundgesetzes (GG), der Gemeinden und Kreisen das Recht garantiert, ihre Aufgaben im Rahmen der Gesetze eigenverantwortlich zu erfüllen.
Welche Organe hat ein Kreis in Nordrhein-Westfalen?
Die zentralen Organe sind der Kreistag (die Volksvertretung), der Kreisausschuss und der Landrat (als Leiter der Verwaltung und Vorsitzender des Kreistages).
Was sind freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben der Kreise?
Dies sind Aufgaben, die über die Kapazitäten einzelner Gemeinden hinausgehen (übergemeindlich), einen Ausgleich schaffen oder ergänzende Leistungen für die Bürger erbringen.
Wie wird der Kreistag gebildet?
Der Kreistag geht aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervor und repräsentiert das Volk auf Kreisebene.
Warum unterscheidet sich das Kommunalrecht zwischen den Bundesländern?
Gemäß Grundgesetz (Art. 70 ff.) liegt die ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeit für das Kommunalrecht bei den Ländern, was zu einer föderalen Vielfalt führt.
Was ist die Funktion des Landrats?
Der Landrat ist sowohl für die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Kreistags zuständig als auch der gesetzliche Vertreter des Kreises in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.
- Quote paper
- Bastian Müller (Author), 2003, Organisation der kommunalen Selbstverwaltung in NRW, am Beispiel der Kreise, unter besonderer Berücksichtigung der Funktion und Rechtsstellung seiner Organe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11370