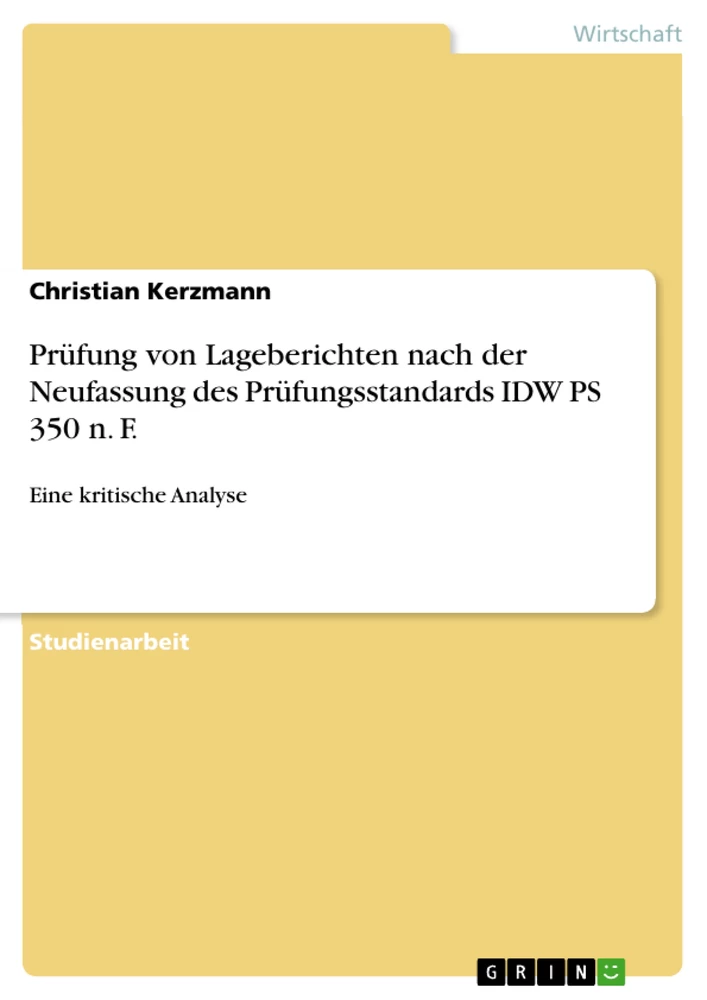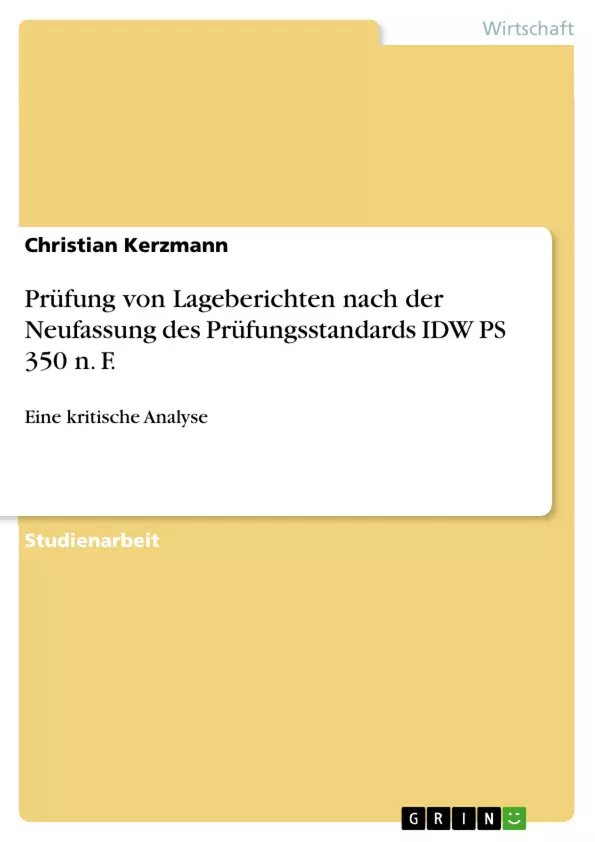Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Fragestellung, ob die aktualisierte Version des Prüfungsstandards IDW PS 350 n F die Qualität des Lageberichts verbessert und die Relevanz für wirtschaftliche Entscheidungen der Adressaten erhöht.
In Kapitel 2 wird der Lagebericht zunächst als eigenes Instrument der Rechnungslegung mit seinen wesentlichen Charakteristika und Berichtsinhalten dargestellt. Daran anschließend werden die gesetzlichen Prüfungsvorschriften nach HGB, IDW PS 350 n F sowie DRS 20 erläutert, die den Grundlagenteil der schriftlichen Ausarbeitung abrunden. Das folgende Kapitel 3 bildet den Hauptteil der Arbeit und beschäftigt sich in mehreren Unterkapiteln mit der Fragestellung, welche Bedeutung der aktualisierte Prüfungsstandard für die Lageberichterstattung und deren Prüfung hat. Konkret geht es um die Auswirkungen der wesentlichen Neuerungen auf die Relevanz und Qualität des Lageberichts. In diesem Zusammenhang wird ‚Qualität‘ als Maß der Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften definiert und inkludiert klare Nachvollziehbarkeit von geprüften und nicht geprüften Angaben. Dahingegen steht ‚Relevanz‘ für die tatsächliche Zugrundelegung der Lageberichtsinformationen für wirtschaftliche Entscheidungen der Adressaten. Mit einem Fazit, welches das Endergebnis der Analyse reflektiert und einen Einblick in die zukünftige Entwicklung ermöglicht, wird diese wissenschaftliche Arbeit abgeschlossen.
„Ein Fehler bzw. eine falsche Darstellung ist immer dann wesentlich, wenn sie die wirtschaftliche Entscheidung des externen Rechnungslegungsadressaten beeinflussen kann.“ Dieses Zitat entstammt der Wirtschaftszeitschrift ‚Der Betrieb‘ und spiegelt die Bedeutsamkeit von schwerwiegenden Fehlinformationen im (Konzern-)Lagebericht wider. Um wirtschaftliche Entscheidungen der Adressaten aufgrund falscher Datengrundlage zu vermeiden, bildet sich der Abschlussprüfer im Rahmen der Prüfung des Lageberichts ein Urteil darüber, ob die Berichterstattung unter Wesentlichkeitsgesichtspunkten mit den zutreffenden Rechnungslegungsnormen übereinstimmt. Die Neufassung des Prüfungsstandards IDW PS 350 n. F. wurde am 12. Dezember 2017 final verabschiedet und war erstmals für Berichtszeiträume, die am oder nach dem 15. Dezember 2018 begonnen, anzuwenden. Eine Ausnahme stellen lediglich Rumpfgeschäftsjahre dar, die vor dem 31. Dezember 2019 endeten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen der Lageberichterstattung
- Berichtsinhalte des Lageberichts
- Gesetzliche Vorschriften zur Prüfung des Lageberichts
- Kritische Analyse der Lageberichtsprüfung
- Prüfungsplanung
- Prüfungsdurchführung und -berichterstattung
- Lageberichtstypische und lageberichtsfremde Angaben
- Prüfbare und nicht prüfbare Angaben
- Nichtfinanzielle Angaben
- Zusammenfassende Würdigung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit der Prüfung von Lageberichten nach IDW PS 350 n. F. und analysiert kritisch die Auswirkungen der aktualisierten Fassung des Prüfungsstandards auf die Qualität der Lageberichterstattung und deren Relevanz für wirtschaftliche Entscheidungen der Adressaten.
- Wesentliche Inhalte und Charakteristika des Lageberichts
- Gesetzliche Vorschriften zur Prüfung des Lageberichts nach HGB, IDW PS 350 n. F. und DRS 20
- Bedeutung der aktualisierten Fassung des Prüfungsstandards für die Lageberichterstattung
- Auswirkungen der Neuerungen auf die Relevanz und Qualität der Lageberichterstattung
- Bewertung der Relevanz des Lageberichts für wirtschaftliche Entscheidungen der Adressaten
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 führt in die Grundlagen der Lageberichterstattung ein und erläutert die wesentlichen Berichtsinhalte sowie die gesetzlichen Prüfungsvorschriften. Im Fokus stehen dabei die Vorschriften nach HGB, IDW PS 350 n. F. und DRS 20.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der kritischen Analyse der Lageberichtsprüfung. Es werden die Planung und Durchführung der Prüfung sowie die Berichterstattung des Abschlussprüfers im Detail betrachtet. Dabei stehen die Auswirkungen der Neuerungen des IDW PS 350 n. F. auf die Relevanz und Qualität der Lageberichterstattung im Vordergrund.
Schlüsselwörter
Lagebericht, IDW PS 350 n. F., Prüfungsstandard, Lageberichtsprüfung, Abschlussprüfer, Relevanz, Qualität, wirtschaftliche Entscheidungen, Adressaten, HGB, DRS 20, nichtfinanzielle Angaben, wesentliche Angaben, Prüfungsplanung, Prüfungsdurchführung, Berichterstattung.
Häufig gestellte Fragen
Was regelt der Prüfungsstandard IDW PS 350 n. F.?
Er regelt die Anforderungen an die Prüfung des Lageberichts durch den Abschlussprüfer, um sicherzustellen, dass dieser keine wesentlichen Fehlinformationen enthält.
Verbessert der neue Standard die Qualität des Lageberichts?
Die Arbeit analysiert, ob durch präzisere Vorschriften die Nachvollziehbarkeit und Gesetzmäßigkeit der Berichterstattung erhöht werden.
Was sind „nichtfinanzielle Angaben“ im Lagebericht?
Dies sind Informationen über Umweltbelange, Arbeitnehmerfragen oder soziale Aspekte, die zunehmend Bedeutung für die Bewertung eines Unternehmens haben.
Wann ist eine falsche Darstellung im Lagebericht „wesentlich“?
Ein Fehler ist wesentlich, wenn er geeignet ist, die wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten (z.B. Investoren) zu beeinflussen.
Welche Rolle spielt der DRS 20?
Der Deutsche Rechnungslegungs Standard Nr. 20 (DRS 20) konkretisiert die inhaltlichen Anforderungen an die Konzernlageberichterstattung.
- Quote paper
- Christian Kerzmann (Author), 2021, Prüfung von Lageberichten nach der Neufassung des Prüfungsstandards IDW PS 350 n. F., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1137808