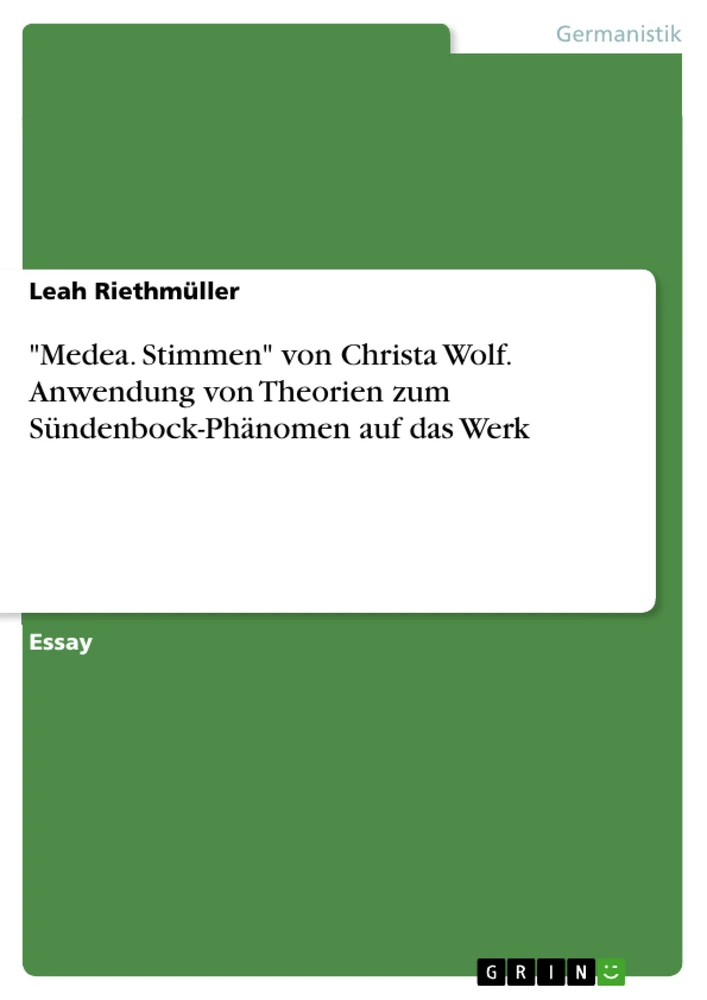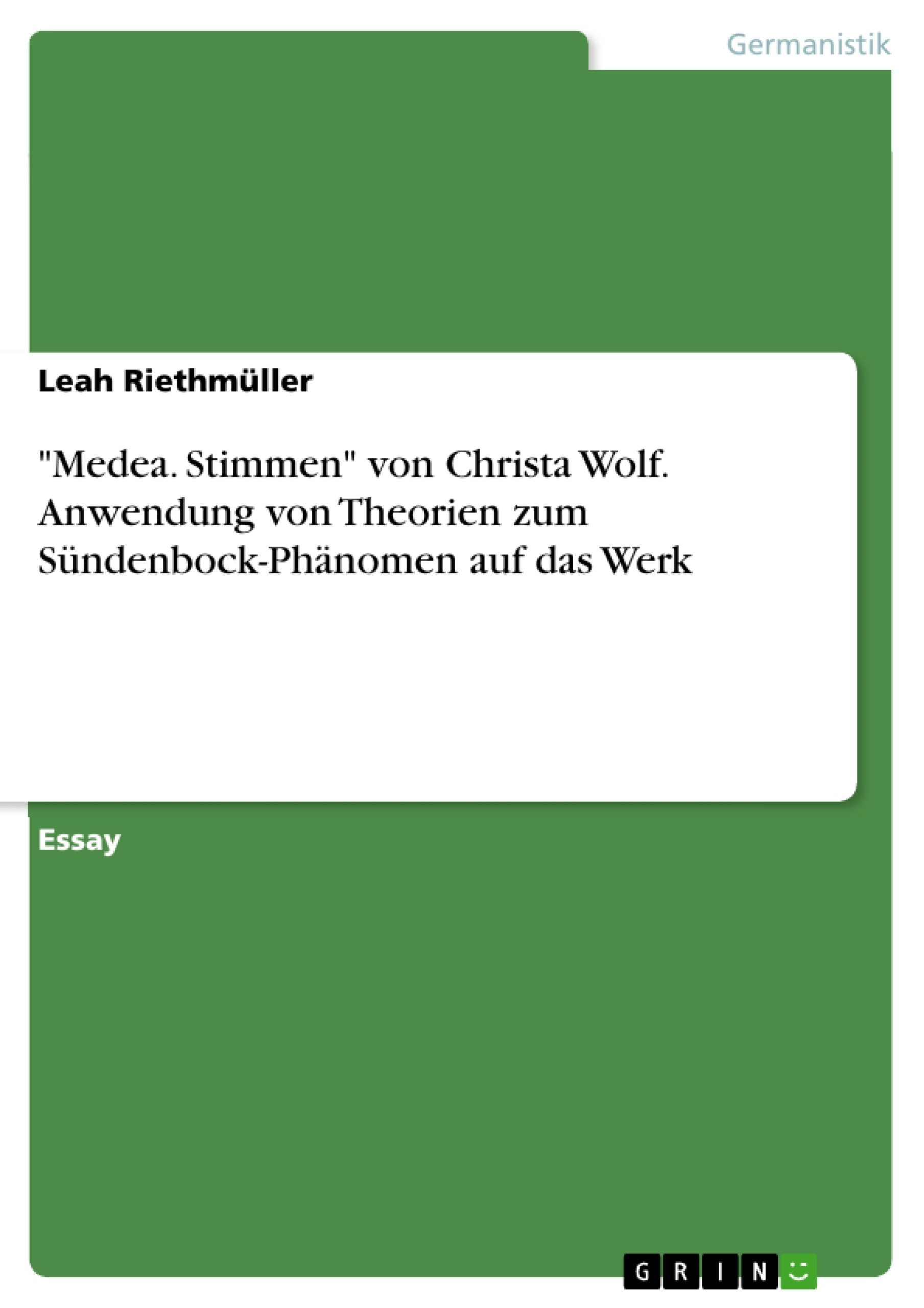In der vorliegenden Arbeit soll der Fokus auf die Frage gerichtet werden, wie eine fortschrittliche, hilfsbereite, unschuldige und an den äußeren Ereignissen im Grunde unbeteiligte Figur in die Rolle des Sündenbocks gerät. Hierzu sollen im Folgenden zunächst Hintergrundinformationen zum Roman und dessen Autorin gegeben werden, bevor der Begriff des Sündenbocks näher definiert und verschiedene Theorien zum Sündenbock-Phänomen ausgeführt und auf den Roman angewandt werden.
In Zeiten gesellschaftlichen Umbruchs und krisenhafter Zustände, wenn Angst und Unsicherheit zu einem Verlust von Normalität und Kontrolle führen, sind Menschen geneigt, Personen bzw. Personengruppen für ihre Situation verantwortlich zu machen, diese zum Sündenbock zu erklären. Ähnliches widerfährt der Protagonistin in Christa Wolfs Roman "Medea. Stimmen.". Die kolchische Königstochter Medea lebt nach der Flucht mit Jason, dem Schiffsführer der „Argo", in Korinth. Während Jason sich nach und nach mehr am Königshof einfindet, scheint die moderne und selbstbewusste Medea immer mehr die Ablehnung und den Hass der Korinther auf sich zu ziehen. Ausgelöst durch die immer schlechter werdenden Umstände in Korinth wird Medea zum Sündenbock für alle negativen Ereignisse. So kommt es, dass sie schließlich verurteilt und aus der Stadt gejagt wird. Als Medea einige Jahre später erfährt, dass sie nicht nur für jegliche Naturereignisse und die Pest, sondern auch für den von der Bevölkerung begangenen Mord an ihren Kindern verantwortlich gemacht wird, verflucht sie die Stadt und alle verräterischen Korinther.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- THEORETISCHE FUNDIERUNG
- AUTORIN
- ZEITGESCHICHTLICHER HINTERGRUND:
- MYTHOS
- THEORIEN ZUM SÜNDENBOCK-PHÄNOMEN.
- ANWENDUNG DER SÜNDENBOCK-THEORIEN AUF ,,MEDEA. STIMMEN"
- SÜNDENBOCKTHEORIE NACH ROTHSCHILD ET AL.
- SÜNDENBOCKTHEORIE NACH ZICK (ET AL.).
- SÜNDENBOCKTHEORIE NACH ARONSON.
- SCHLUSS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Figur der Medea im Roman „Medea. Stimmen“ von Christa Wolf und analysiert, wie die Protagonistin zur Sündenbockfigur wird. Dabei werden verschiedene Theorien zum Sündenbock-Phänomen herangezogen und auf den Roman angewandt.
- Analyse des Sündenbock-Phänomens in Christa Wolfs „Medea. Stimmen“
- Anwendung von Theorien zum Sündenbock-Phänomen
- Untersuchung der Rolle von Angst und Unsicherheit in Krisenzeiten
- Bedeutung des zeitgeschichtlichen Hintergrunds des Romans
- Analyse des Medea-Mythos in der Moderne
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext des Romans „Medea. Stimmen“ dar und beleuchtet den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Umbrüchen und der Entstehung von Sündenböcken. Es wird auf die Rolle der Protagonistin Medea und die Herausforderungen, die sie in der Gesellschaft erfährt, eingegangen.
- Theoretische Fundierung: In diesem Kapitel werden die Autorin Christa Wolf, der zeitgeschichtliche Hintergrund des Romans sowie der Medea-Mythos vorgestellt. Es werden verschiedene Theorien zum Sündenbock-Phänomen erläutert, die im weiteren Verlauf der Arbeit auf „Medea. Stimmen“ angewandt werden.
- Anwendung der Sündenbock-Theorien auf ,,Medea. Stimmen": Das Kapitel analysiert die Anwendung verschiedener Theorien zum Sündenbock-Phänomen auf den Roman von Christa Wolf. Es beleuchtet die verschiedenen Perspektiven und Interpretationen, die sich aus den Theorien ergeben, und untersucht, wie die Protagonistin Medea als Sündenbock für die Probleme und Ängste der Gesellschaft dargestellt wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Sündenbock-Phänomen, Christa Wolf, „Medea. Stimmen“, Mythos, Zeitgeschichte, Gesellschaftlicher Umbruch, Angst und Unsicherheit, politischer und autobiographischer Roman, feministische Literatur, Flüchtlingsroman.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Christa Wolfs Roman „Medea. Stimmen“?
Der Roman deutet den antiken Medea-Mythos neu und zeigt Medea als eine starke, unschuldige Frau, die in Korinth zum Sündenbock für gesellschaftliche Krisen gemacht wird.
Wie wird Medea zum Sündenbock?
In Zeiten von Pest und politischer Instabilität projizieren die Korinther ihre Ängste auf die Fremde aus Kolchis, um ein Ventil für ihre Unsicherheit zu finden.
Welche Sündenbock-Theorien werden in der Arbeit angewandt?
Die Arbeit nutzt psychologische und soziologische Ansätze von Rothschild, Zick und Aronson, um die Mechanismen der Ausgrenzung zu erklären.
Welchen zeitgeschichtlichen Hintergrund hat der Roman?
Er entstand in der Zeit nach der deutschen Wiedervereinigung und spiegelt Erfahrungen von gesellschaftlichem Umbruch, Fremdenhass und politischer Ausgrenzung wider.
Was unterscheidet Wolfs Medea von der klassischen Darstellung (z.B. Euripides)?
Bei Christa Wolf ist Medea keine Kindsmörderin; die Morde werden ihr von der korinthischen Gesellschaft angehängt, um sie endgültig zu vernichten.
- Quote paper
- Leah Riethmüller (Author), 2021, "Medea. Stimmen" von Christa Wolf. Anwendung von Theorien zum Sündenbock-Phänomen auf das Werk, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1138037