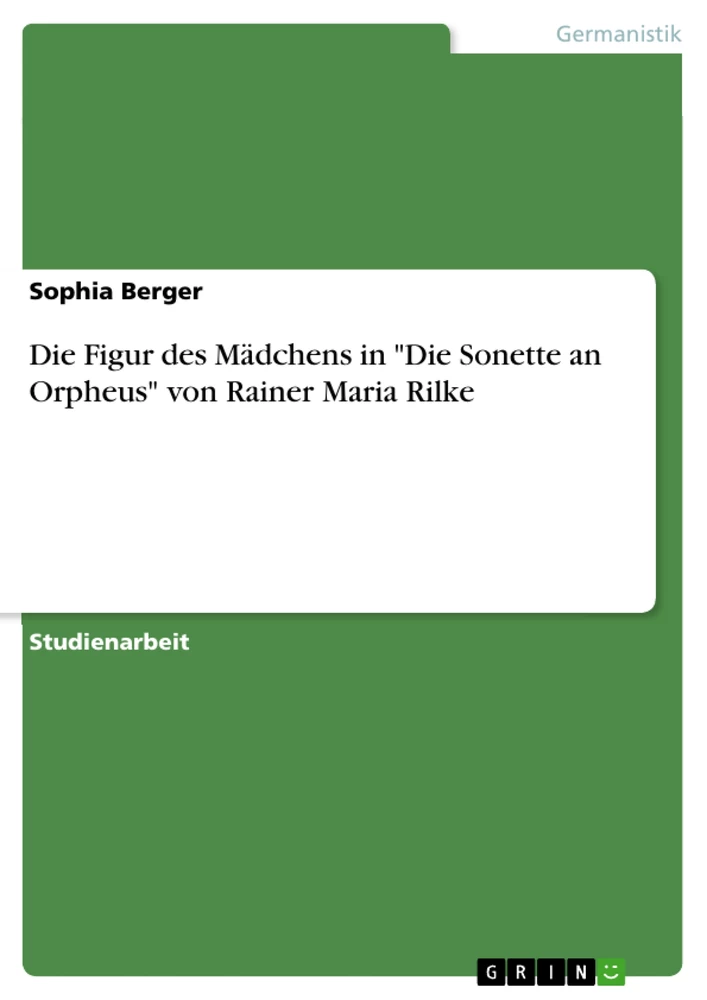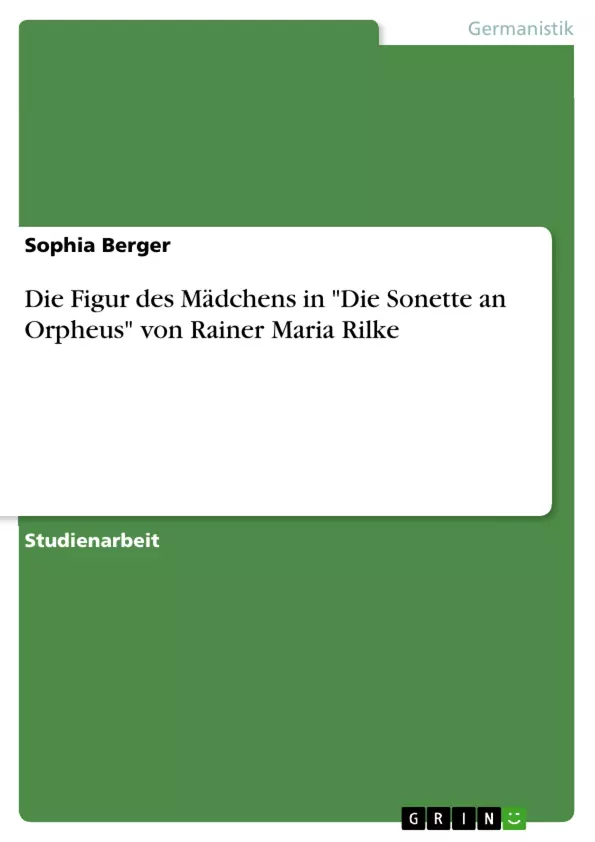Welchen Zusammenhang bilden Mädchen und der dichterische Schaffensprozess? Diese Frage möchte die vorliegende Arbeit beantworten.
In einer kurzen Einführung in die Mädchensymbolik der Literatur der Moderne und der deutschen Romantik sollen etwaige Interpretationsmöglichkeiten dieser Figur beleuchtet werden, um einen kleinen Überblick über die Bedeutungstradition der Mädchenfigur zu bekommen und diese bei der Untersuchung anwenden zu können.
Im Anschluss daran befasst sich der Hauptteil der Arbeit mit der Frage, welche Rolle das Mädchen in den Sonetten an Orpheus spielt und welches Erkenntnispotenzial sich aus der Figur ableiten lässt. Diese Untersuchung erfolgt in drei Teilen.
Anhand des Sonetts I.2, in welchem konkret von einer Mädchenfigur geschrieben wird, erfolgt eine eingehende Analyse dieser Figur, ihrer Rolle als Grenzgängerin und der Komplexität des Musenbegriffs. Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist es, Aufschluss zu geben über den "reinen Bezug". Dies erfolgt insbesondere anhand einer Untersuchung der Blumen in den ordnenden Händen der Mädchen im siebten Sonett des zweiten Teils.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedeutungstradition der Mädchenfigur in der Literatur
- Erkenntnispotential der Mädchenfigur in Die Sonette an Orpheus
- Figur des Mädchens in Sonett I.2
- Die Komplexität der Muse in Sonett I.2
- Das Mädchen als Grenzgängerin in Sonett 1.2
- Passivität der Mädchenfigur in Sonett II.7 und Sonett I.2
- Figur des Mädchens in Sonett I.2
- Zur Darstellbarkeit von Inspiration durch die Mädchenfigur in Die Sonette an Orpheus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Darstellung von Weiblichkeit in Rainer Maria Rilkes „Die Sonette an Orpheus“ mit besonderem Fokus auf die Mädchenfigur. Ziel ist es, das Erkenntnispotential dieser Figur aufzudecken und ihre Rolle im dichterischen Schaffensprozess zu beleuchten. Dabei wird die Bedeutungstradition der Mädchenfigur in der Literatur der Romantik und Moderne herangezogen, um mögliche Interpretationsmöglichkeiten zu erschließen.
- Die Komplexität der Mädchenfigur als Muse und Grenzgängerin
- Die Darstellung von Inspiration durch die Mädchenfigur
- Die Rolle der Femininität im dichterischen Schaffensprozess
- Die Bedeutung von Symbolik und Sprache in Rilkes Sonetten
- Die Verbindung zwischen Mädchenfigur, Inspiration und orphischem Gesang
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Fragestellung nach dem Erkenntnispotential der Mädchenfigur in „Die Sonette an Orpheus“ vor. Sie erläutert den wissenschaftlichen Hintergrund und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Kapitel 2 untersucht die Bedeutungstradition der Mädchenfigur in der Literatur der Romantik und Moderne. Es werden die Ansichten von Philosophen wie Friedrich Schlegel und Johann Gottfried Herder sowie die Interpretationen von Literaturwissenschaftlern wie Martha B. Helfer und Christine A. Knoop beleuchtet.
Kapitel 3 konzentriert sich auf die Analyse der Mädchenfigur in „Die Sonette an Orpheus“, wobei insbesondere die Sonette I.2 und II.7 im Mittelpunkt stehen. Es werden die Komplexität der Muse in Sonett I.2, die Rolle des Mädchens als Grenzgängerin sowie die Frage nach der Passivität der Figur in beiden Sonetten behandelt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Hausarbeit sind: Mädchenfigur, Weiblichkeit, Muse, Inspiration, Grenzgängerin, „Die Sonette an Orpheus“, Rainer Maria Rilke, Romantik, Moderne, dichterisches Schaffen, Symbolismus, feministische Forschung, hermeneutische Tradition.
- Quote paper
- Sophia Berger (Author), 2019, Die Figur des Mädchens in "Die Sonette an Orpheus" von Rainer Maria Rilke, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1138282