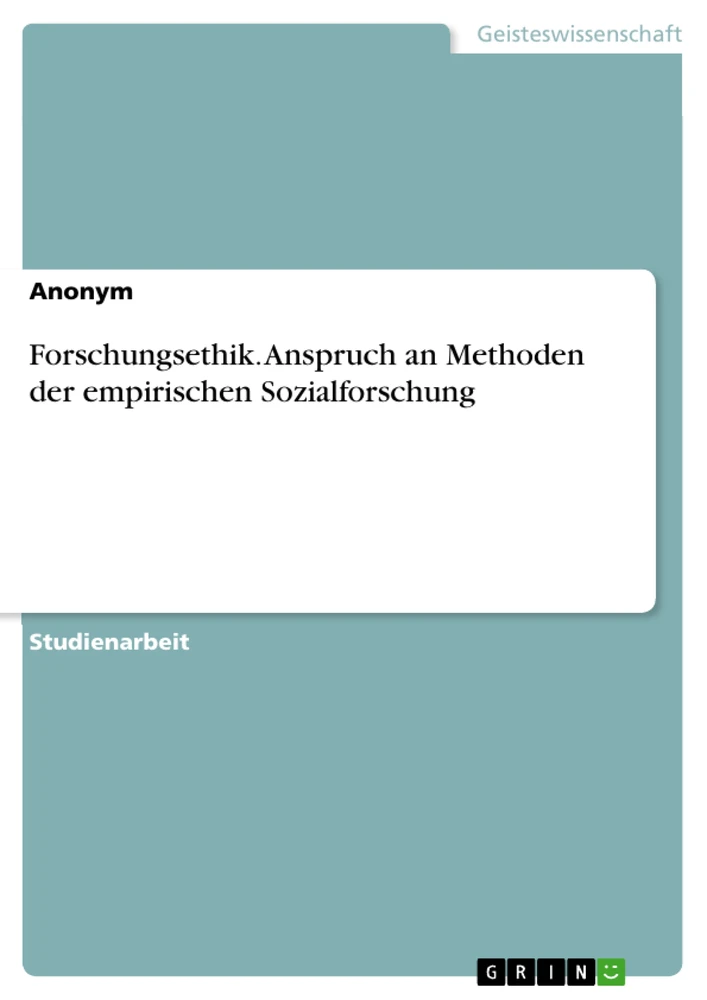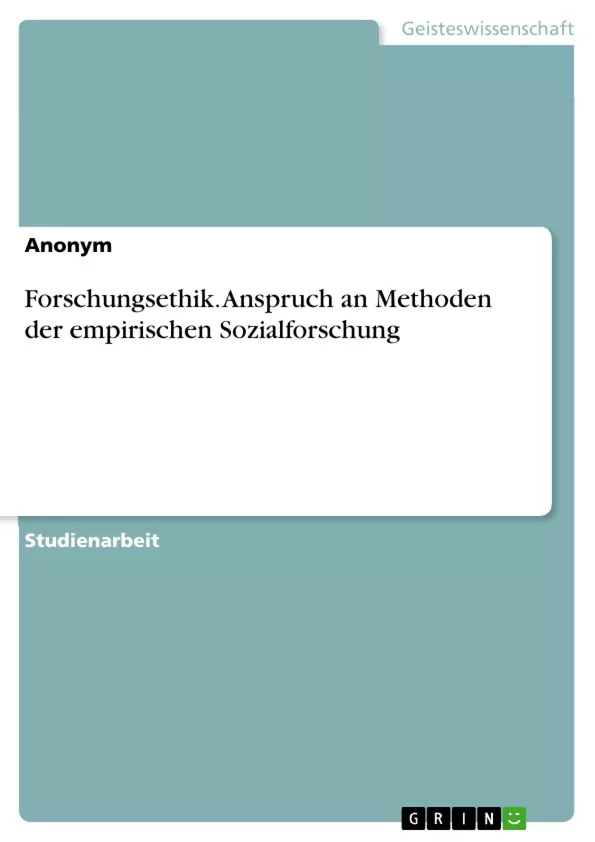Forschungsethik ist ein unausweichlicher Bestandteil jener Forschungsfelder, welche Menschen zur Gewinnung von Daten und wissenschaftlicher Erkenntnisse benötigt. Dies trifft auch auf Felder über die der medizinischen Forschung hinaus zu, wie zum Beispiel in denen der Sozial- und Gesundheitswissenschaften, welche sich unter anderem an qualitativen Methoden der empirischen Sozialforschung bedienen, um solche Erkenntnisse zu erlangen. Aufschluss darüber soll diese Arbeit geben und über die Notwendigkeit oder sogar Verpflichtung gegenüber sich selbst und seinen Probanden geben, sich ethisch korrekt zu verhalten.
So befasst sich laut Schnell & Heinritz die Forschungsethik mit der Frage, welche ethisch relevanten Einflüsse die Intervention eines Forschers den Menschen zumuten könne, mit oder an denen der Forscher forscht. Sie befasse sich zudem mit den Maßnahmen, die zum Schutz der an einer Forschung teilnehmenden Personen unternommen werden solle, sofern dieses als Notwendigkeit erscheine.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kurzer Exkurs in die Ethik
- 3. Ethik in der empirischen Sozialforschung
- 3.1 Selbstreflexionen des Forschers
- 3.2 Forschungsethische Prinzipien
- 3.3 Das Dilemma der verdeckten Beobachtung
- 4. Praktisches Beispiel – Das Bremer Afrika Projekt
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Forschungsethik in der empirischen Sozialforschung, insbesondere im Kontext der Gesundheitswissenschaften. Sie beleuchtet die ethischen Herausforderungen, denen Forscher gegenüberstehen, und diskutiert die Notwendigkeit ethisch korrekten Verhaltens gegenüber den Forschungsteilnehmern. Die Arbeit illustriert die Anwendung ethischer Prinzipien anhand eines praktischen Beispiels.
- Ethische Prinzipien in der empirischen Sozialforschung
- Verdeckte Beobachtung und ethische Dilemmata
- Anwendung ethischer Prinzipien in der Forschungspraxis
- Rechtliche Rahmenbedingungen und ethische Verantwortung
- Selbstreflexion des Forschers
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Forschungsethik ein und betont deren zentrale Rolle in Forschungsfeldern, die Menschen als Datengrundlage benötigen. Sie hebt die Bedeutung ethisch korrekten Verhaltens gegenüber den Probanden hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit, der einen Exkurs in die Ethik, die Darstellung forschungsethischer Prinzipien und ein Praxisbeispiel umfasst. Die Einleitung verweist auf die Notwendigkeit ethischer Reflexion in der empirischen Sozialforschung, insbesondere bei qualitativen Methoden.
2. Kurzer Exkurs in die Ethik: Dieser Abschnitt bietet einen knappen Überblick über den Begriff der Ethik, seine historischen Wurzeln und zentrale Aspekte. Er veranschaulicht die Entwicklung ethischer Normen anhand von religiösen und philosophischen Beispielen, wie den Zehn Geboten und den Lehren Buddhas, und zeigt die Parallelen zwischen diesen und modernen Rechtsgrundlagen wie dem Grundgesetz. Die Kapitel hebt die Bedeutung der Achtung des menschlichen Lebens und der Einhaltung moralischer Prinzipien hervor.
3. Ethik in der empirischen Sozialforschung: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den ethischen Herausforderungen der empirischen Sozialforschung. Es diskutiert die Verantwortung des Forschers gegenüber den Beteiligten und den gewonnenen Daten. Der Abschnitt beleuchtet die Problematik der verdeckten Beobachtung und non-reaktiver Verfahren im Hinblick auf die Einhaltung ethischer Prinzipien. Es wird betont, dass in der Forschung alltagsweltliche Regeln und ethische Maxime nicht uneingeschränkt gelten, da Informations- und Ressourcenungleichgewichte zwischen Forschern und Befragten bestehen.
Schlüsselwörter
Forschungsethik, Empirische Sozialforschung, Gesundheitswissenschaften, Ethische Prinzipien, Verdeckte Beobachtung, Selbstreflexion, Grundgesetz, Menschenrechte, Verantwortung.
Häufig gestellte Fragen zu: Forschungsethik in der Empirischen Sozialforschung
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über Forschungsethik in der empirischen Sozialforschung, insbesondere im Kontext der Gesundheitswissenschaften. Sie beinhaltet eine Einleitung, einen Exkurs in die Ethik, eine detaillierte Auseinandersetzung mit ethischen Prinzipien in der Forschung, ein Praxisbeispiel (das Bremer Afrika Projekt) und ein Fazit. Der Fokus liegt auf den ethischen Herausforderungen für Forschende und der Notwendigkeit ethisch korrekten Verhaltens gegenüber den Forschungsteilnehmern.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie ethische Prinzipien in der empirischen Sozialforschung, die Problematik der verdeckten Beobachtung und daraus resultierende ethische Dilemmata, die Anwendung ethischer Prinzipien in der Forschungspraxis, die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen und die ethische Verantwortung der Forschenden. Ein wichtiger Aspekt ist die Selbstreflexion des Forschers und die Berücksichtigung der Informations- und Ressourcenungleichgewichte zwischen Forschern und Befragten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Kurzer Exkurs in die Ethik, 3. Ethik in der empirischen Sozialforschung (mit Unterkapiteln zu Selbstreflexion des Forschers, forschungsethischen Prinzipien und dem Dilemma der verdeckten Beobachtung), 4. Praktisches Beispiel – Das Bremer Afrika Projekt, und 5. Fazit.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Bedeutung von Forschungsethik in der empirischen Sozialforschung aufzuzeigen und die ethischen Herausforderungen zu beleuchten, denen Forschende gegenüberstehen. Sie soll das Verständnis für ethisch korrektes Verhalten gegenüber Forschungsteilnehmern fördern und die Anwendung ethischer Prinzipien in der Forschungspraxis veranschaulichen.
Welches Praxisbeispiel wird verwendet?
Als Praxisbeispiel dient das "Bremer Afrika Projekt". Details zu diesem Projekt werden im entsprechenden Kapitel vorgestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Forschungsethik, Empirische Sozialforschung, Gesundheitswissenschaften, Ethische Prinzipien, Verdeckte Beobachtung, Selbstreflexion, Grundgesetz, Menschenrechte, Verantwortung.
Wie wird die Ethik in der empirischen Sozialforschung behandelt?
Die Arbeit behandelt die Ethik in der empirischen Sozialforschung umfassend, indem sie die Verantwortung des Forschers gegenüber den Beteiligten und den gewonnenen Daten diskutiert. Besonderes Augenmerk liegt auf der Problematik der verdeckten Beobachtung und der Einhaltung ethischer Prinzipien auch bei non-reaktiven Verfahren. Die Arbeit betont, dass alltägliche Regeln und ethische Maxime in der Forschung nicht uneingeschränkt gelten, da Informations- und Ressourcenungleichgewichte zwischen Forschern und Befragten bestehen.
Welche Rolle spielt die Selbstreflexion des Forschers?
Die Selbstreflexion des Forschers wird als ein wichtiger Aspekt der Forschungsethik hervorgehoben. Die Arbeit betont die Notwendigkeit, die eigenen Vorurteile, Werte und Interessen zu reflektieren und deren Einfluss auf die Forschung zu berücksichtigen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2009, Forschungsethik. Anspruch an Methoden der empirischen Sozialforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1138521