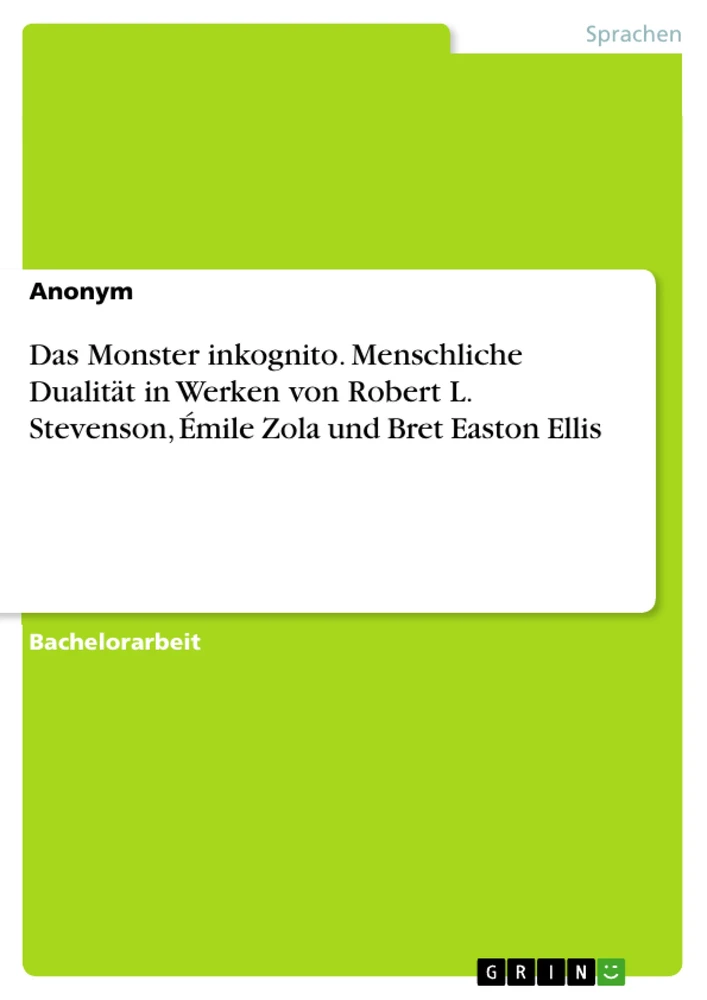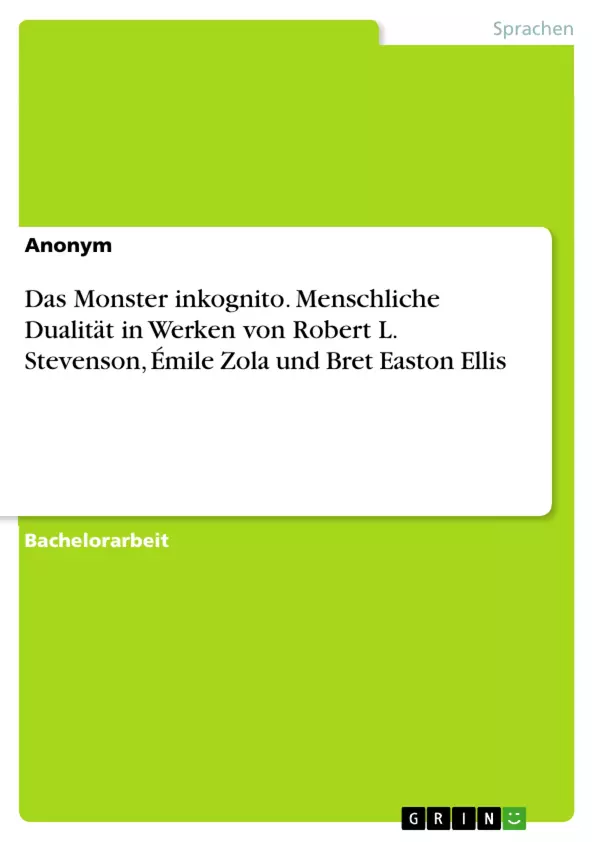Die Arbeit setzt Robert L. Stevensons "Dr Jekyll and Mr Hyde", Émile Zolas "La Bête humaine" und Bret Easton Ellis' "American Psycho" in Verbindung. Ein besonderer Fokus liegt auf den dualen Strukturen, die alle drei Werke charakterisieren – so etwa die Dualität zwischen Gut und Böse, Gesellschaft und Individuum, wie auch Mensch und Tier. Zentral für diese Arbeit ist ebenso Michel Foucaults Konzept des "Sittenmonsters", welches die historische Entwicklung vom sichtbaren körperlichen Monster zum unsichtbaren psychologischen Monster beschreibt.
Der althergebrachte Dualismus zwischen Gut und Böse, mit welchem sich die Menschheit seit vielen Jahrhunderten intensiv auseinandersetzt, wird in „The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde“ in einer einzigen Figur zusammengefasst und entfacht so den Diskurs über die Dualität der menschlichen Psyche. Die Figur des Dr. Jekyll ist angesehener Arzt und gewissensloser Krimineller, Mensch und Monster zugleich; diese Umstände machen sie zu einem Grenzgänger, dessen eindeutige Zuordnung zwangsweise ins Leere läuft. Womöglich ist gerade diese Transgression der Grund, warum das sprichwörtliche Erbe von Stevensons Schauernovelle schon wenige Jahre nach ihrer Veröffentlichung Autoren aus aller Welt dazu inspirierte, sich umfangreichen Neu- und Weiterbearbeitungen zu widmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die grundlegende Ambiguität des Monsters: Historischer Umriss der Entwicklung von sichtbarer zu unsichtbarer Monstrosität
- Exkurs: Das Konzept des „Sittenmonsters“ nach Michel Foucault
- Das Bild der Anderen: Gesellschaftliche Wahrnehmung
- Henry Jekyll und Edward Hyde - unvereinbare Gegensätze(?)
- Jacques Lantier: Ein gefährlicher Trugschluss
- Das Bild des Anderen: Gespaltene Subjekterfahrungen
- Das Monster als Mittel der Befreiung
- Patrick Bateman: Anonymität der Oberfläche
- Das Monster als Bedrohung des Subjekts
- Das Monster als Ersatz für das Subjekt
- Zwischen Mensch und Tier: Spuren des Animalischen bei Stevenson, Zola und Ellis
- Mordlust als animalischer Trieb
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die menschliche Dualität anhand ausgewählter Werke von Robert L. Stevenson, Émile Zola und Bret Easton Ellis. Ziel ist es, die Darstellung des „Monsters“ in diesen Werken zu vergleichen und die Ambivalenz des Begriffs zu beleuchten. Der Fokus liegt auf den Figuren Dr. Jekyll, Jacques Lantier und Patrick Bateman und ihren jeweiligen dualen Strukturen.
- Die Ambivalenz des Begriffs „Monster“ und seine historische Entwicklung.
- Das Verhältnis zwischen äußerer Erscheinung und innerem Selbstbild der Protagonisten.
- Die gesellschaftliche Wahrnehmung des „Anderen“.
- Die Darstellung von gespaltenen Subjekterfahrungen.
- Die Verbindung zwischen Mensch und Tier in den untersuchten Werken.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der menschlichen Dualität ein und begründet die Wahl der untersuchten Werke von Stevenson, Zola und Ellis anhand des Beispiels „Jekyll and Hyde“. Sie skizziert den Vergleich der Figuren Dr. Jekyll, Jacques Lantier und Patrick Bateman und kündigt die zentralen Themen der Arbeit an: die Ambivalenz des Monsters, das Verhältnis von Außenwirkung und Selbstbild sowie die Dualität zwischen Mensch und Tier.
Die grundlegende Ambiguität des Monsters: Historischer Umriss der Entwicklung von sichtbarer zu unsichtbarer Monstrosität: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des Begriffs „Monster“ von seiner ursprünglichen Bedeutung als ungewöhnliche Erscheinung bis hin zur modernen Konnotation als gewalttätiger Verbrecher. Es beleuchtet die historische Verschiebung von der sichtbaren zur unsichtbaren Monstrosität, wobei der wissenschaftliche Fortschritt und Foucaults Konzept des „Sittenmonsters“ im Mittelpunkt stehen. Die Ambivalenz des Begriffs wird hervorgehoben, sowohl in seiner Wahrnehmung durch Kinder als auch durch Erwachsene.
Das Bild der Anderen: Gesellschaftliche Wahrnehmung: Dieses Kapitel analysiert die gesellschaftliche Wahrnehmung der Protagonisten und deren Auswirkungen auf ihr Selbstbild. Es untersucht die unterschiedlichen Reaktionen auf Dr. Jekyll/Mr. Hyde, Jacques Lantier und Patrick Bateman und die Frage, wie die Gesellschaft diese Figuren einordnet und bewertet. Die Auswirkungen der gesellschaftlichen Stigmatisierung werden diskutiert.
Das Monster als Mittel der Befreiung/Das Monster als Bedrohung des Subjekts/Das Monster als Ersatz für das Subjekt: Diese drei Kapitel befassen sich mit den verschiedenen Funktionen des „Monsters“ in den untersuchten Werken. Sie analysieren, wie die Figur des Monsters als Mittel der Befreiung von gesellschaftlichen Normen und Zwängen, als Bedrohung des eigenen Selbst und als Ersatz für das eigentliche Ich fungiert. Die Kapitel beleuchten die komplexen Beziehungen zwischen den Protagonisten und ihren „monströsen“ Alter Egos.
Zwischen Mensch und Tier: Spuren des Animalischen bei Stevenson, Zola und Ellis: Dieses Kapitel untersucht den Aspekt der Animalität in den Romanfiguren und beleuchtet, wie die animalischen Triebe und Instinkte in den Werken dargestellt werden. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Gewalt und Mordlust als animalischer Trieb und dessen Auswirkungen auf die Handlungen und das Selbstverständnis der Protagonisten. Die Kapitel zeigen, wie die Grenzen zwischen Mensch und Tier verschwimmen.
Schlüsselwörter
Menschliche Dualität, Monster, Monstrosität, Robert L. Stevenson, Émile Zola, Bret Easton Ellis, gespaltenes Ich, gesellschaftliche Wahrnehmung, Animalität, Ambivalenz, Selbstbild, Devianz.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: "Die Ambivalenz des Monsters"
Was ist der Gegenstand der Arbeit "Die Ambivalenz des Monsters"?
Die Arbeit untersucht die menschliche Dualität anhand der Romane von Robert L. Stevenson, Émile Zola und Bret Easton Ellis. Im Mittelpunkt steht der Vergleich der Darstellung des „Monsters“ in diesen Werken und die Ambivalenz dieses Begriffs. Der Fokus liegt auf den Figuren Dr. Jekyll, Jacques Lantier und Patrick Bateman und ihren jeweiligen dualen Strukturen.
Welche Werke werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert ausgewählte Werke von Robert L. Stevenson, Émile Zola und Bret Easton Ellis, wobei die Figuren Dr. Jekyll (aus "Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde"), Jacques Lantier (aus Zolas Romanen, vermutlich "Germinal" oder ein ähnliches Werk) und Patrick Bateman (aus "American Psycho") im Zentrum der Betrachtung stehen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Ambivalenz des Begriffs „Monster“ und seine historische Entwicklung, das Verhältnis zwischen äußerer Erscheinung und innerem Selbstbild der Protagonisten, die gesellschaftliche Wahrnehmung des „Anderen“, die Darstellung von gespaltenen Subjekterfahrungen und die Verbindung zwischen Mensch und Tier in den untersuchten Werken. Es wird untersucht, wie das "Monster" als Mittel der Befreiung, als Bedrohung des Subjekts oder als Ersatz für das Subjekt fungieren kann.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, mehrere Hauptkapitel und ein Fazit. Die Kapitel befassen sich mit der historischen Entwicklung des Monsterbegriffs, der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Protagonisten, den verschiedenen Funktionen des Monsters in den Romanen und der Darstellung von Animalität bei den Figuren. Die Arbeit enthält zudem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analyse der drei ausgewählten literarischen Figuren und deren Darstellung des "Monsters". Sie untersucht die Figuren im Kontext ihrer jeweiligen gesellschaftlichen und historischen Bedingungen und beleuchtet die Ambivalenz des Begriffs "Monster" in seiner Entwicklung und Wahrnehmung.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die genauen Schlussfolgerungen der Arbeit sind aus der gegebenen Zusammenfassung nicht vollständig ersichtlich. Es lässt sich jedoch ableiten, dass die Arbeit die komplexe und vielschichtige Natur des "Monsters" in der Literatur beleuchtet und seine Funktion als Spiegel der menschlichen Dualität und der gesellschaftlichen Verhältnisse herausarbeitet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Menschliche Dualität, Monster, Monstrosität, Robert L. Stevenson, Émile Zola, Bret Easton Ellis, gespaltenes Ich, gesellschaftliche Wahrnehmung, Animalität, Ambivalenz, Selbstbild, Devianz.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Das Monster inkognito. Menschliche Dualität in Werken von Robert L. Stevenson, Émile Zola und Bret Easton Ellis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1138583