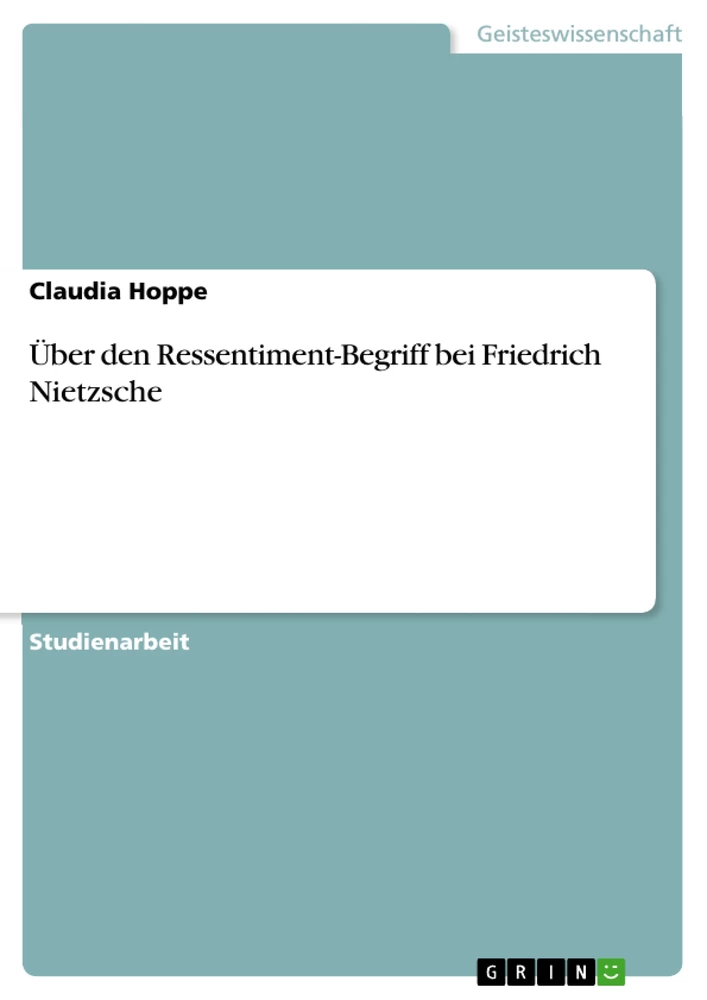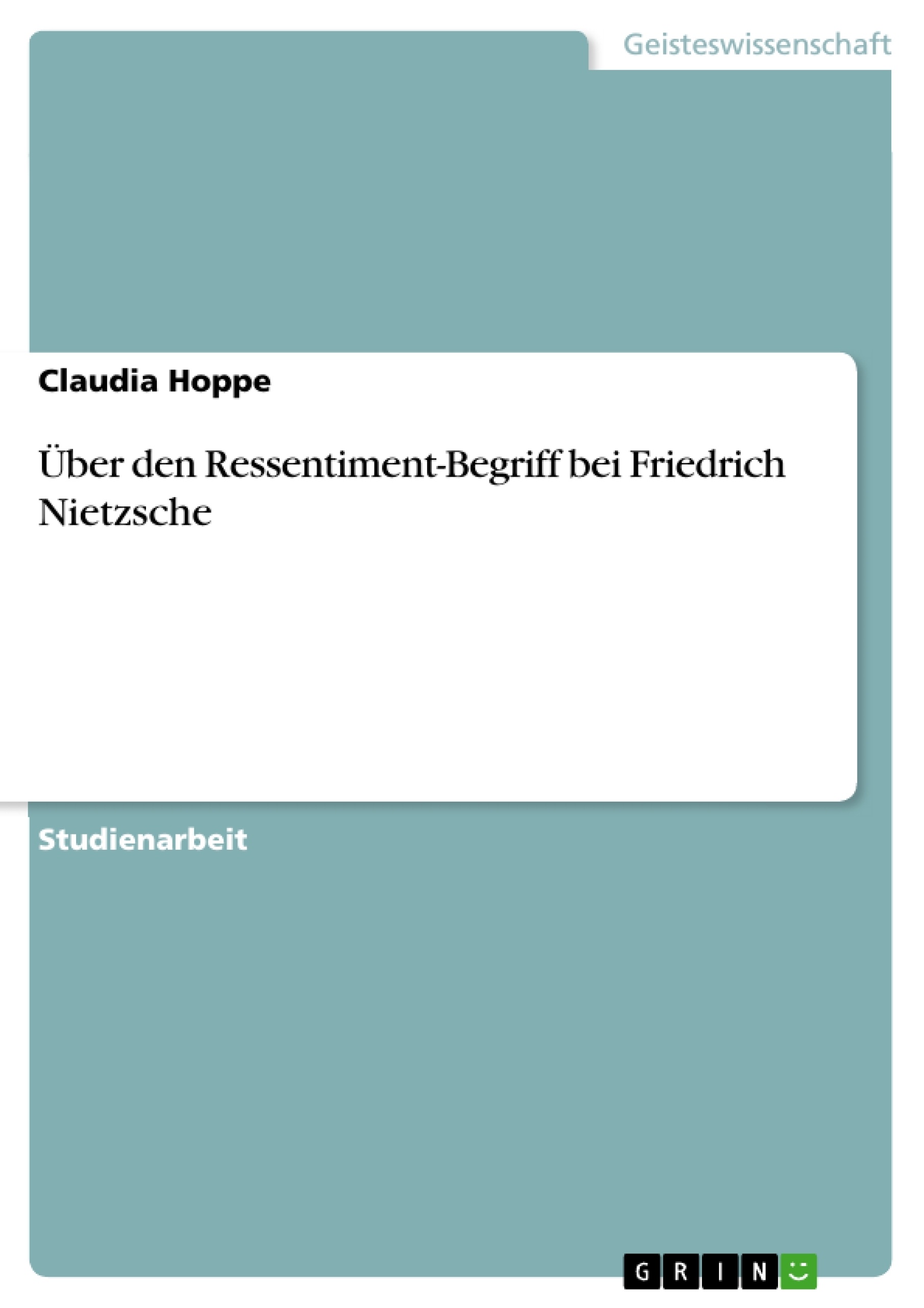Friedrich Nietzsche ist auch als 'Philosoph mit dem Hammer' bekannt. Diese Bezeichnung rührt daher, dass Nietzsche in seiner Philosophie mit christlichen und in unserer Gesellschaft seit Jahrhunderten etablierten Werten bricht und stattdessen für eine neue, 'ressentimentfreie' Moral plädiert. Was aber genau ist 'Ressentiment' und welche Stellung hat der Begriff in Nietzsches Philosophie? Dieser Frage versuche ich in dieser Arbeit auf den Grund zu gehen.
Der Begriff 'Ressentiment' ist einer der zentralsten Begriffe in Nietzsches moralischer Gesamtkonzeption und steht als Synonym für Neid und die boshafte, nachtragende, hinter vorgehaltener Hand geäußerte Missgunst für andere und deren Werke und Taten. Ressentiment beinhaltet nicht die Möglichkeit der schnellen Rache – deren leidenschaftlicher Befürworter Nietzsche ist – sondern meint das kleinliche heimliche Bestreben der Menschen, immer besser sein zu wollen, als andere. Nietzsche selbst ist ein leidenschaftlicher Fürsprecher der Herrenmoral. Er ist der Ansicht, das Juden- und später das Christentum, das für ihn die Wurzel allen Ressentiments ist, haben dafür gesorgt, dass diese ursprüngliche und edle Moral durch die niederträchtige und ressentimentdurchtränkte Sklavenmoral abgelöst wurde. Ich teile diese Meinung nicht unumschränkt, was ich am Ende der Arbeit ausführe und begründe.
- Citar trabajo
- Claudia Hoppe (Autor), 2004, Über den Ressentiment-Begriff bei Friedrich Nietzsche, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113873