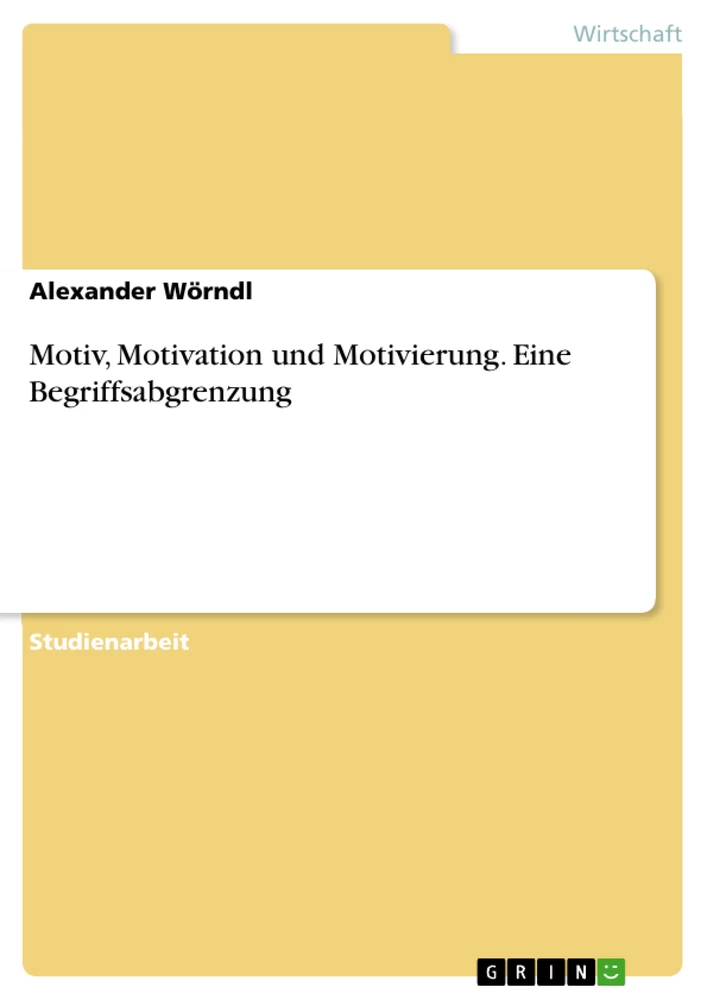Die nachfolgende Arbeit unternimmt den Versuch, die Begriffe "Motiv", "Motivation" und "Motivierung" zu definieren, voneinander abzugrenzen und die Bedeutung im Kontext der Fremd- und Eigenmotivation zu betrachten.
Die Motivationspsychologie befasst sich mit zielgerichtetem Verhalten beim Menschen und analysiert die Ausrichtung, Ausdauer und Intensität beim Zielstreben. Die Forschung differenzierte dabei von Anfang an zwischen Motiven und Motivation. Die Arbeit definiert die Begriffe Motiv, Motivation und Motivierung und grenzt sie voneinander ab. Die Bedeutung wird vor allem im Kontext der Fremd- und Eigenmotivation betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Motiv - Motivation - Motivierung.
- 2.1 Motiv....
- 2.1.1 Zwei Motivsysteme: Unbewusste und bewusste Motive
- 2.2 Motivation
- 2.2.1 Intrinische Motivation
- 2.2.2 Extrinsische Motivation
- 2.3 Motivierung
- 3 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Begriffen Motiv, Motivation und Motivierung, ihrer Definition und Abgrenzung. Das Ziel ist es, die Bedeutung dieser Begriffe im Kontext der Fremd- und Eigenmotivation aufzuzeigen und zu erklären, wie sie im Zusammenhang mit zielgerichtetem Verhalten und dem Streben nach Zielen stehen. Dabei wird die Motivationspsychologie als Grundlage für die Analyse dieser Konzepte herangezogen.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Motiv, Motivation und Motivierung
- Die Rolle der Motivationspsychologie bei der Analyse von zielgerichtetem Verhalten
- Die Bedeutung von Motiven in der Fremd- und Eigenmotivation
- Die Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation
- Die Anwendung der Konzepte im Kontext von Personalmanagement und Führung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung
Die Einleitung präsentiert Statistiken zu Mitarbeitermotivation und stellt die Relevanz des Themas im Kontext von Unternehmenserfolg und Personalmanagement dar. Es werden unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema Motivation von verschiedenen Forschern und Experten beleuchtet, darunter die Kritik an Anreizsystemen durch Alfie Kohn und die Forderung nach der Eliminierung von Demotivierung durch Reinhard K. Sprenger. Die Einleitung führt in die Bedeutung und Historie des Begriffs Motivation ein und zeigt die Herausforderungen bei der Definition auf.
2 Motiv - Motivation - Motivierung
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Differenzierung zwischen Motiven, Motivation und Motivierung. Es erläutert, dass Motive als überdauernde Dispositionen für bestimmte Handlungsziele angesehen werden. Die Theorie von Henry Murray und Mcclelland zur Rolle von Bedürfnissen (needs) und Handlungsgelegenheiten (press) wird vorgestellt, sowie die Bedeutung von Bedürfnissen wie Leistung, Macht und Zugehörigkeit. Der Abschnitt beleuchtet, dass es bis heute keine einheitliche Definition von Motiven gibt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die Begriffe Motiv, Motivation und Motivierung. Sie werden in Bezug auf zielgerichtetes Verhalten, Fremd- und Eigenmotivation, intrinsische und extrinsische Motivation sowie die Rolle von Bedürfnissen und Handlungsgelegenheiten untersucht.
- Arbeit zitieren
- Alexander Wörndl (Autor:in), 2021, Motiv, Motivation und Motivierung. Eine Begriffsabgrenzung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1138884