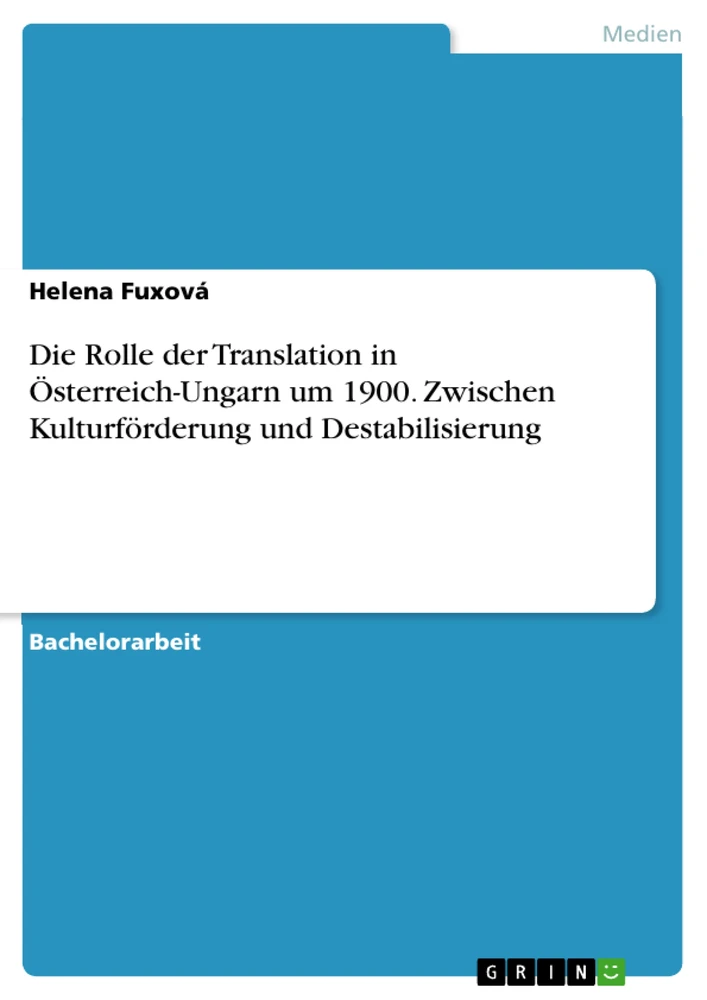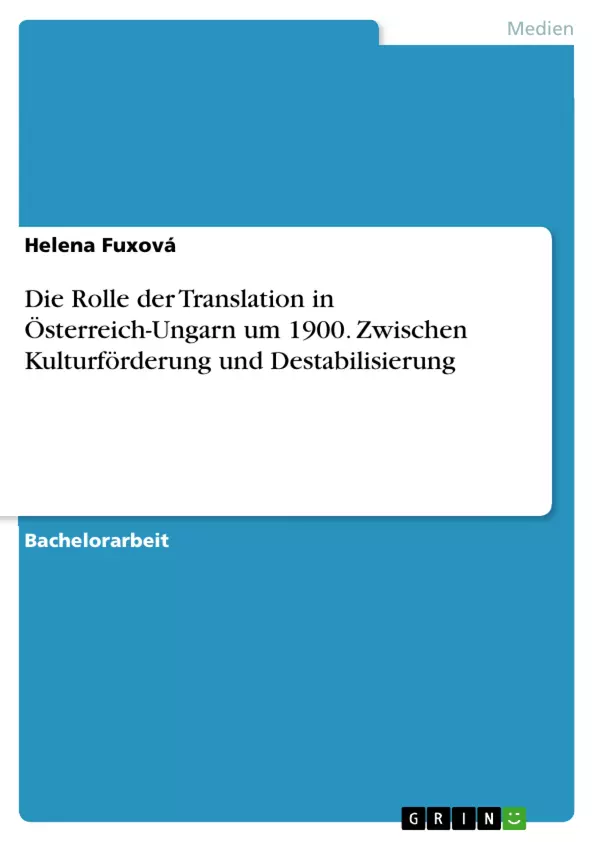In der Arbeit werden die Grundzüge einer Translationspolitik in der Habsburger Monarchie um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert skizziert und in einen geschichts-sozialen Kontext eingeordnet.
Der Fokus dieser Arbeit liegt daher auf der gesetzlichen Lage und den politischen Instrumenten der Monarchie (Kapitel 3), mit denen auf die dynamischen sozial-politischen Entwicklungen der einzelnen Nationen (Kapitel 2) reagiert wurde. Die Betrachtung erfolgt dabei mit Bezug auf die Sprachenfrage, die die Politik der letzten Jahrzehnte der Monarchie maßgeblich mitbestimmte und die somit für die Translationspolitik von Relevanz war. In dieser Arbeit geht es um die Fragen, inwieweit die gesetzlichen Regelungen und der Verwaltungsapparat die sprachlich und ethnisch heterogene kaiserliche und königliche Gesellschaft (k. und k. Gesellschaft) widerspiegelten und inwieweit sie sich auf die ambivalente Rolle der Translation auswirkten.
Die theoretische Arbeit stützt sich auf konkrete Beispiele und Darstellung der gesellschaftlichen Verhältnisse in den Ländern der Böhmischen Krone, um auf diese Weise den Sachverhalten klare Konturen zu geben. Überdies sind diese Gebiete noch aus einem anderen Grund für die Arbeit relevant: Indem die tschechischen Politiker die Sprachenfrage zu ihrem Hauptthema um die Jahrhundertwende machten, wurde das Missverhältnis zwischen den durch die Verfassung garantierten Sprachenrechten und der realen Machtausübung sichtbar. Somit war die Frage nach der Anerkennung der Mehrsprachigkeit und der Multikulturalität in der Monarchie gestellt, die bis zu deren Ende unbeantwortet blieb. Ein Vergleich mit den aktuellen Zugängen zur Mehrsprachigkeit der demokratischen Staaten laut der Gliederung nach Reine Meylaerts (Kapitel 4.2.1) rundet diese Arbeit dann ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Heterogene Zusammensetzung der k. und k. Gesellschaft
- 2.1 Gesellschaftlicher Wandel um 1900
- 2.2 Wien - Schmelztiegel der Nationen
- 2.3 Mehrsprachige Normalität der Monarchiebevölkerung
- 3. Zwei- und Mehrsprachigkeit auf institutioneller Ebene
- 3.1 Die Sprachenfrage
- 3.1.1 Rechtliche Ursachen für den Sprachenstreit
- 3.1.2 Tschechisch und Deutsch im Aushandlungsprozess
- 3.2 Sprache als politisches Instrument in statistischen Erhebungen
- 3.2.1 Verzerrung der Umfrageergebnisse
- 4. Zwitterbeschaffenheit der Translation
- 4.1 Habituelles Übersetzen mit Konstruktcharakter
- 4.1.1 Konstitutive Rolle der Literaturübersetzungen
- 4.2 Instrumentelles Übersetzen als Destabilisierungsmittel
- 4.2.1 Translationsregime nach Meylaerts
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Rolle der Translation in der Habsburgermonarchie um 1900. Sie analysiert die Übersetzungslandschaft in diesem Kontext, die durch die heterogene Zusammensetzung der k. und k. Gesellschaft geprägt war. Dabei wird untersucht, wie die Translation in dieses Machtgefüge eingebettet war und welche Auswirkungen sie auf die sprachlichen und politischen Prozesse hatte.
- Die heterogene Zusammensetzung der k. und k. Gesellschaft und der gesellschaftliche Wandel um 1900.
- Die Sprachenfrage in der Habsburgermonarchie und ihre Auswirkungen auf die Translationspolitik.
- Die zwei Ebenen des Übersetzens: habitualisiertes und institutionalisiertes Übersetzen.
- Die ambivalenten Rollen der Translation: Kulturförderung und Destabilisierung.
- Die Entwicklung eines Translationsregimes in der Habsburgermonarchie.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der heterogenen Zusammensetzung der k. und k. Gesellschaft. Es werden die verschiedenen ethnisch-sprachlichen Identitäten innerhalb der Monarchie sowie die Folgen der Industrialisierung für die Gesellschaft und die Sprache beschrieben. Im Fokus steht dabei die wachsende Mehrsprachigkeit und ihre Auswirkungen auf die Kommunikation und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Kapitel 3 analysiert die Zwei- und Mehrsprachigkeit auf institutioneller Ebene. Es werden die rechtlichen Grundlagen der Sprachenfrage und die Rolle der Sprache als politisches Instrument in der Verwaltung und in statistischen Erhebungen beleuchtet. Kapitel 4 betrachtet die Zwitterbeschaffenheit der Translation. Es wird die Rolle der Translation als Kulturförderung sowie als Destabilisierungsmittel in der Habsburgermonarchie untersucht. Das Kapitel veranschaulicht, wie Translation sowohl zur Stabilisierung der Monarchie als auch zu ihrer Destabilisierung beitragen konnte.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind Translation, Mehrsprachigkeit, Habsburgermonarchie, Kulturförderung, Destabilisierung, Sprachenfrage, Translationsregime und gesellschaftlicher Wandel. Die Arbeit befasst sich mit der Rolle der Translation als kulturelle und politische Kraft innerhalb des vielsprachigen und multikulturellen Gefüges der Habsburgermonarchie.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte die Translation in Österreich-Ungarn um 1900?
Translation war ein zentrales Instrument zur Verwaltung der vielsprachigen Monarchie, diente aber gleichzeitig als politisches Kampfmittel im nationalen Sprachenstreit.
Was war die zentrale „Sprachenfrage“ in der Habsburger Monarchie?
Es ging um die rechtliche Anerkennung der verschiedenen Landessprachen (z.B. Tschechisch) gegenüber dem Deutschen in der Verwaltung, im Gerichtswesen und in Schulen.
Inwiefern wirkte Translation destabilisierend auf die Monarchie?
Durch Übersetzungen wurden nationale Identitäten gestärkt und Forderungen nach Autonomie verbreitet, was das übernationale Gefüge der k. und k. Gesellschaft schwächte.
Was versteht man unter dem „Schmelztiegel Wien“?
Wien war um 1900 ein Zentrum der Migration aus allen Kronländern, was zu einer extremen sprachlichen und kulturellen Heterogenität innerhalb der Hauptstadt führte.
Welche Bedeutung hatten Literaturübersetzungen in dieser Zeit?
Literaturübersetzungen dienten der kulturellen Emanzipation der einzelnen Nationen und halfen dabei, nationale Kulturen im europäischen Kontext zu positionieren.
- Quote paper
- BA Helena Fuxová (Author), 2021, Die Rolle der Translation in Österreich-Ungarn um 1900. Zwischen Kulturförderung und Destabilisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1138895