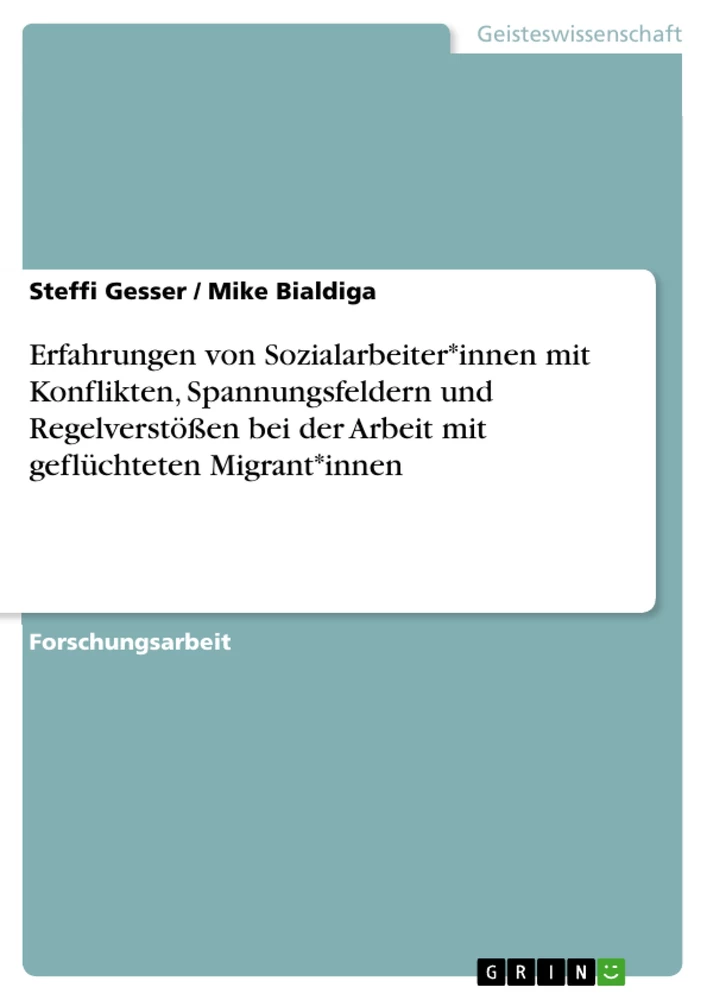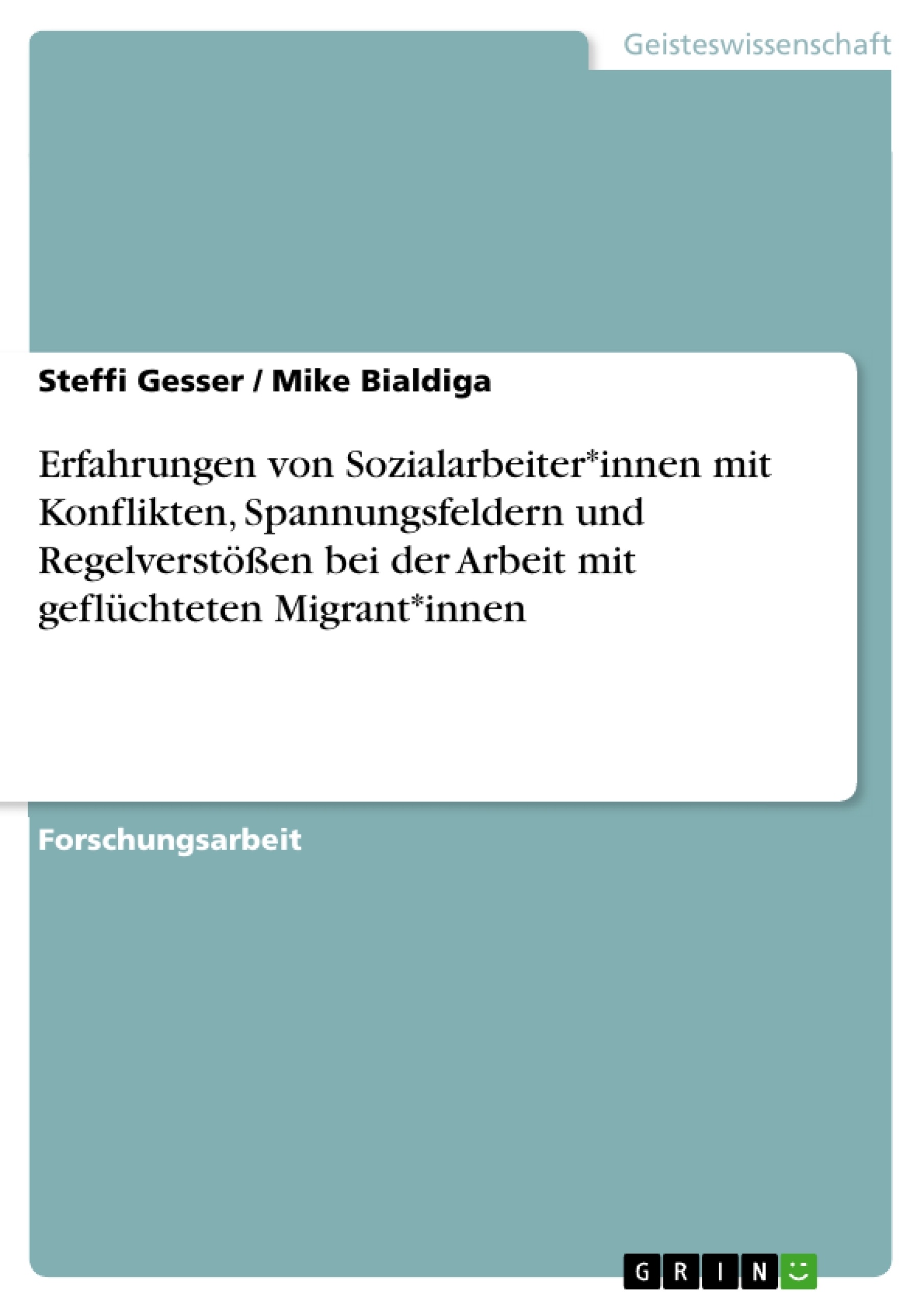Ziel der Arbeit ist das Herausarbeiten von Spannungsfeldern, Konflikten und gegebenenfalls Regelverstößen durch die Migrant*innen und der Umgang der beteiligten Sozialarbeiter*innen hiermit. Es sollen die Spannungsfelder und Konflikte einerseits benannt und analysiert werden. Andererseits betrachten wir auch die Hintergründe näher, weshalb es zu Konflikten oder Spannungen gekommen ist. Weiterhin beleuchten wir in der vorliegenden Arbeit, wie Sozialarbeiter*innen mit Konflikten, Spannungsfeldern und eventuellen Regelverstößen umgehen bzw. umgegangen sind und inwieweit sie diese möglicherweise auch legitimieren beziehungsweise legitimiert haben.
Auf den Aufbau und die Durchführung der Forschung gehen wir im Methodenteil näher ein. Hier werden wir dann auch erklären, wie die Forschungsfrage, der Interviewaufbau und die Auswahl der interviewten Expert*innen zustande kam sowie welche Schwierigkeiten sich ergeben haben und wie wir sie auflösen konnten.
Beginnen möchten wir diese Arbeit mit einem Einblick in ein Themenfeld der Sozialen Arbeit, das von vielen Spannungen und Konflikten geprägt sein kann. Ein Arbeitsgebiet, das den, in diesem Bereich beschäftigten Sozialarbeiter*innen, viel abverlangt.
Die Frage soll durch eine Stichprobe mit der Methode eines offenen Expert*inneninterviews, im Kontext der Arbeit in einer. Hierdurch wurde innerhalb einer sehr kurzen Zeit viel Personal in den Einrichtungen benötigt. Da die meisten Sozialarbeiter*innen zu diesem Zeitpunkt über keine ausreichenden Erfahrungen mit geflüchteten Migrant*innen verfügten, standen sie recht unvorbereitet diesen neuen Herausforderungen gegenüber.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ein Exkurs in die Asyl- und Flüchtlingspolitik Deutschlands
- Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
- Rechtliche Grundlagen der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
- Spannungsfelder bei der Arbeit mit jugendlichen Migrant*innen
- Multiprofessionale Zusammenarbeit im Kontext der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge
- Die Methodik dieser Lehrforschungsarbeit
- Qualitative Sozialforschung
- Von der Forschungsfrage zum Interviewleitfaden
- Feldzugang, Planung und Durchführung der Interviews
- Transkription und Auswertung der Ergebnisse
- Auswertung und Analyse der Ergebnisse unserer Stichprobe
- Diskussion der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Forschungsarbeit analysiert die Erfahrungen von Sozialarbeiter*innen im Umgang mit Konflikten, Spannungsfeldern und Regelverstößen bei der Arbeit mit geflüchteten Migrant*innen. Ziel ist es, die Herausforderungen und Schwierigkeiten dieser Arbeit aufzuzeigen sowie die Strategien und Herangehensweisen der Sozialarbeiter*innen zu beleuchten.
- Spannungsfelder und Konflikte in der Arbeit mit geflüchteten Migrant*innen
- Regelverstöße von Migrant*innen und die Reaktion der Sozialarbeiter*innen
- Die Rolle der Sozialarbeiter*innen als Vermittler zwischen den Bedürfnissen der Migrant*innen und den Rahmenbedingungen der Jugendhilfe
- Die Bedeutung von interkultureller Kompetenz und interdisziplinärer Zusammenarbeit
- Mögliche Auswirkungen der Asyl- und Flüchtlingspolitik auf die Arbeit der Sozialarbeiter*innen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Forschungsfrage und den Fokus auf die Erfahrungen von Sozialarbeiter*innen mit Konflikten und Spannungsfeldern im Kontext der Arbeit mit geflüchteten Migrant*innen in der vollstationären Jugendhilfe dar.
- Ein Exkurs in die Asyl- und Flüchtlingspolitik Deutschlands: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Asyl- und Flüchtlingspolitik Deutschlands, beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Herausforderungen für die Aufnahme und Integration von Migrant*innen.
- Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge: Dieses Kapitel widmet sich den rechtlichen Grundlagen, den Spannungsfeldern und der multiprofessionellen Zusammenarbeit im Kontext der Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.
- Die Methodik dieser Lehrforschungsarbeit: Dieses Kapitel erläutert die methodischen Grundlagen der Forschungsarbeit, die qualitative Sozialforschung mit offenen Expert*inneninterviews.
- Auswertung und Analyse der Ergebnisse unserer Stichprobe: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Stichprobe und analysiert diese im Kontext der Forschungsfrage.
Schlüsselwörter
Die Forschungsarbeit konzentriert sich auf die Bereiche der Sozialen Arbeit, der Asyl- und Flüchtlingspolitik, der Arbeit mit Migrant*innen, der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, der Konfliktlösung, der interkulturellen Kompetenz, der multiprofessionellen Zusammenarbeit und der qualitativen Sozialforschung.
- Citation du texte
- Steffi Gesser (Auteur), Mike Bialdiga (Auteur), 2021, Erfahrungen von Sozialarbeiter*innen mit Konflikten, Spannungsfeldern und Regelverstößen bei der Arbeit mit geflüchteten Migrant*innen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1138910