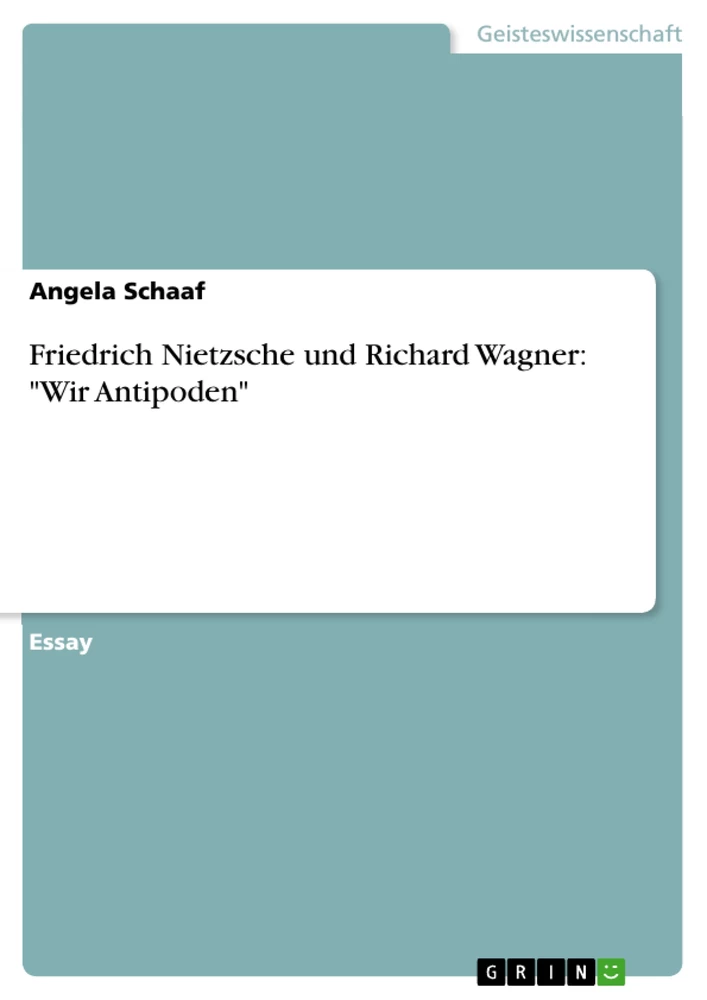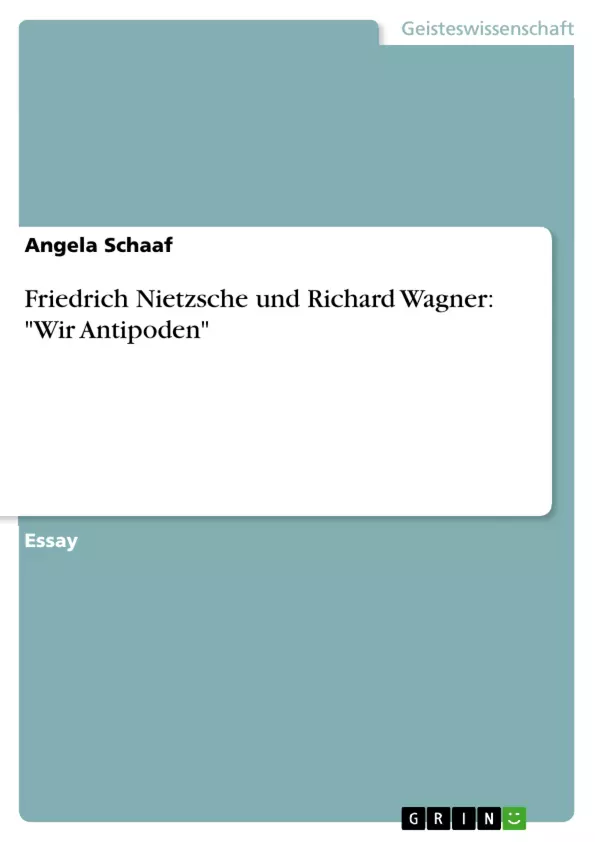Untrennbar sind die Namen Friedrich Nietzsche und Richard Wagner miteinander verbunden, unleugbar ist der maßgebliche Einfluß, den Wagner auf Leben und Werk des jungen Philosophen ausgeübt hat.
Bereits vor der ersten persönlichen Begegnung kann sich Nietzsche dem Zauber der Wagnerschen Musik nicht entziehen:
„Ich bringe es nicht fertig, mich dieser Musik gegenüber kritisch kühl zu verhalten; jede Faser, jeder Nerv zuckt an mir, und ich habe lange nicht ein solches andauerndes Gefühl der Entrücktheit gehabt als bei letztgenannter Ouvertüre“ .
Beschränkte sich die Begeisterung jedoch zunächst auf die Musik des großen Meisters, schließt sie diesen nach dem ersten Zusammentreffen am 8. November des Jahres 1868 auf das ausdrücklichste mit ein, ja konzentriert sich gar auf ihn:
„Wagner, wie ich ihn jetzt kenne, aus seiner Musik, seinen Dichtungen, seiner Ästhetik, zum nicht geringsten Teile aus jenem glücklichen Zusammensein mit ihm, ist die leibhaftigste Illustration dessen, was Schopenhauer ein Genie nennt“ .
Und in der Tat entwickelt die Philosophie Schopenhauers sich zum Grundbaustein der entstehenden Freundschaft. Nietzsche ist mehr denn erfreut darüber, seine Leidenschaft für Schopenhauer von Wagner bestätigt zu finden:
„Inzwischen hatte ich ein längeres Gespräch mit ihm über Schopenhauer: ach, und Du begreifst es, welcher Genuß es für mich war, ihn mit ganz unbeschreiblicher Wärme von ihm reden zu hören, was er ihm verdanke, wie er der einzige Philosoph sei, der das Wesen der Musik erkannt habe“.
Die von Schopenhauer proklamierte pessimistische Welteinstellung beruht darauf, daß der Mensch niemals in der Lage sein kann, seinen Willen, „diesen grundlosen und ziellosen (blinden) Drang“, der „der Vorstellungswelt (jedes Menschen) zu Grunde“ liegt, zu befriedigen. Aufgrund dieser Tatsache kann es „kein dauerhaftes Glück“ geben und „ist das Leben unausweichlich von Schmerz und Leiden gekennzeichnet“. Eine Erlösung von jenem Leiden durch die „Verneinung des Willens“ kann auf zweierlei Art geschehen: „entweder durch Kontemplation in der Kunstbetrachtung oder durch Askese und Entsagung“.
Inhaltsverzeichnis
- Friedrich Nietzsche und Richard Wagner
- "Wir Antipoden.“
- Schopenhauer als Grundbaustein der Freundschaft
- Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik
- Die Entfremdung
- Der Bruch
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die komplexe Beziehung zwischen Friedrich Nietzsche und Richard Wagner, die von anfänglicher Bewunderung und Freundschaft bis hin zu einer tiefen Entfremdung reichte. Sie beleuchtet die gemeinsamen Wurzeln in der Philosophie Schopenhauers, die Entstehung von Nietzsches Erstlingswerk "Die Geburt der Tragödie" und die schleichende Distanzierung Nietzsches von Wagner, die sich in seinen Schriften und persönlichen Briefen widerspiegelt.
- Die Entwicklung der Beziehung zwischen Nietzsche und Wagner
- Der Einfluss Schopenhauers auf beide Denker
- Die Entstehung von Nietzsches "Die Geburt der Tragödie"
- Die Gründe für die Entfremdung zwischen Nietzsche und Wagner
- Die Auswirkungen der Beziehung auf die Werke beider Denker
Zusammenfassung der Kapitel
- Friedrich Nietzsche und Richard Wagner
- "Wir Antipoden.“
Der Text beginnt mit einer Darstellung der engen Verbindung zwischen Nietzsche und Wagner, die durch Wagners Einfluss auf den jungen Philosophen geprägt war. Die anfängliche Begeisterung für Wagners Musik entwickelte sich zu einer tiefen Bewunderung für den Komponisten selbst, die durch die gemeinsame Faszination für Schopenhauers Philosophie verstärkt wurde.
- Schopenhauer als Grundbaustein der Freundschaft
Die gemeinsame Wertschätzung für Schopenhauers Philosophie bildete den Grundstein für die Freundschaft zwischen Nietzsche und Wagner. Beide Denker teilten die pessimistische Weltsicht Schopenhauers und sahen in der Kunst einen möglichen Ausweg aus dem Leiden der Existenz. Nietzsche fand in Wagner einen Gleichgesinnten, der seine Leidenschaft für Schopenhauer teilte und ihm in seinen künstlerischen Werken eine Bestätigung seiner philosophischen Ansichten bot.
- Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik
In diesem Kapitel wird Nietzsches Erstlingswerk "Die Geburt der Tragödie" vorgestellt, das während seiner Zeit in Tribschen entstand und von Wagners Einfluss geprägt ist. Nietzsche analysiert die griechische Tragödie als Synthese aus dem apollinischen und dem dionysischen Prinzip und sieht in Wagners Musik eine Wiedergeburt des dionysischen Geistes. Die Arbeit stieß jedoch auf Ablehnung in der akademischen Welt und führte zu einer beruflichen Krise für Nietzsche.
- Die Entfremdung
Der Text beschreibt die schleichende Entfremdung zwischen Nietzsche und Wagner, die sich über mehrere Jahre hinweg entwickelte. Die Gründe für diese Distanzierung sind vielfältig und umfassen persönliche Konflikte, unterschiedliche künstlerische Auffassungen und die zunehmende Selbstständigkeit Nietzsches als Denker. Die Freundschaft zerbrach jedoch nicht abrupt, sondern verlief in einer Phase zunehmender Distanz und Enttäuschung.
- "Wir Antipoden.“
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Friedrich Nietzsche, Richard Wagner, Schopenhauer, "Die Geburt der Tragödie", Freundschaft, Entfremdung, Kunst, Philosophie, Musik, Tragödie, Apollon, Dionysos, Bayreuth, Tribschen.
Häufig gestellte Fragen
Wie begann die Freundschaft zwischen Nietzsche und Wagner?
Die Freundschaft basierte auf Nietzsches früher Begeisterung für Wagners Musik und ihrer gemeinsamen Leidenschaft für die Philosophie Schopenhauers.
Welchen Einfluss hatte Schopenhauer auf beide Denker?
Schopenhauers pessimistische Weltsicht und die Idee der Erlösung durch Kunst bildeten den philosophischen Grundstein ihrer Verbindung.
Was thematisiert Nietzsche in „Die Geburt der Tragödie“?
Nietzsche analysiert die griechische Tragödie als Synthese aus dem apollinischen und dionysischen Prinzip und sieht in Wagners Musik deren Wiedergeburt.
Warum kam es zum Bruch zwischen Nietzsche und Wagner?
Die Gründe waren vielfältig: persönliche Konflikte, unterschiedliche künstlerische Auffassungen und Nietzsches zunehmende philosophische Unabhängigkeit.
Was bedeutet der Begriff „Antipoden“ in diesem Zusammenhang?
Er beschreibt die spätere Entwicklung, in der sich die einstigen engen Vertrauten zu gegensätzlichen Polen in Kunst und Philosophie entwickelten.
- Quote paper
- Angela Schaaf (Author), 2003, Friedrich Nietzsche und Richard Wagner: "Wir Antipoden", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113923