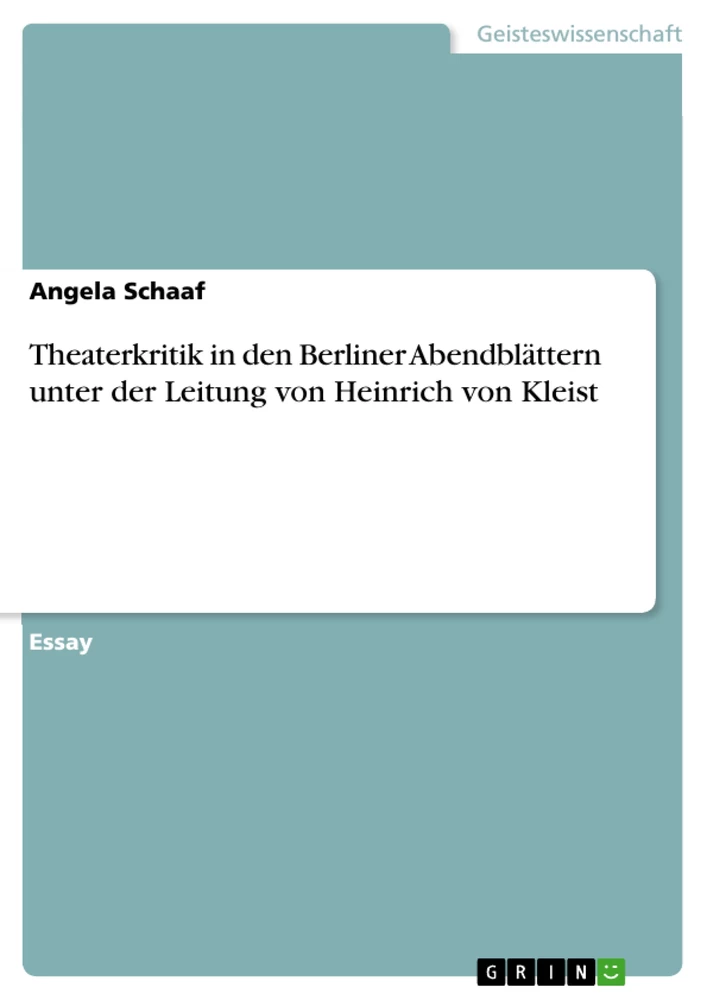Die Berufung August Wilhelm Ifflands nach Berlin
Am 14. November des Jahres 1796 wird August Wilhelm Iffland durch König Friedrich Wilhelm III. zum „Direktor an der Spitze des Nationaltheaters“ nach Berlin berufen. Der Hof hatte den von ihm gestellten Forderungen:
„1. Aufhebung des ganzen iezigen Theaters.
2. unumschränkte Macht über alles.
3. Pension.
4. Bei gewissenhafter Verwaltung und monatl. Rechenschaft keine Verantwortung
des ökonomischen Calcüls...“
gänzlich entsprochen. Damit vereinte Iffland in seiner Person eine bis dahin ungekannte Machtfülle und vereinigte innerhalb kürzester Zeit Verwaltung und künstlerische Leitung des Theaters in seiner Person: Er wählte die zu spielenden Stücke aus, entschied über die Besetzung, führte Regie und stand selber auf der Bühne.
Durch seine unermüdliche Arbeit, getragen durch finanzielle Unterstützung von Seiten des Hofes, fand die künstlerische Leistung des Berliner Nationaltheaters bald Anerkennung auch außerhalb der Stadtgrenzen und den gestiegenen Bedürfnissen entsprach der König mit einem neuen Theaterbau am Gendarmenmarkt, dessen Eröffnung am 01. Januar des Jahres 1802 stattfand.
Als jedoch Preußen 1806 im 4. Koalitionskrieg gegen das napoleonische Frankreich unterliegt, der König fliehen muß und im Oktober desselben Jahres Napoleon in Berlin Einzug hält, zieht dies auch für das Nationaltheater Konsequenzen nach sich. Nicht nur muß Iffland, zumindest zeitweilig, auf finanzielle Subventionen verzichten, auch zwingt ihn die Sorge, die französische Besatzungsmacht könne eine eigene Theatergruppe aus Frankreich engagieren, den Spielplan den französischen Wünschen anzupassen.
Iffland und die Romantik
Ifflands Gestaltung des Spielplans läßt sich auf mehrere Faktoren zurückführen: Da „Schiller’s die Verkommenheit in herrschenden Kreisen entblößenden Jugenddramen (...) die Stücke (waren), für deren vollendete Darstellung er die schauspielerischen Mittel, wie kein Anderer, besaß“ , bildeten diese selbstverständlich einen festen Bestandteil des Repertoires, weniger als die Stücke Goethes, worauf später noch einzugehen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Theaterkritik in den Berliner Abendblättern unter der Leitung von Heinrich von Kleist
- Die Berufung August Wilhelm Ifflands nach Berlin
- Iffland und die Romantik
- Ifflands ablehnende Haltung gegen Kleist
- Theaterkritik in den Berliner Abendblättern
- Der Sohn durchs Ungefähr
- Kleists Unmaßgebliche Bemerkung
- Kleists Angriff gegen die Theaterkritik der Vossischen Zeitung
- Schreiben eines redlichen Berliners, das hiesige Theater betreffend, an einen Freund im Ausland
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Theaterkritik Heinrich von Kleists in den Berliner Abendblättern, insbesondere seinen Konflikt mit August Wilhelm Iffland und dessen Einfluss auf das Berliner Nationaltheater. Die Analyse fokussiert auf Kleists Strategien der Kritik, die Rolle der Romantik und die damalige Theaterlandschaft Berlins.
- Kleists Auseinandersetzung mit Ifflands Theaterpolitik
- Die Rolle der Berliner Abendblätter in der Theaterdebatte
- Der Einfluss der Romantik auf die Theaterkritik
- Die Auseinandersetzung mit der Theaterkritik der Vossischen Zeitung
- Satire und Ironie als Stilmittel in Kleists Kritik
Zusammenfassung der Kapitel
Theaterkritik in den Berliner Abendblättern unter der Leitung von Heinrich von Kleist: Dieses Kapitel beschreibt den Kontext der Theaterkritik in den Berliner Abendblättern und die Rolle verschiedener Autoren, darunter Kleist selbst, in der Auseinandersetzung mit dem Berliner Nationaltheater unter Iffland. Es legt den Grundstein für die nachfolgenden Kapitel, in denen konkrete Beispiele der Kritik analysiert werden.
Die Berufung August Wilhelm Ifflands nach Berlin: Dieses Kapitel beleuchtet die Berufung Ifflands zum Direktor des Berliner Nationaltheaters und seine umfassende Machtfülle. Es schildert Ifflands Einfluss auf die künstlerische Leitung und den Spielplan, seine Erfolge und die Herausforderungen, vor allem im Kontext des napoleonischen Krieges und der finanziellen Abhängigkeit vom Hof.
Iffland und die Romantik: Dieses Kapitel untersucht Ifflands Verhältnis zur aufkommenden romantischen Bewegung. Es analysiert, warum Iffland romantische Stücke ablehnte und diskutiert unterschiedliche Interpretationen zu den Gründen seines Widerstands. Die unterschiedlichen Perspektiven von Reinhold Steig und Ruth Freydank bezüglich Ifflands Bemühungen, die romantischen Produktionen auf seine Bühne zu bringen, werden kontrastiert.
Ifflands ablehnende Haltung gegen Kleist: Der Fokus liegt auf der Ablehnung von Kleists „Käthchen von Heilbronn“ durch Iffland. Das Kapitel detailliert den Konflikt zwischen den beiden, inklusive Kleists sarkastischer Reaktion und Ifflands ungeschickter Verteidigung, die den Konflikt eher verschärfte als löste. Der Brief von Fouqué liefert einen lebendigen Einblick in das Ereignis und dessen Wahrnehmung.
Theaterkritik in den Berliner Abendblättern: Hier wird die Strategie der Berliner Abendblätter im Angriff auf Ifflands Theaterpolitik beschrieben. Das Kapitel beginnt mit einer scheinbar wohlwollenden „Hymne an Iffland“, die sich als Täuschungsmanöver entpuppt, um den wahren Angriff auf seine Theaterführung vorzubereiten.
Der Sohn durchs Ungefähr: Dieses Kapitel analysiert Kleists (oder Major von Möllendorffs) Kritik an der Aufführung der Posse „Der Sohn durchs Ungefähr“. Die Kritik wird detailliert untersucht, einschließlich der ironischen Sprache und der implizierten Frage nach der erreichten Grenze inszenatorischer Möglichkeiten. Der Angriff auf die Rezensenten der Vossischen Zeitung wird ebenfalls beleuchtet.
Kleists Unmaßgebliche Bemerkung: Die Analyse fokussiert auf Kleists Artikel „Unmaßgebliche Bemerkung“, in dem er offen Ifflands Theaterpolitik kritisiert. Kleist verwendet einen Vergleich mit Adam Smith, um die wirtschaftliche Argumentation Ifflands zu widerlegen und die Notwendigkeit ehrlicher Kritik hervorzuheben. Das Kapitel betont den großen Eindruck, den dieser Artikel auf das Berliner Publikum machte.
Kleists Angriff gegen die Theaterkritik der Vossischen Zeitung: Dieses Kapitel analysiert Kleists Angriff auf die Rezensenten der Vossischen Zeitung, die Iffland positiv bewerteten. Der Verdacht der Bestechung wird erörtert und Kleists direkter Aufforderung an die Rezensenten, ihre Unschuld zu beweisen, wird detailliert beschrieben. Der Erfolg dieser Aktion und die dadurch verursachte Zerrüttung der Beziehungen zwischen den Parteien wird hervorgehoben.
Schreiben eines redlichen Berliners, das hiesige Theater betreffend, an einen Freund im Ausland: Dieses Kapitel analysiert Kleists ironisches „Schreiben eines redlichen Berliners“, in dem er Iffland scheinbar lobt, aber gleichzeitig seine Theaterpolitik verhöhnt. Die Ironie der Sprache wird detailliert untersucht, und der Vergleich Ifflands mit dem Papst verdeutlicht den Umfang von Kleists Kritik.
Schlüsselwörter
Heinrich von Kleist, August Wilhelm Iffland, Berliner Abendblätter, Berliner Nationaltheater, Theaterkritik, Romantik, Vossische Zeitung, Ifflandsche Theaterpolitik, Satire, Ironie, Kants Kritik der Urteilskraft, Adam Smith.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Theaterkritik Heinrich von Kleists in den Berliner Abendblättern
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Theaterkritik Heinrich von Kleists in den Berliner Abendblättern, insbesondere seinen Konflikt mit August Wilhelm Iffland und dessen Einfluss auf das Berliner Nationaltheater. Die Analyse konzentriert sich auf Kleists kritische Strategien, die Rolle der Romantik und die damalige Berliner Theaterlandschaft.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Kleists Auseinandersetzung mit Ifflands Theaterpolitik, die Rolle der Berliner Abendblätter in der Theaterdebatte, den Einfluss der Romantik auf die Theaterkritik, den Konflikt mit der Theaterkritik der Vossischen Zeitung und den Einsatz von Satire und Ironie in Kleists Kritik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel, die die Theaterkritik in den Berliner Abendblättern unter Kleists Leitung, Ifflands Berufung nach Berlin, Ifflands Verhältnis zur Romantik, Ifflands Ablehnung von Kleists Werken, weitere Strategien der Kritik in den Berliner Abendblättern, die Kritik an "Der Sohn durchs Ungefähr", Kleists "Unmaßgebliche Bemerkung", den Angriff auf die Vossische Zeitung und schließlich das "Schreiben eines redlichen Berliners" analysieren.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Konflikt zwischen Kleist und Iffland im Kontext der Berliner Theaterlandschaft und der aufkommenden Romantik. Sie beleuchtet Kleists kritische Methoden und deren Wirkung auf das damalige Theatergeschehen.
Welche Rolle spielt August Wilhelm Iffland?
August Wilhelm Iffland spielt eine zentrale Rolle als Direktor des Berliner Nationaltheaters. Seine Theaterpolitik, seine Ablehnung romantischer Stücke und sein Konflikt mit Kleist bilden den Kern der Analyse.
Welche Rolle spielt die Romantik?
Die aufkommende romantische Bewegung und Ifflands Ablehnung derselben werden untersucht, um den Kontext von Kleists Kritik zu verstehen. Die unterschiedlichen Interpretationen dieses Konflikts werden diskutiert.
Welche Rolle spielen die Berliner Abendblätter und die Vossische Zeitung?
Die Berliner Abendblätter dienen als Plattform für Kleists Theaterkritik. Der Vergleich mit der Vossischen Zeitung, die Iffland positiv darstellte, verdeutlicht die gegensätzlichen Positionen und Strategien in der Theaterdebatte.
Welche Methoden der Kritik verwendet Kleist?
Kleist verwendet Satire, Ironie und scheinbar wohlwollende Kritik, die sich als scharfe Angriffe entpuppt, um Ifflands Theaterpolitik zu kritisieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Heinrich von Kleist, August Wilhelm Iffland, Berliner Abendblätter, Berliner Nationaltheater, Theaterkritik, Romantik, Vossische Zeitung, Ifflandsche Theaterpolitik, Satire, Ironie, Kants Kritik der Urteilskraft, Adam Smith.
Welche konkreten Beispiele der Kritik werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Kleists Kritik an Ifflands Inszenierungen, unter anderem an "Der Sohn durchs Ungefähr" und an Kleists eigenem Stück "Käthchen von Heilbronn". Auch Kleists "Unmaßgebliche Bemerkung" und sein "Schreiben eines redlichen Berliners" werden detailliert untersucht.
- Arbeit zitieren
- Angela Schaaf (Autor:in), 2003, Theaterkritik in den Berliner Abendblättern unter der Leitung von Heinrich von Kleist, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113924